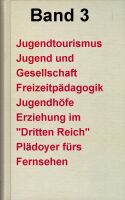 Hermann
Giesecke
Hermann
Giesecke
Gesammelte Schriften
Band 3: 1964
© Hermann Giesecke![]() Inhaltsverzeichnis
aller Bände
Inhaltsverzeichnis
aller Bände
![]()
Zu dieser Edition
Dieser 3. Band meiner gesammelten Schriften enthält Arbeiten aus dem Jahr 1964 . In dieser Zeit war ich (seit 1963) als Wissenschaftlicher Assistent am Institut für Pädagogik der Universität Kiel tätig. Nähere biographische Angaben finden sich in meiner Autobiographie Mein Leben ist lernen, Weinheim: Juventa Verlag 2000.
Die Edition der Schriften in diesem Band bemüht sich um Vollständigkeit. Aufgenommen wurden nur bereits gedruckte Texte.
Die Texte sind nach ihrem Erscheinungsjahr geordnet.
Die Plazierung der Fußnoten wurde vereinheitlicht; sie befinden sich nun am Ende des jeweiligen Beitrags. Offensichtliche Druckfehler wurden korrigiert. Darüber hinaus wurden die Originale jedoch nicht verändert. Nachträgliche Anmerkungen des Herausgebers sind durch (*) oder durch ein Namenskürzel ("H.G.") gekennzeichnet. Um die Zitierfähigkeit der Texte zu gewährleisten, wurden die ursprünglichen Seitenangaben mit aufgenommen und erscheinen am linken Textrand; sie beenden die jeweilige Textseite des Originals.
Die Beiträge werden von "1" an numeriert, die vorangehenden Arbeiten befinden sich in den früheren Bänden.
26. Ist Jugendtourismus pädagogisierbar? (1964)
27. Fragezeichen-Schallplatten (1964)
28. Jugend und Gesellschaft (1964)
29. Freizeitpädagogik (1964)
30. Ist Tourismus jugendgefährdend? (1964)
31. Die Entwicklung der Jugendhöfe (1964)
32. Erziehung im "Dritten Reich" (1964)
33. Was ist Jugendarbeit? (1964)
34. Pädagogisches Plädoyer fürs Fernsehen (1964)
26. Ist Jugendtourismus pädagogisierbar? (1964)
(In: deutsche jugend, H. 3/1964, S. 109-114)Die Frage, welche pädagogischen Einwirkungen auf das Jugendreisen möglich sind, beschäftigt zur Zeit nicht nur Pädagogen, sondern auch die zuständigen Instanzen der Jugendförderung. Die im vergangenen Jahr veröffentlichten Beobachtungsberichte von Helmut Kentler und Udo Perle haben dazu geführt, daß man sich überlegt, was getan werden müsse, um die Probleme der pädagogisch nicht kontrollierbaren Jugendreisen zu bewältigen. In den meisten Stellungnahmen zu dieser Frage mischen sich verschiedene Probleme und auch verschiedene Interessen und Ideologien. Es mag daher sinnvoll sein, hier eine grundsätzliche Klärung zu versuchen.
"Jugendreisen" und " Jugendtourismus"
Zunächst ist es wohl zweckmäßig, eine grundsätzliche Trennung zwischen Jugendtourismus und pädagogisch geplantem Jugendreisen vorzunehmen. Daß das Reisen ein wichtiger und unerläßlicher Beitrag zum jugendlichen Bildungsgang sei, sofern es nur richtig vom Pädagogen geplant und gestaltet werde, dies ist eine unbestrittene Ansicht der meisten Pädagogen der Neuzeit. Schulreisen unter Leitung der Lehrer haben eine lange Geschichte. Aber diese Reisen bleiben Bestandteil der "Pädagogischen Provinz", ein Feld des Übens und Lernens. Ihre Tradition reicht bis in die Gegenwart weiter: Kommunale Jugenderholungspflege, Fahrten der Jugendgruppen, Bildungs- und Studienreisen, internationale Begegnungen und Schullandheimaufenthalte - um nur einige solche Veranstaltungen zu nennen - beruhen ausgesprochen oder unausgesprochen auf einer pädagogisch motivierten
109
Planung und auf der Annahme, daß gemeinsames Reisen unter bestimmten Bedingungen bildend sei. Diese Ansicht haben sich auch diejenigen Jugendpläne zu eigen gemacht, die solche Reisen fördern. Eine pädagogische Erörterung dieses Bereiches müssen wir hier aussparen, obwohl sie überfällig ist. (Dabei müßte sich dieser Bereich unter anderem vor seiner eigenen Tradition verantworten, er müßte prüfen, wieweit er sich gegenüber dem, was früher über den Bildungswert des Reisens gedacht wurde, als fortschrittlich bezeichnen darf, oder inwieweit er umgekehrt abgesunken ist zur bloßen antigesellschaftlichen Ideologie, die sich in Wahrheit gar nicht mehr pädagogisch, sondern höchstens noch kulturpolitisch begründet.)
Um die pädagogische Problematik des Jugendtourismus zu erfassen, muß man sich zunächst eine entscheidende gesellschaftliche Wandlung vergegenwärtigen. Vor den Zeiten der Jugendbewegung konnten Jugendliche normalerweise entweder nur mit ihren Eltern oder mit ihren Lehrern verreisen, das heißt unter pädagogischer Aufsicht, Planung und Kontrolle. Selbst die wandernden jugendlichen Gruppen der Jugendbewegung mußten sich in einem recht engen Rahmen der bürgerlichen "Wohlanständigkeit" bewegen. So revolutionär ihnen selbst die neuen Möglichkeiten erschienen, ohne Begleitung von Erwachsenen durch die Lande zu ziehen, so sehr blieben sie doch allenthalben unter der Kontrolle einer Erwachsenenwelt, die von Hamburg bis München präzise und gleichartige Vorstellungen darüber hatte, was "sich gehörte". In diesem Sinne blieben auch die Bünde eine "Pädagogische Provinz", wenngleich sie andererseits deren Rahmen sprengten. Die Freizeitkontrolle über die Jugendlichen durch die Eltern blieb trotz des erstrebten Eigenlebens relativ dicht und lückenlos.
Gerade dies hat sich im gegenwärtigen Jugendtourismus geändert. Seine entscheidende gesellschaftliche Voraussetzung ist, daß die Freizeit der Jugendlichen von den Eltern prinzipiell nicht mehr lückenlos zu kontrollieren ist und daß auch die übrigen Erziehungsmächte - einschließlich der staatlichen Jugendschutzbehörden - nur noch eng begrenzte Möglichkeiten haben, die Eltern hierin zu unterstützen. Wo Eltern versuchen, eine solche Kontrolle weiterhin rigoros durchzuführen, bringen sie ihre Kinder notwendig in eine Außenseiterposition gegenüber den gleichaltrigen Kollegen und Freunden und hemmen und behindern damit ihr gesellschaftliches Selbstbewußtsein und so eben auch ihre soziale Reifung.
Jugendtourismus und pädagogisch geplantes Jugendreisen verhalten sich demnach zueinander wie Schule und Leben. Konstitutiv für den Jugendtourismus ist eben gerade, daß hier die Schranken der "Pädagogischen Provinz" vollständig gefallen sind. Im Jugendtourismus partizipiert der Jugendliche so uneingeschränkt an der Liberalität der Erwachsenenwelt wie nirgends sonst. Und alle pädagogische Reflexion muß davon ausgehen, daß diese Entwicklung unumkehrbar ist, wenn man nicht eine revolutionäre Änderung der ganzen Gesellschaft erstrebt.
Angesichts dieser Grundeinsicht enthüllen sich manche pädagogischen Überlegungen über Jugendreisen als Illusion. Als Illusion wird sich die Hoffnung ent-
110
larven, man könne das pädagogisch geplante Jugendreisen so attraktiv machen, daß man die Jugendlichen von den touristischen Angeboten weglocken könne. Offensichtlich meiden jene Jugendlichen, die sich dem Tourismus anvertrauen, die anderen Angebote ja deshalb, weil sie die "Pädagogische Provinz" als solche fliehen, und nicht etwa nur ein bestimmtes Programm. Wenn die pädagogischen Unternehmen sich für diese Jugendlichen attraktiver machen wollen, so müßten sie sich die Liberalität der touristischen Unternehmungen zu eigen machen und damit sich selbst aufgeben. Dies wäre deshalb bedauerlich, weil die pädagogisch intendierten Reiseunternehmen ja offensichtlich bei einem Teil der Jugendlichen Interesse finden. Ihre Aufgabe wäre also nicht eine Anpassung an die Bedingungen des Jugendtourismus, sondern die Entwicklung von Modellen dessen, was heute pädagogisch geplantes Jugendreisen sinnvollerweise heißen könnte. Wie viele Jugendliche sie dann "erfassen", ist eine zweitrangige Frage. Oder anders gesagt: Ihre Aufgabe wäre nicht, eine Alternative zum Jugendtourismus zu sein, sondern auf die Teilnahme am Tourismus - das heißt am "Ernst" des selbständigen Reisens - vorzubereiten. Nehmen sie diese Aufgabe des Übens und Vorbereitens ernst, dann müssen sie alle ihre Programme daraufhin befragen, ob sie tatsächlich zur größeren Selbständigkeit der Jugendlichen beitragen oder ob sie lediglich helfen, Urlaub ohne Risiko zu verplanen, was für sich genommen noch keine vernünftige pädagogische Intention wäre.
Ähnlich illusorisch erscheinen mir alle Hoffnungen, den Jugendtourismus selbst in die pädagogische Planung einbeziehen zu können, wenn man nur genügend gut ausgebildete Reiseleiter zur Verfügung hätte. Überschreitet die Planung ein bestimmtes Maß, so daß sie für die Teilnehmer offensichtlich wird, dann werden mit Sicherheit diejenigen Jugendlichen, die schon vorher nicht am pädagogischen Jugendreisen teilnehmen wollten, sich auch jetzt wieder entziehen, weil sie ihre Emanzipation in die Liberalität der Erwachsenenwelt nicht aufgeben wollen.
Vielleicht wäre es sinnvoll, auch begrifflich zwischen "Jugendreisen" und "Jugendtourismus" zu unterscheiden. Unter "Jugendreisen" wären dann alle Veranstaltungen zu subsumieren, bei denen die pädagogische Planung im Vordergrund steht. Ähnlich wie "Schule" ihre Sinngebung vom "Leben" erhält, mit dem sie gleichwohl nicht identisch sein kann, so müssen auch alle "Jugendreisen" über sich selbst hinausweisen und die Erziehung zur Selbständigkeit des späteren Touristen zum Ziele haben. "Jugendtourismus" dagegen sollte man alle diejenigen Maßnahmen und Veranstaltungen nennen, bei denen Jugendliche entweder am Erwachsenentourismus partizipieren oder unter Bedingungen, die dem Erwachsenentourismus vergleichbar sind, ihren Urlaub verbringen. Für die "Logik" des jugendlichen Bildungsganges wäre es natürlich richtig, wenn Jugendliche zunächst am Jugendreisen teilnehmen, um sich dann später souverän im Tourismus bewegen zu können. Aber erstens ist eine solche Logik nicht zu erzwingen, und zweitens erscheint zweifelhaft, ob die Unternehmungen des "Jugendreisens" tatsächlich ihre übende Aufgabe voll erkannt haben.
111
Touristisch emanzipierte und nicht-emanzipierte Jugendliche
Eine zweite Unterscheidung scheint in diesem Zusammenhang sinnvoll, nämlich die zwischen touristisch emanzipierten und nicht-emanzipierten Jugendlichen. Die große Zahl der touristisch selbständigen Jugendlichen können wir hier außer Betracht lassen. Es sind diejenigen, die durch Europa trampen und sich im Ausland auch dann wohlfühlen, wenn sie die Landessprache nur schlecht beherrschen; oder diejenigen, die sich gezielt den großen Reiseunternehmungen anschließen, ohne sich deren Programmen auszuliefern; oder die sich den anspruchsvolleren "Jugendreisen" - Bildungsreisen und internationalen Begegnungen - zuwenden. Diese Jugendlichen gehören wohl überwiegend dem mittleren und höheren Mittelstand an und dürften sich im wesentlichen aus Oberschülern und Studenten rekrutieren.
Pädagogisch problematisch wurde das jugendliche Reisen nicht durch diese Jugendlichen, sondern durch die touristisch nicht emanzipierten Jugendlichen, die über Nacht die ökonomische Möglichkeit zu größeren Reisen bekamen und zugleich vom Prestigedruck ihrer sozialen Umgebung gezwungen wurden, diese neue Möglichkeit nun auch zu ergreifen. Diese Jugendlichen weisen Erziehungsdefizite auf, die man sich in aller Nüchternheit klar machen muß:
1. Ihre Unsicherheit im Umgang mit Kulturellem ist so groß, daß sie schon zu Hause kaum wagen, in einen Buchladen zu gehen, geschweige denn, sich im Urlaub um kulturelle Erscheinungen und Erfahrungen anderer Völker zu bemühen. Da sie meist auch keine Fremdsprache sprechen, ist ihnen die Kommunikation mit Ausländern von vornherein fast unmöglich gemacht.
2. Da ihr Urlaub meist nur knapp 14 Tage beträgt, können und wollen sie es sich nicht leisten, ihn auch noch mit "Lernen" zu verbringen. Sie wollen ihn - zu Recht - von Anfang an "auskosten".
3. Alle Sozialbeziehungen, die sie kennen, sind verhältnismäßig intime, nämlich gemeinschaftliche. Familie, Schule, Lehrjahr und Jugendgruppe sind Sozialbeziehungen, die von sich aus keine distanzierten gesellschaftlichen Verhaltensweisen lehren, wie sie gerade in der Fremde unter Fremden verlangt werden. Es ist daher kein Wunder, wenn Jugendliche auch im Urlaub gern "unter sich" sind: Sie können dann ihre gemeinschaftlichen Sozialerfahrungen auch gegenüber Fremden eher anwenden - und sei es in der Form der erotisch-gestimmten Subkultur, wie sie in Kentlers Catania-Bericht durchscheint. Überall aber, wo gemeinschaftliche Verhaltensweisen nicht anwendbar sind - dafür bieten die Berichte von Kentler und Perle vorzügliche Situationsschilderungen - , bricht die Kommunikationsfähigkeit schlechthin zusammen. Um den Ernst dieses Mangels recht zu würdigen, muß man sich klarmachen, daß die meisten Jugendlichen auch in ihrem Alltag meist keine distanzierten Sozialbeziehungen benötigen. Sie kommunizieren mit einem eng begrenzten Personenkreis. Das oft gebrauchte Bild von der "atomisierten Gesellschaft", in der die einzelnen ständig heterogenen Rollenerwartungen ausgesetzt würden,
112
stimmt ja für den Bereich der alltäglichen Kommunikation der meisten Jugendlichen nicht. Wenn man also glaubt, Reiseerziehung hieße nun wieder, Jugendliche "gemeinschaftlich" in den Urlaub zu führen, so zielt man damit gerade am entscheidenden Problem vorbei.
Erst auf diesem weiten Hintergrund, den wir hier nur knapp skizzieren konnten, kann man sich sinnvoll fragen, was denn pädagogische Einflußnahme auf das jugendliche Reisen heißen könne. Die Probleme, vor die uns heute das jugendliche Massenreisen stellt, machen uns zunächst einmal kulturpolitische und erziehungspolitische Fehlleistungen deutlich, die, wenn sie nicht behoben werden, auch diese Probleme weiter bestehen lassen: Solange die überwiegende Mehrzahl der Jugendlichen hinsichtlich ihres Urlaubs gegenüber den gleichaltrigen Oberschülern benachteiligt wird, solange die Schulzeit für alle nicht erheblich verlängert und von anderen als den heute gängigen Bildungs- und Sozialvorstellungen her gestaltet wird, solange wir nicht neben den gemeinschaftlichen auch gesellschaftliche Erziehungsfelder schaffen, solange wird die pädagogische Problematik auch unvermindert fortbestehen: Die pädagogischen Defizite entstehen nicht beim Reisen, sie offenbaren sich dort nur.
"Teilnehmende Erziehung"
Auf diesem Hintergrund nimmt sich das, was beim Jugendtourismus pädagogisch erreichbar ist, sehr bescheiden aus. An den drei Defiziten jedenfalls, die wir oben genannt haben, können pädagogische Einflußnahmen während des Reisens so gut wie nichts ändern. Ich sehe nur drei Möglichkeiten einer solchen Einflußnahme:
1. Die touristischen Unternehmungen können am Urlaubsort günstige und weniger günstige Bedingungen schaffen. Günstig sind die Bedingungen dann, wenn sie möglichst wenig Versuchungen einer jugendlichen Subkultur nahelegen, wie sie in Catania zu verzeichnen waren. Leider wissen wir noch zu wenig über die Zusammenhänge von Urlaubssituation und Urlaubsverhalten der Jugendlichen. Die bisherigen Beobachtungen legen aber die Hypothese nahe, daß die Situation um so produktiver ist, je selbstverständlicher sie in die Erwachsenenwelt der Urlaubsumgebung einbezogen ist. Gerade das, was nach den allgemeinen Vorstellungen von Jugendarbeit so nahe läge, nämlich die Herstellung "jugendeigener" Urlaubssituationen, scheint - auf die touristischen Bedingungen angewandt - zu bedenklichen Sozialbeziehungen zu führen.
2. Nicht so sehr ein eigenes Programm des Urlaubsveranstalters wäre wichtig - gar noch in den Dimensionen von Volkstanz und Singen - , als vielmehr eine Vergrößerung der Zahl der Reiseleiter, die so ausgebildet sind, daß sie sich wirklich mit den einzelnen beschäftigen, den Unsicheren Ratschläge erteilen und auch mit Geschick eine genauere Aufsicht ausüben können. Wenn es gelingt, auf diese Weise die allgemeinen moralischen Grundsätze der Erwachsenenwelt auch hier aufrecht zu erhalten, wäre das schon sehr viel.
113
3. Diese beiden Ansätze sind aber eigentlich noch keine pädagogischen Maßnahmen, sondern eher restriktive. Innerhalb der touristischen Situation, die wir ja deutlich von der Situation des "Jugendreisens" getrennt haben, scheint mir höchstens das möglich zu sein, was Udo Perle vorgeschlagen hat (in seinem Artikel im Märzheft "deutsche jugend" 1963) und was man vielleicht in Anlehnung an die "teilnehmende Beobachtung" die "teilnehmende Erziehung" nennen könnte. Die Erzieher wären dabei gleichberechtigte Teilnehmer ohne irgendeine Amtsautorität. Sie könnten also keinerlei Ansprüche durchsetzen, ihre Chance bestünde nur darin, daß sie die Jugendlichen für ihre eigenen Unternehmungen gewinnen und sie mitmachen lassen bei dem, was sie selbst für "richtigen Urlaub" halten. Sollte sich eine solche pädagogische Praxis als erfolgreich erweisen, so wäre sie eine solche, die mit allen Konsequenzen die pädagogische Provinz verlassen hätte. Man darf deshalb auf die Experimente, die in dieser Richtung in diesem Jahr stattfinden sollen, sehr gespannt sein.
Dennoch sollte man auch hier die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Es wird nur wenige Erwachsene geben, die in einer solchen Situation produktiv wirken können. Während man Reiseleiter durchaus für ihre Tätigkeit ausbilden kann, insofern es sich bei dieser Tätigkeit um bestimmte Funktionen handelt, kann man solche Erzieher im Grund nicht mehr ausbilden, sondern nur noch "finden". Vielleicht stellt sich sogar heraus, daß der dafür geeignete Personenkreis gar nicht so sehr in bestimmten Erzieherberufen zu finden ist, als vielmehr unter solchen Menschen, die - unabhängig vom Grad ihrer pädagogischen Ausbildung - Eigenwilligkeit mit Urbanität und Entschiedenheit des persönlichen Lebensstiles verbinden können.
114
27. Fragezeichen-Schallplatten (1964)
(In: deutsche jugend, H. 1/1964, S. 47-48)Die sogenannten "Fragezeichen-Filme" des Münchner Instituts für Film und Bild haben sich einen festen Platz in der Methodik der freien Jugendarbeit gesichert. Sie sind dadurch gekennzeichnet, daß sie ein aktuelles Problem, zu dem es mehrere gültige Meinungen geben kann, nur "anspielen", die Lösung hingegen aussparen und der Diskussion der Zuhörer überlassen.
Daß ein solches Verfahren auch mit Hilfe der Schallplatte möglich ist, beweist die Reihe "Herders Bildungsabende". Sie enthält außer den hier angezeigten politischen Themen auch noch religiöse, die wegen ihrer eigenen Problemstellung einer gesonderten Besprechung bedürften. Jeder Platte ist ein einführender Text beigegeben, der für Veranstaltungen in hinreichender Anzahl nachbestellt werden kann und sowohl sachlich als auch in der Diktion sorgfältig gestaltet ist. Außerdem findet man für den Gesprächsleiter eine Diskussionsgliederung, die ihn anregt, aber nicht festlegt.
Die Schallplatte "Der Betrieb - Deine Heimat?" bringt die Geschichte einer Arbeiterfamilie, deren Kind mit Hilfe der in materieller Hinsicht offenbar vorzüglichen Sozialpolitik des Betriebes einen Erholungsurlaub erhalten soll. Die Werksfürsorgerin erscheint, um die Bedürftigkeit zu prüfen. In der Werkssiedlung wird sich die "Bedürftigkeit" herumsprechen und zu allem möglichen Klatsch über das Haushaltsgebaren der Familie führen. Vor allem die Frau sieht dadurch ihre familiäre Privatheit gefährdet, und der Mann wendet sich in einer Diskussion innerhalb des Betriebes gegen weitere sozialfürsorgerische Vorhaben des Betriebes, so zum Beispiel gegen den Plan, ein Betriebskrankenhaus zu bauen. Er isoliert sich damit fast von allen anderen Mitarbeitern. Die Geschichte ist gut und überzeugend erzählt und widersteht mutig den Vereinfachungen, die bei einem solchen Thema auf der Hand liegen. Die unausgesprochene Hauptfrage lautet: Welchen Teil von der ganzen Existenz des Menschen darf der Betrieb als Arbeitgeber und als Sozialinstitution beanspruchen?
Nicht ganz so überzeugend ist die zweite Platte mit dem Thema "Es stand in der Zeitung". Es liegt wohl am Thema selbst, daß nicht alle seine wichtigen Dimensionen in ein Hörspiel von 25 Minuten verdichtet werden können. Ein Fern-Ost-Reporter ruft seine Nachrichtenagentur an. Im entscheidenden Moment wird die Verbindung unterbrochen, so daß der Agentur nicht eindeutig klar ist, ob die Nachricht Krieg bedeutet oder nicht. Soll sie nun selbst die Nachricht vervollständigen, weil ihr sonst vielleicht die Konkurrenz zuvorkommt? Dieselbe Frage taucht schließlich in einer Zeitungsredaktion auf, die die Nachricht bekommen hat. Soll sie noch warten, um eine Bestätigung zu erhalten, und darf sie der Konkurrenz die Chance geben, eher "am Drücker" zu sein? Während der Vorfall durchaus richtig dargestellt ist, ist leider der Einstieg, die Nachricht selbst, für den deutschen Leser verhältnismäßig bedeutungslos. Es wäre besser gewesen, einen Ausgangspunkt zu finden, bei dem es wirk-
47
lich "wichtig" ist, ob die Nachricht stimmt oder nicht.
Die Schallplatte "Mörder an den Galgen?" geht von einem Taxi-Fahrer-Mord aus. Wütende Menschen fordern aus diesem Anlaß die Todesstrafe. Ein Reporter, der einen Bericht schreiben soll, interviewt nun eine Reihe von Personen. Ihre Aussagen ergeben ein Panorama der wichtigsten Meinungen und Argumente zum Thema.
Die Platte "Ans Vaterland, ans teure..." hat es wieder sehr viel schwerer mit ihrem Thema. Das Hörspiel - ein Gespräch zwischen drei Fremdenlegionären und einer jungen Französin in Algerien - erreicht zwar gelegentlich literarische Höhepunkte, bleibt aber doch letztlich für den deutschen Hörer wegen der Ausnahmesituation unverbindlich. Offenbar fand der Autor keinen deutschen Ansatzpunkt für sein Thema. Warum griff er nicht auf die Situation der deutschen Teilung zurück? Das Problem der "halben Vaterländer" hätte sicher auch das des ganzen aufgeschlüsselt. An Stoff wäre wahrlich kein Mangel.
Einstiege haben die methodische Funktion, das Interesse aufzuschließen. Nur wenn sie überzeugend sind, kann das Interesse mit Informationen, Meinungen und Argumenten befrachtet werden. Die Platten sind nicht ausdrücklich für die Jugendarbeit gemacht, sondern wohl eher für die Erwachsenenbildung. Gerade deshalb fehlen ihnen glücklicherweise auch jene pädagogischen Zutaten, die meist denen unabdinglich erscheinen, die etwas "für die Jugend" oder gar ein "Unterrichtsmittel" produzieren wollen. Platten und Texte verraten eine katholische Einstellung zu den Themen, die aber unaufdringlich bleibt und sich immer selbst mit zur Diskussion stellt. - Selten findet man für die Jugendarbeit Hilfsmittel, die wie diese die Sachfragen ernst nehmen und doch praktikabel bleiben.
"Der Betrieb - Deine Heimat?" Ein Hörspiel von Heinz Theo Risse. DM 16,-
"Es stand in der Zeitung...". Ein Hörspiel von Heinz Theo Risse. DM 16,-
"Mörder an den Galgen?" Ein Hörspiel von Anselm Hertz OP. DM 16,-—
"Ans Vaterland, ans teure.. . - Patriotismus gestern und heute". Ein Hörspiel von Heinz Theo Risse. DM 16,-—
Die Schallplatten sind erschienen in der Reihe "Herders Bildungsabende", herausgegeben vom Verlag Herder und Christophorus-Verlag, Freiburg im Breisgau.48

28. Jugend und Gesellschaft (1964)
(In: Neue Politische Literatur, H. 7/1964, S. 479-506)Es ist wohl kein Zufall, wenn sich seit einigen Jahren das wissenschaftliche und schriftstellerische Interesse zunehmend der Frage nach dem Verhältnis von Jugend und Gesellschaft zuwendet. Die einschlägige Literatur der letzten zehn Jahre ist kaum noch zu überblicken. Unser Bericht kann daher weder den Anspruch auf Vollständigkeit noch auch nur auf repräsentative Auswahl dieses Schrifttums erheben; denn neben den Versuchen, das Phänomen Jugend in einem allgemeinen theoretischen Zusammenhang zu erfassen, stehen zahllose Einzelstudien zu speziellen Fragen und Teilbereichen. Es kann hier also nur darum gehen, an einigen Publikationen Tendenzen und Akzente der Forschung und der öffentlichen Diskussion darzulegen.
Ohne Zweifel ist die Frage nach dem Verhältnis von Jugend und Gesellschaft auch dann ein politisches Thema, wenn der politische Aspekt nicht ausdrücklich genannt ist. Wenn es einer Erwachsenengesellschaft nicht gelingt, die ihr wesentlichen kulturellen Normen und historischen Erfahrungen an die nachfolgende Generation zu übergeben, ist ihr Bestand mindestens ebenso gefährdet wie durch eine falsche Außenpolitik über lange Zeit. Das zunehmende Interesse an der Jugendforschung ist wohl nicht zuletzt einer solchen Sorge zu verdanken; denn mindestens macht der tägliche Augenschein die Selbstverständlichkeit der "Integration" der Jugend in die Gesellschaft fragwürdig.
Die neuere Jugendforschung enthält aber in einem noch viel unmittelbareren Sinne
479
ein politisches Moment. Sie löste nämlich die erste Phase der soziologischen Nachkriegsuntersuchungen ab. In den ersten Nachkriegsjahren ging es vor allem um die Frage, wie man autoritäre Tendenzen in den überlieferten und scheinbar durch die Niederlage erschütterten gesellschaftlichen Bereichen - vor allem in den Betrieben - erkennen und beseitigen könne. Das Motiv der gesellschaftlichen Demokratisierung stand im Vordergrund. Heute werden derartige Untersuchungen zwar noch weitergeführt, können aber nicht mehr mit einem besonderen öffentlichen Interesse rechnen. Die gesellschaftlichen Mächte scheinen unangreifbar etabliert und durch wissenschaftliche Theorien und Untersuchungen auf lange Sicht nicht änderbar.
Man hat viel zu wenig gesehen, daß Schelskys "Skeptische Generation" diesen Wandel genau markiert. Es war die erste von einer größeren Öffentlichkeit mit Bewußtsein aufgenommene soziologische Schrift, in der die "Vernünftigkeit" der tatsächlichen gesellschaftlichen Verhältnisse nicht mehr in Frage gestellt wurde, die sich vielmehr vor allem dafür interessierte, in welcher Weise die heranwachsende Generation in diese Gesellschaft eingefügt werden könnte, was sie von sich aus schon dafür tat und mit welchen Tendenzen man dabei rechnen konnte. Fünf Jahre zuvor hätte das Buch gar nicht diese Wirkung haben können, die es auf dem Höhepunkt der westdeutschen Restauration bekam. Nun, da Besitz und Macht neu verteilt waren, wurde vor allem interessant, ob und in welcher
480
Weise die heranwachsende Generation gewillt war, den status quo zu übernehmen. Die pädagogischen Einwände gegen Schelsky mußten so lange als rückständig erscheinen, wie sie sich nicht ausdrücklich in die gesellschaftspolitische Diskussion begaben. Mit einer gewissen Überspitzung darf man also sagen: Das Interesse an der Jugendforschung ist ein Signum für einen bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungsprozeß, den wir Restauration nennen können. Mit ihr beginnt überhaupt eine Phase der gesellschaftsunkritischen Sozialforschung.
Dieser Mangel haftet bis heute der Jugendforschung an. Er ist von nicht unbeträchtlichem Einfluß auf ihre Ergebnisse geblieben. Entweder herrscht die einseitige Spekulation auf "Anpassung" der jungen Generation an die gegenwärtige Gesellschaft vor; oder die Kritik zielt aufs Subjektive, auf Haltung oder Moral der beteiligten Erwachsenen und Jugendlichen; oder das Motiv der gesellschaftlichen Kritik, das sich nicht mehr realisieren zu können glaubt, wendet sich mit emphatischer Hoffnung an die nachwachsende Generation. Diese drei Tendenzen spielen in allen Jugenduntersuchungen und Jugenddeutungen der letzten Jahre eine unterschiedliche Rolle und könnten zu deren Interpretationsmaßstab werden.
I.
Die Frage nach dem Verhältnis von junger Generation und Gesellschaft ist für das gegenwärtige Bewußtsein zum ersten Mal in der Jugendbewegung mit allem Ernst gestellt worden (1). Deren politische Interpretation ist bis heute nicht zur Ruhe gekommen. Nach wie vor geht die Auseinandersetzung darum, ob die unbestreitbare Widerstandslosigkeit der Jugendbewegung gegenüber dem Nationalsozialismus konsequent in ihrem Selbst-481
verständnis angelegt war, ob sie nur eine Konsequenz politischer Naivität oder ob lediglich die Täuschung durch die Nazis ihre Ursache war. Diese Auseinandersetzung hat einen triftigen politischen Hintergrund; denn unser gegenwärtiges pädagogisches Selbstverständnis beruht in hohem Maße mit auf der Tradition der Jugendbewegung - personell vielleicht noch stärker als sachlich. Die gegenwärtig amtierende Schicht der Pädagogen und Kulturpolitiker stammt überwiegend aus den Reihen der Jugendbewegung und bestimmt von diesen Erfahrungen her weitgehend unser öffentliches Leben.
Die Kritik an der Jugendbewegung kommt also der Kritik an der Vergangenheit der heute in diesen Bereichen Machtausübenden gleich und ist daher durchaus mit den Auseinandersetzungen um die in den Nationalsozialismus verstrickten Politiker, Wirtschaftsführer und Juristen vergleichbar. Interessant dabei ist, daß die Jugendbewegung eine der ganz wenigen politischen und gesellschaftlichen Bewegungen vor 1933 ist, die nach dem Kriege sehr bald in die Auseinandersetzung um die Nazi-Vergangenheit einbezogen wurden, während andere Richtungen, wie die "konservative Revolution", eher eine Aufwertung erfuhren. Vielleicht liegt es daran, daß jene Gruppe weniger einflußreich ist als andere, vielleicht auch daran, daß sie zu denen gehörte, die sich mehr als andere einer öffentlichen Auseinandersetzung um die Fehler ihrer Vergangenheit stellten.
Einer der bedeutsamsten Beiträge dazu war die Schrift von Karl 0. Paetel (2) "Jugendbewegung und Politik", die jetzt in stark erweiterter Fassung unter einem neuen Titel vorliegt. P. gehörte zu jener Minderheit in der Jugendbewegung, die vor 1933 mit nationalrevolutionären Vorstellungen die bündische Jugend "bei Ab-
482
lehnung der Weimarer Formaldemokratie in eine revolutionäre Position gegen Versailles und das Braune Haus zu bringen trachtete" (S. 8) und deshalb 1933 emigrieren mußte. Im Mittelpunkt steht die Frage nach dem politischen Engagement der Jugendbewegung und nach den Gründen für ihre Widerstandslosigkeit gegenüber dem Nationalsozialismus. Es gelingt P. aber nicht, seine eigene politische Position von damals selbst genügend kritisch zu sehen.
Gab es denn überhaupt eine sinnvolle und realistische Möglichkeit, zugleich gegen den Nationalsozialismus und gegen die Weimarer "Formaldemokratie" (bei P. ohne Anführungsstriche!) zu sein? War diese Position hinsichtlich ihres politischen Realitätswertes einleuchtender als die der Freischarführer, die 1933 unaufgefordert der NSDAP beitraten, was P. ausführlich (S. 136 f.) zum Gegenstand persönlich moralischer Kritik macht? Haben nicht auch seine politischen Vorstellungen - wenigstens in der Rückschau - ihren Teil zur Wegbereitung Hitlers beigetragen? Waren die Illusionen derjenigen, die glaubten, "Hitler in die Zange nehmen zu können", größer als die derjenigen Konservativen, denen Hitler mehr aus ästhetischen denn aus politischen Gründen mißfiel?
Sieht man von solchen grundsätzlichen Einseitigkeiten ab, die einem politisch so engagierten Manne wie P. wohl erlaubt sein mögen, dann bleiben dennoch genügend scharfsinnige Beobachtungen und Deutungen übrig, die das Buch lesenswert machen. So spricht der Verf. klar aus, daß der Einbruch von Jugendbewegungsimpulsen in die Jugendpflege zur "Verinnerlichung" des politischen Bewußtseins in den großen Jugendverbänden, vor allem in den sozialistischen, geführt habe (S. 89 f.). Aber auch hier muß man sich wieder fragen, ob nicht gerade die Tatsache, daß die großen gesellschaftlichen Organisationen diese Impulse "in
483
Pflege nahmen", eine wesentliche Voraussetzung für deren unglückliche Politisierung war, weil sie einen Anspruch auslöste, den die ihren bürgerlichen und kleinbürgerlichen Vorstellungen und Formen verhaftete bündische Jugend einfach nicht erfüllen konnte. Daher bleibt ohnehin offen, ob die politische Deutung der Jugendbewegung, sofern es sich dabei um die Jugendlichen selbst handelt, eine angemessene Verfahrensweise ist.
Man kann von der bürgerlichen Jugend der Weimarer Zeit keine politische Rationalität erwarten, die die bürgerliche Gesellschaft im ganzen aufzubringen nicht in der Lage war. Bleibt die Verantwortung der erwachsenen Jugendführer übrig, mit denen P., gemessen an seiner eigenen politischen Vorstellungswelt, wohl etwas zu hart ins Gericht geht: "Jeder integre HJ-Führer, jeder ehrliche Mann der Waffen-SS hat Anspruch auf Achtung, sofern er sich keiner kriminellen Handlung schuldig gemacht hat - auch wo man meint, daß sie einer falschen Idee dienten; aber die deutschen Jugendführer, die 1933 der NSDAP versicherten, daß sie schon immer 'im Geiste in ihren Reihen mitmarschiert' seien, als sie z. B. die Wahl der Deutschen Staatspartei propagierten, haben, wenn vielleicht auch nicht bewußt, das Vertrauen der ihnen anvertrauten Jugend getäuscht" (S. 165). In diesem Satz, der in bedenklicher Weise die private Moral an die Stelle der rationalen Aufklärung der politischen Zusammenhänge stellt, die allein uns heute fruchten könnte, zeigt sich, daß P.s Buch letztlich ein Beitrag zum gebrochenen Selbstverständnis des politischen deutschen Konservatismus ist.
Der Verf. geht dann weiter auf die Versuche der Bündischen nach 1945 ein, zu einem auf Grund der veränderten Situation neu durchdachten politischen Selbstverständnis zu finden. Hier wird seine Kritik schon überzeugender, weil ihm nachzuweisen gelingt, daß die meisten
484
freideutschen "Jugendbewegungs-Veteranen" ihre romantischen politischen Vorstellungen zu korrigieren nicht in der Lage waren. Aber diesmal ging die politische Entwicklung über sie hinweg, und mit der Gründung des Deutschen Bundesjugendringes im Oktober 1949 begann, wie P. richtig sieht, eine völlig neue Phase der Jugendarbeit.
Die von Paetel vor allem kritisierte Gruppe der "Freideutschen" hat aus Anlaß der 50. Wiederkehr des freideutschen Jugendtages auf dem Hohen Meißner einen Sammelband mit 17 Beiträgen herausgebracht (3). Sie sollen "von den Aufgaben sprechen, die die Jugend damals vor sich sah, und von ihren Versuchen, auf den verschiedensten Gebieten ihres eigenen und des öffentlichen Lebens aus eigener Verantwortung und in innerer Wahrhaftigkeit zu wirken" (S. 6). Wer nun annähme, daß diese Rückblicke durch die politischen Erfahrungen und Diskussionen der letzten Jahre geprägt worden seien, sieht sich enttäuscht. Die meisten Autoren legen sich deutliche Zurückhaltung auf und beschränken sich auf Erinnerungen, "wie es damals war".
Aber kann man im Jahre 1963 über diese Bewegung noch genau so schreiben, wie man es vielleicht 1932 noch konnte? Lediglich der Beitrag von Walter Dirks ("Anfänge und Folgen katholischer Jugendbewegung") macht eine deutliche Ausnahme. Er stellt auf der einen Seite die Leistung der von Guardini geistig geführten Bewegung für die Änderung des kirchlichen Weltverständnisses heraus, wie sie sich in den gegenwärtigen Konzilsdebatten niederschlägt, betont andererseits aber auch den entscheidenden Mangel: "'Das Interesse' ist immer ein
485
Gegenspieler der Erneuerung gewesen; nicht nur in dem unproblematischen Sinn, daß ihr seine Härte und Blindheit widerstand, sondern leider auch in dem problematischen Sinn, daß die Kraft der Erneuerung nicht stark und real genug war, um die Interessen zu akzeptieren und in ihrer fairen Integration verantwortbar zu machen. Ein wenig ist die katholische Jugendbewegung, wie die ganze, in den falschen Alternativen von Ideal und Interesse, Geist und Macht, Gemeinschaft und Gesellschaft, Kultur und Zivilisation und wie sie immer heißen, steckengeblieben" (S. 250). Weder ist den fünf Beiträgen zur musischen Seite der Jugendbewegung anzumerken, daß es inzwischen eine ästhetische und politische Kritik der Adorno, Warner und Kamlah gegeben hat, noch entdeckt Helmut Croon ("Arbeitslager und Arbeitsdienst") die tiefe, noch heute grassierende politische Unehrlichkeit der "Volksgemeinschaft", die die Objektivität der Interessengegensätze ausschließlich für eine Angelegenheit der subjektiven sittlichen Haltung erklärt.
Problematisch ist auch die einzige politische Deutung von Willi Walter Puls: "Auf dem Wege zur Politik". P. kritisiert zwar den Traum von der Volksgemeinschaft (S. 150). Aber dann finden sich auch hier wieder die falschen Deutungen: Daß es dem Weimarer Staat nicht gelungen sei, die Mitarbeit der Jugend zu gewinnen (S. 151). Wie aber konnte ihm das gelingen, wenn die ihn tragende bürgerliche Gesellschaft das gar nicht wollte? Das Streben der Jugendbewegung nach einer neuen Gesellschafts- und Volksordnung sei von ernster - wenn auch nicht parteipolitischer - Bedeutung gewesen (S. 151). Was sich in jener Zeit außerhalb der politischen Parteien etablieren wollte, war eben nicht Politik, sondern Mythos! Die Jugendbewegung habe nur die freiwillige und aufkündbare Unterordnung unter einen Führer ge-
486
kannt und unterscheide sich damit wesentlich von dem nazistischen Führer-Gefolgschafts-Verhältnis (S. 153). Das ist eine richtige, aber bloß formale Differenz. Die wichtigere Frage ist, inwieweit inhaltlich die Beziehungen in den Gruppen autoritäre blieben, wie sie ja ansonsten auch in den privaten bürgerlichen Beziehungen vorherrschten.
In der Beurteilung der Jugendbewegung vermischen sich immer noch zwei deutlich zu unterscheidende Gesichtspunkte: Die historische Betrachtung hätte aus den Voraussetzungen und Gegebenheiten der Zeit heraus zu fragen und zu antworten. In sie darf man keine aus den Erfahrungen der Späteren gewonnenen Gesichtspunkte hineinprojizieren, schon gar nicht solche der nachträglichen Rechtfertigung der Überlebenden. Die andere Betrachtungsweise, die politische, soziologische und ideologiekritische, hätte nach dem objektiven Zusammenhang von Vorstellung und Situation, von Zielen und Verwirklichungsmöglichkeiten und nach totalitären Implikationen von Vorstellungen und Handlungsweisen zu fragen. Hier kann es primär nicht um Schuldsprüche, sondern um die rationale Aufklärung der Zusammenhänge gehen, von der allein wir Heutigen lernen könnten. Eine aus der Kombination beider Betrachtungsweisen gewonnene Darstellung des Problems "Jugend und Gesellschaft" für den Zeitraum der Jugendbewegung fehlt bisher immer noch.
II.
Die Deutung der jungen Generation nach 1945 vollzog und vollzieht sich auf drei Ebenen:a) Auf der Ebene der methodisch reflektierten wissenschaftlichen Darstellung, wobei fast immer begrenzt gewonnenes empirisches Material zu einer Theorie der Gesamtgestalt der Jugend ausgeweitet wird.
487
b) Auf der Ebene der publizistischen Darstellung, die keine eigene Methode entwickelt, wohl aber in unterschiedlichem Maße Ergebnisse der wissenschaftlichen Jugendforschung verwendet.
c) Auf der Ebene der pädagogischen Selbstdarstellung durch Lehrer und Erzieher, die sich genötigt sehen, ihre pädagogischen Maßnahmen in einen grundsätzlichen Zusammenhang von "Jugend und Gesellschaft" einzubetten.
In unserem Bericht geht es nicht um die Differenzierung des Begriffes "Jugend", wie sie den jeweiligen fachwissenschaftlichen Perspektiven entspricht. Pädagogische und psychologische Ergebnisse gehören nur dazu, insofern sie eben jenes Verhältnis von Jugend und Gesellschaft berühren. Die soziologische und vor allem politische Problematik des Themas steht im Vordergrund.
Auf der Ebene der methodisch reflektierten wissenschaftlichen Darstellung orientieren sich bis heute die Autoren an der Auseinandersetzung mit Schelskys These von der "Skeptischen Generation". Vor allem pädagogisch engagierte Wissenschaftler haben versucht, die Einseitigkeiten dieser These durch neue empirische Untersuchungen zu betonen. Die beiden hier anzuzeigenden Bücher werfen ein interessantes Licht auf die dabei entstehende methodische Problematik.
Hans Heinrich Muchows (4) nun schon in der 7. Auflage vorliegende Arbeit setzt die geisteswissenschaftliche Tradition der Jugenddeutung mit verfeinerten Aspekten fort. M. versucht, "die Gestalt der Jugend von heute" durch einen Vergleich mit der Jugend vor dem Ersten Weltkrieg zu beschreiben. Damit hofft er, die
488
wesentlichen Veränderungen in den Blick zu bekommen. Die methodische Schwierigkeit besteht nun vor allem darin, daß man die Gestalt der Vorkriegsjugend mit anderen Mitteln erschließen muß als die heutige: Aus den Zeugnissen der gerade einsetzenden Jugendpsychologie, aus Tagebüchern und anderen literarischen Quellen, sowie aus pädagogischen Äußerungen - aus lauter indirekten Quellen also. Abgesehen davon, daß diese Quellen nur Rückschlüsse auf die Gestalt der bürgerlichen und kaum der proletarischen Jugend erlauben, stellen sich weitere, vor allem sprachliche Schwierigkeiten ein: "Die epochal geprägte Sprache verhindert eine angemessene Erkenntnis der Wirklichkeit" (S. 23).
So ist etwa mit dem idealistischen Vokabular des "Jünglings" die reale Schwierigkeit des Reifwerdens nicht zu erfassen, und die Sexualtabus verhinderten lange Zeit eine wissenschaftliche Beschäftigung mit den Problemen der sexuellen Reifung. Vor allem aber wird deutlich, daß damals die unmittelbare Ursache für eine wissenschaftliche Beschäftigung mit der Jugend die Erfahrung war, daß die junge Generation nicht mehr selbstverständlich in die Erwachsenenwelt einzugliedern war. Dieser - wenn man so will politische - Ausgangspunkt ließ nach M.s Meinung die damalige "Avantgarde der Jugend" - die Wandervögel und die Expressionisten - weitgehend unberücksichtigt. Das dominierende Problem der Reifung war - wegen der gesellschaftlichen Sexualtabus - die explosive Kraft der sexuellen Reifung.
Dieser Ansatz des historischen Vergleichs bleibt auch dann unverzichtbar, wenn die historischen Methoden zur Beschreibung vergangener Epochen noch präzisiert werden müssen, weil sie in ihrer gegenwärtigen Form noch nicht ganz überzeugen können. Vor allem müßten wohl sozialgeschichtliche Hintergründe stärker berücksichtigt werden. M. hat aber prinzi-
489
piell klargemacht, daß jede Jugendforschung, die auf einen derartigen historischen Hintergrund verzichtet, damit auch auf einen wichtigen Bestandteil ihres kategorialen Apparates verzichtet. Viele Einseitigkeiten der gegenwärtigen Jugendforschung hängen sicher damit zusammen, daß die historische Perspektive fehlt.
Bei der Betrachtung der gegenwärtigen Jugend bleibt M. allerdings zu sehr im Bann seines historischen Modells, wenn er etwa auch heute der Sexualproblematik eine gewisse dominierende Bedeutung zuerkennt (S. 86 f.); oder wenn er fordert, die Erwachsenen sollten sich entschließen, die wesentlichen Rollen und Positionen des Erwachsenseins wieder zu besetzen (Vater, Mann, Erwachsener als Autorität) (S. 80). Schließlich ist der Mangel an Eindeutigkeit der Rollenbesetzung in der Pluralität der Rollenbesetzungen und -erwartungen notwendig angelegt. Hier wird vielleicht am deutlichsten, daß M. soziologische und vor allem sozialgeschichtliche Dimensionen des Problems zu wenig berücksichtigt.
Andererseits fällt es dem erfahrenen Pädagogen M. leicht, die Schwächen der Erhebungsmethoden in der Jugendforschung zu kritisieren. Jede Form der direkten Befragung hält er für unergiebig - ausgenommen nach Fakten - weil die Situation in die Antwort eingehe, die sprachlichen Unterschiede zwischen Jugendlichen und Erwachsenen zu groß seien und die Jugend überhaupt Selbstbekenntnisse vermeide (S. 83). "Von den üblichen Methoden der Jugendpsychologie bleibt also nur die planmäßige und systematische Dauerbeobachtung übrig" (S. 84), die M. für die Darstellung der Gegenwartsjugend zu Grunde legt. Aber auch hier schleichen sich sofort Ungenauigkeiten ein, weil M. zwar als Gymnasiallehrer einen sehr bewußten Kontakt zu Oberschülern hat, aber dazu neigt, die an ihnen gemachten Beobachtungen zu verallge-
490
meinern. Anders ist seine Betonung des Jazz als "Phänomen der Ent-Staltung" (S. 104 f.) nicht zu verstehen. In der Arbeiterjugend hat der kultivierte Jazz nie eine bedeutende Rolle gespielt. So bleibt festzuhalten, daß M. durch seine präzisen Beobachtungen zwar wichtige Einsichten gelingen, daß er aber andererseits nur einen Teilaspekt gewinnt, weil er zu sehr von "der" Gesellschaft und "der" Jugend ausgeht, anstatt die konkreten gesellschaftlichen und damit auch jugendsoziologischen Unterschiede zu berücksichtigen.
Einen anderen Weg ist Walter Jaide (5) gegangen. Er sucht die Aussagen der von ihm untersuchten Jugendlichen qualitativ in drei Typen mit je zwei Varianten auszuwerten: Die Naiven und die Konservativen; die Desinteressierten und die Distanzierten; die Suchenden und die Entschiedenen. Mit monographischer Methode wurden 373 Jugendliche der Geburtsjahrgänge 1941-1944 untersucht, wobei die Beobachtungen von Lehrern, Ausbildern und teilweise auch von Eltern zur Kontrolle mit berücksichtigt wurden. Als Leitstudie sollte die Untersuchung zunächst den Rahmen des mit dieser Methode Erforschbaren abtasten und weitere Untersuchungen anregen. Quantitative und repräsentative Auswertung war zunächst nicht angestrebt.
J. will auf diese Weise den "Stil der Auseinandersetzung zum typusbildenden Hauptkriterium" wählen (S. 23). Es geht also nicht primär um inhaltliche Zuordnungen der Aussagen zu den sechs Typen, sondern um die Art und Weise der Aneignung. Damit ist aber schon das Grundproblem dieser Methode bezeichnet. Man kann schließlich die Stile nur im Hinblick auf die Sache selbst beschreiben, die so
491
oder so angeeignet wird. Um zu ermitteln, ob etwa die Auseinandersetzung mit politischen Problemen "konservativ" geschieht oder "suchend", muß man z. B. wissen, in welcher Weise das Elternhaus die Aneignung politischer Probleme vornimmt. Im Hinblick auf den einzelnen Jugendlichen kann eine zunächst als "konservativ" anmutende Äußerung in Wahrheit "suchend" sein, dann nämlich, wenn er sich damit gegen ein sozialistisches oder liberales Elternhaus absetzt. Eine derartige Qualifizierung der Aussagen auf das einzelne Subjekt hin, also die von J. vorgeführte monographische Methode, muß die konkreten sozialen Hintergründe kennen, vor denen solche Aussagen sich entwickeln.
Bei genauer Betrachtung zeigt sich aber, daß J. gar nicht "Stile" qualifiziert, sondern die Inhalte der Aussagen. Das aber hätte - z. B. in dem Kapitel "Die Einstellung zu Politik und Zeitgeschehen" - zur Voraussetzung, daß inhaltlich klar entschieden wird, was nun eine "konservative" oder "distanzierte" Ansicht objektiv sei. Ebenso hätte man bei den anderen Kapiteln - z. B. "Das Verhältnis zu Religion und Kirche" - verfahren müssen. So aber vermischen sich die subjektive Ebene - die Art und Weise der Aneignung - und die objektive, inhaltliche Qualifizierung der Aussagen, ständig. Dennoch verdient das Bemühen, die Differenziertheit der jugendlichen Einstellungen empirisch zu objektivieren, prinzipielle Zustimmung. Da die Arbeit ausdrücklich als vorläufiger Bericht gedacht ist, darf man auf die endgültige Auswertung gespannt sein.
Machen die beiden letztgenannten Untersuchungen auf ihre Weise den entscheidenden Mangel fast aller jüngeren Jugenduntersuchungen deutlich, daß nämlich ohne hinreichend differenzierte Theorie von der gegenwärtigen Gesellschaft auch nicht sinnvoll nach der Jugend in ihr gefragt werden kann, so ist die Vor-
492
tragssammlung "Jugend in unserer Zeit" (6) frei von derlei methodischen Problemen. Vier Fachwissenschaftler - Adalbert Loeschke (Medizin), Rudolf Bergius (Psychologie), Ernst Heinitz (Kriminologie), Dietrich Goldschmidt (Soziologie) - und zwei Pädagogen - Martin Faltermaier und Fritz Borinski - legen dar, wie sich Jugend in ihren Wissenschafts- bzw. Erfahrungsbereichen offenbart. Diese im Vergleich zu den großangelegten empirischen Untersuchungen sich recht bescheiden ausnehmende Veröffentlichung enthält in Wahrheit eine Fülle von Fakten, Einsichten und Gesichtspunkten. Obwohl die Aspekte der fachwissenschaftlichen Beiträge - bedingt durch die Vortragsform - gelegentlich etwas zufällig anmuten und gewiß wegen des beschränkten Umfangs auch nicht vollständig sein können, stellt sich doch die Überlegung ein, ob nicht alle jene Jugenduntersuchungen, die immer die Gesamtheit des Phänomens Jugend in den Blick nehmen wollen, von vornherein zum Scheitern verurteilt sind, weil sie damit notwendig den jeweiligen fachwissenschaftlichen Aspekt und die ihm zugehörige Methodik überschreiten und damit etwas erreichen wollen, was nur Aufgabe einer die verschiedenen Ergebnisse überhöhenden und zugleich integrierenden Theorie sein kann - einer Theorie, die sich grundsätzlich nicht völlig in fachwissenschaftliche Perspektiven auflösen läßt.
III.
Die Ebene der publizistischen Darstellung hat nicht die Aufgabe, eigenständige wissenschaftliche Leistungen nachzuweisen. Ihr geht es darum, vorliegende wissenschaftliche Ergebnisse in einer Form zu verbreiten, die sie möglichst vielen Menschen verständlich macht. Vielleicht ist493
diese Ebene für die kritische Rezension noch wichtiger als die doch meist nur einen bestimmten Fachkreis interessierenden wissenschaftlichen Untersuchungen; denn das Verhältnis von Jugend und Gesellschaft ist zu einem guten Teil ja auch das, was in der nichtfachlichen Öffentlichkeit darüber gedacht und als politische und pädagogische Handlungsmaxime angenommen wird.
Die unter diesem Aspekt zu besprechenden drei Veröffentlichungen haben nun eine überraschende Gemeinsamkeit: Sie gehen - mehr oder weniger bewußt - davon aus, daß die gegenwärtige Gesellschaft gleichsam jugendfeindlich sei, daß die Integration der Jugend in sie keineswegs gewährleistet sei, ja, daß in der Gegenüberstellung von Jugend und Gesellschaft alles Licht auf die Jugend und aller Schatten auf die Gesellschaft falle. Es handelt sich also um Schriften, die gegen die bestehende Gesellschaft agitieren, indem sie für die junge Generation optieren - ein Verfahren, das spätestens seit den Tagen der Jugendbewegung bekannt ist.
Heraus ragt das Buch von Konrad Pfaff (7). Der Verf., seit Jahren in der Jugend- und Erwachsenenbildung tätig, schreibt brillant - obwohl er gelegentlich zu sehr in seine Formulierungen verliebt ist - und verfügt über eine breite philosophische und soziologische Kenntnis, die er allerdings manchmal auch etwas zu mutwillig zur Stützung seiner Thesen einsetzt. Für ihn ist das Problem der Jugend das Problem der modernen Gesellschaft selbst, die er nicht nur auf ihre zerstörenden, sondern auch auf ihre aufbauenden Chancen hin abtastet. Der Aufklärung und der Mündigkeit des rationalen Lebens und Erlebens verpflichtet, unterschätzt er nicht die Bedeutung der emotionalen Kräfte. Überall wird die Frage nach den
494
Zielen und Auf gaben der Erziehung gestellt, werden problematische jugendliche Verhaltensweisen mit Blick auf den gesellschaftlichen Hintergrund erklärt. "Der Jugendliche lernt gut zu funktionieren mit einem Minimum an Verantwortung und merkt auch, wie man merkwürdig auffällt, wenn man einen besonderen Verantwortungswillen zeigt. Die ,Ohne-mich-Haltung' ist die natürlichste soziologisch notwendige Haltung des jungen arbeitenden Menschen" (S. 178). "Was sie in der Arbeitswelt und zu Hause nicht durften und nicht lernten zu planen, nämlich zu verantworten, etwas zu leisten und dafür Anerkennung zu finden, das suchen sie - wie getrieben - nach der Arbeitszeit" (S. 187).
Es ist in diesem Rahmen nicht möglich, sich im Detail mit P.s Thesen einzulassen. Eine solche Kritik aber könnte den imponierenden Versuch im ganzen nicht angreifen, im Vertrauen auf die Kraft des synthetischen Denkens ein Bild der gegenwärtigen Jugend zu entwerfen, das unter der Hand zu einer ernstzunehmenden pädagogischen Theorie der modernen Jugend wurde, die nicht nur deren So-Sein konstatieren will, sondern auch nach deren gesellschaftlichen Chancen fragt.
Ein völliger Gegensatz dazu ist die Arbeit von Joseph Bader (8). Sieht Pfaff die "Dialektik der Aufklärung" in den modernen Entwicklungen, so sucht B. das angebliche gesunde Empfinden der gegenwärtigen Jugend gegen die Moderne auszuspielen Unterzieht Pfaff die tradierten Werte einer kritischen Revision, so will sie B. wieder einfach installieren. Sieht Pfaff "gesellschaftliche Verhältnisse", so erscheinen B. die Übel in der - bloß pädagogisch änderbaren - Mentalität der Beteiligten zu liegen. Ein Kuriosum ist sein Fragebogen. Er ist an-
495
geblich 11000 Schülern in den Jahren 1959 bis 1961 vorgelegt worden. "Das Ziel aller Fragen war dabei allein dieses: Einblick in die Wertvorstellungen zu bekommen, die die Verhaltensweisen der Jugend von 1960 bestimmen ... " (S. 322). B. traut dem Verfahren wohl selbst nicht ganz, denn er erörtert seinen Fragebogen erst im letzten Kapitel. Statt methodologisch zu erklären, wie er mit Hilfe seiner merkwürdigen Fragen an die jugendlichen Wertvorstellungen herankommen will, erklärt er bündig: "Dem Fragebogen liegt also ein praktisches Denkmodell aus gesammelten Erfahrungen zugrunde" (S. 323). Woher diese Erfahrungen stammen, bleibt ebenfalls unklar.
Indirekt muß man erschließen, daß der Ausgangspunkt des Buches der ist, der seit 1933 "enttäuschten" Kriegsgeneration nachträgliche Rechtfertigung zuteil werden zu lassen, indem man deren Wertvorstellungen als auch für die heutige Zeit unentbehrlich erklärt. Nun ist das an sich ja ein völlig legitimes Anliegen. Aber die intellektuelle Leichtfertigkeit - anders kann man es wahrlich nicht nennen - , mit der mit jenem Fragebogen operiert wird, überträgt sich auf das ganze Buch. Gewiß enthält es auch lesenswerte Stellen, wie jedem Autor Einsichten gelingen, die sich vor allem seinem Engagement erschließen. Aber sie entstammen entweder Zitaten, deren Autoren man dann lieber im Original liest, oder sie liegen so versteckt, daß die Mühe zu groß ist, sie aus dem Wust von Vorurteilen, Ressentiments und halben Wahrheiten herauszupicken.
Das Verdienst des Buches von Richard Kaufmann (9) ist, eine Fülle von Informationen und Forschungsergebnissen zum Thema "Jugend" zusammengetragen zu haben, die sonst schwerlich in einem
496
Zusammenhang greifbar sind. Dabei berücksichtigt der Verf. auch medizinische, architektonische und wohnbaupolitische Gesichtspunkte, die sonst gegen die Übermacht soziologischer und psychologischer Aspekte zu kurz zu kommen pflegen. In seinem Bemühen aber, den Erwachsenen hinsichtlich ihrer Erziehungsversäumnisse ins Gewissen zu reden, löst er vollends die gesellschaftlichen Verhältnisse in die bloß private Moral der Erwachsenen auf. Anstatt an Hand seines sorgsam zusammengetragenen Materials auf den unlösbaren Zusammenhang von erzieherischer Einzelverantwortung und politischer Korrektur gesellschaftlicher Bedingungen hinzuweisen, legt er alles den Menschen zur Last, was an den Verhältnissen liegt.
Dabei bleibt es nicht aus, daß sich gelegentlich geradezu kleinbürgerliche Vorstellungen einschleichen. Die Familie gilt als eigentlicher Erziehungsraum (S.59ff.), außerfamiliäre Bereiche erscheinen als bloße Störung der familiären Erziehungsaufgabe (S. 127 ff.). Der V. Teil ist "Die betont feindliche Gesellschaft" überschrieben. Aber auch hier geht es nicht um Analyse gesellschaftlicher Bedingungen, sondern die Fehler erscheinen als zu große Milde des Richters gegenüber dem Triebverbrecher (S.294f.), oder K. optiert im letzten Kapitel ("Unwirkliche Wirklichkeit: Der mißbrauchte Artikel 5") für eine gesetzliche Restriktion weiter Teile der Konsum- und Vergnügungsindustrie. Wenn man sich klar macht, daß solche Bücher für ein Publikum geschrieben werden, das solche kritischen Prüfungen im allgemeinen nicht anstellen kann und will, dann kann man nicht genügend betonen, daß man Eltern und Erziehern nicht ständig eine Verantwortung einreden darf, die sie objektiv gar nicht erfüllen können. Anstatt sie über den Zusammenhang der Dinge aufzuklären und damit auch allmählich ein öffentliches Verständnis der sehr unsenti-
497
mentalen Lösungsmöglichkeiten zu verbreiten, tragen solche Veröffentlichungen nur dazu bei, die Menschen in ihrer unproduktiven Vorstellung zu bestärken, die Gesellschaft sei zusammengehalten von gutem und weniger gutem Willen. Schade, daß diese im Material so solide Arbeit daran gescheitert ist.
IV.
Die Fähigkeit, praktische Probleme der Erziehung und Unterrichtung auf einen vorgegebenen gesellschaftlichen Problemzusammenhang zu objektivieren und damit auch wieder neu zu sehen, ist unseren Pädagogen - etwa im Gegensatz zu Pestalozzi - weithin verloren gegangen. Entsprechend der geistesgeschichtlichen Tradition der deutschen Pädagogik, der gesellschaftliche und soziale Verhältnisse vergleichsweise unwichtig erschienen, werden gesellschaftliche Objektivierungen, wo sie unumgänglich erscheinen. leicht zur aufgestockten ideologischen Abrundung, die nur der Vollständigkeit halber angefügt wird, von der man aber letztlich keine produktive Rückwirkung auf das pädagogische Ausgangsproblem erwartet. Der vor allem durch Schelsky ausgelöste "Eingriff" in pädagogische Fragestellungen ist nicht zuletzt deshalb mit solcher Leidenschaft bekämpft worden. Es ist also nicht überflüssig, pädagogische Literatur in dieser Weise zu befragen; denn man darf annehmen, daß sich in ihr ein weitverbreitetes gesellschaftliches Bewußtsein ausspricht.Aus den Erfahrungen eines spezifischen Bereichs der außerschulischen Jugendarbeit, der Jugenddorfarbeit, stammt der Titel "Die junge Gesellschaft", mit dem Erich Knirck (10) sein Buch überschrieben hat. Sein unbestreitbarer Wert liegt in den zum Teil interessanten Beschrei-
498
bungen der pädagogischen Maßnahmen und Experimente sowie der jugendlichen Reaktionen darauf. Aber anstatt es dabei zu belassen, greift der Verf. zu einem Wust von gesellschaftlichen und ideologischen Klischees. Da wird auf höchster Ebene in ein paar Sätzen über das Sein des Menschen im allgemeinen und des Jugendlichen im besonderen geredet. Die Quintessenz des Buches ist, daß alle wesentlichen Jugendprobleme gelöst werden können, wenn es nur den geeigneten Pädagogen gibt. Wie sehr anstelle des sorgfältigen Durchdenkens eine Reihe vordergründiger Postulate gesetzt werden, mögen folgende Beispiele verdeutlichen.
Das Bemühen vieler Jugendlicher, einen Beruf von den späteren Chancen der Pensionierung her zu sehen, wird ziemlich pauschal als "Degenerationserscheinung" und als Hang zum "Kollektiv" abgetan (S. 24). "Der Gedanke des Dienens als Fundament der Gesellschaft" lautet eine Überschrift, die den Grad gesellschaftlicher Einsicht treffend markiert (S. 27). Etwas später heißt es: "Der Gedanke des Dienens sollte daher auch einen Vorrang erhalten vor der Frage des Verdienens, auch wenn man dieser die Berechtigung in keiner Weise absprechen will. Ebenso muß der Gedanke des Dienens auch gelöst werden von jenen anderen Vorurteilen, als ob damit eine Gesellschaftsordnung aufgestellt würde, die die Welt einteilt in Herren und Knechte. Tief verwurzelt ist die Auffassung, daß nur der Geringere dem Höheren dient, obwohl der christlich verstandene Dienst im umgekehrten Sinn Dienst des Höheren an den Geringeren ist" (S. 27). Als ob es nicht genau auf die Konkretion ankäme, wem warum und in welcher Weise zu dienen sei! Konsequent wird dann auch für eine naive Sozialpartnerschaft optiert: "Man wird daher beispielsweise mit der Forderung nach Neuverteilung der Produktionsgüter unter der
499
Jugend keine große Anhängerschaft gewinnen können. Der junge Mensch will sich nicht Gruppen anschließen, die sich im Gegensatz der Meinungen festgefahren haben. Er hat schon die Erfahrung gemacht, daß man über solche Meinungsgegensätze hinweg zur Zusammenarbeit gelangen kann, wenn man einen Ausgleich sucht. Der ganze wirtschaftliche Wiederaufbau nach dem Kriege kann für ihn zu einem Beweis werden, wie man aus echtem partnerschaftlichen Denken und Handeln heraus sich eine neue Existenz aufbauen kann. Der junge Mensch ist daher bereit, einen neuen Anfang von Mensch zu Mensch zu machen. Er sucht die Partnerschaft als Arbeiter mit dem Angestellten, als Kaufmann mit dem Techniker und als Mensch mit dem Vorgesetzten im engeren Bereich ebenso wie mit dem Leiter des Unternehmens" (S. 32).
Man muß solche Sätze in Ruhe lesen, um sich klar zu machen, was für eine Pädagogik daraus folgt! Als ob der Einzelne sich in völliger Beliebigkeit der einen oder anderen oder gar keiner gesellschaftlichen Gruppe anschließen könnte und als ob es nicht genau darum ginge, im abstrakten Geflecht gesellschaftlicher Verhältnisse seine Interessenvertretung zu identifizieren. Die pauschalen Urteile über das Verhältnis der Jugendlichen zur Politik sind hier natürlich schon angelegt: "Der junge Mensch von heute wird sich nur schwer dazu bereitfinden, in einer parteigebundenen Jugendgruppe mitzuwirken, da er sein junges Leben nicht mit der Hypothek der Ressentiments der Erwachsenen belasten will" (S. 34). Und natürlich muß und kann man Politik nur in der unmittelbaren Gemeinsamkeit der Jugendlichen lernen.Lassen wir es damit genug sein und fragen wir höchstens noch, woher die Sucht kommt, die Beschreibung pädagogischer Probleme und Aktionen - die das Buch in der Tat lesenswert macht - mit solch kompletter Weltanschauung auszustatten.
500
Dies hängt sicher auch damit zusammen, daß man im Bereich der freien Jugendarbeit zunehmend gezwungen wird, neben der Offenlegung des Haushaltes auch im "Verwendungszweck-Deutsch'' ideologische Klischees mitzuliefern, die im Gegensatz zu differenzierten pädagogischen Beschreibungen von den Geldgebern auch "verstanden" werden können.Hans Zulliger (11), ein Lehrer und bekannter Kinderpsychologe, befaßt sich unter Verwendung höchst instruktiver eigener Erfahrungen mit der Tatsache der Gruppenbildung von Kindern in Schulklassen. Die "Gemeinschaft" erscheint ihm im Gegensatz zur "Horde" oder "Bande" als Höchstform der hier möglichen Vergesellschaftung. Unter Popularisierung tiefenpsychologischer Erkenntnisse sieht er sie in der - auch affektiven - Bindung der Schulklasse an den Lehrer gewährleistet, der möglichst die "Führerrolle" übernehmen müsse.
Die Erfahrungen Z.s stammen aus Schweizer Schulverhältnissen. Das mag seine Grundeinstellung verständlich machen; denn "Gesellschaft" und "Werte" sind für ihn undiskutiert glaubwürdig. Erzieher und auch Lehrer haben daher die Aufgabe, solche Werte völlig eindeutig zu repräsentieren und mit Hilfe tiefenpsychologischer Kenntnisse - die hier zur bloßen Erziehungstechnik geworden sind - durchzusetzen. Ängste und Drohungen werden nicht etwa "aufgeklärt", sondern verbleiben im Repertoire gesellschaftlichen Zwanges. Nirgends ist mir bisher ein solch eindeutiges Plädoyer für eine autoritäre Beziehung zwischen Erzieher und Zögling begegnet, die ja nicht dadurch weniger autoritär wird, daß die Kinder sich damit identifizieren, was Z. "echte Autorität" nennt (S. 199). Das geht soweit, daß Z. seine Kinder da-
501
zu bringt, ihm tatsächliche und eingebildete Vergehen zu "beichten".
Für eine moderne, pluralistische Gesellschaft und ihre Erziehung ist dieses Buch völlig unbrauchbar. Nicht eine einsinnige, gar autoritäre Bindung zwischen Lehrer und Schüler ist gefragt, sondern der Entwurf sehr differenzierter Sozialbeziehungen, wie sie im Leben abverlangt werden. Anstatt auf die Aufrechterhaltung libidinöser, geradezu magischer Bindungen an die - als Stellvertreter der Gesellschaft gedachte - Persönlichkeit des Lehrers zu pochen, kommt es auf deren Aufklärung an. Und das Problem der Autorität in der Erziehung muß auf einer ganz anderen Ebene als der der "besseren oder schlechteren" Lehrerpersönlichkeit diskutiert werden. Jene, die ohnehin den Verdacht haben, durch die gegenwärtige Betonung der "Erziehung zur Gemeinschaft" solle nur soziale Kontrolle, und unter Vorspiegelung einer "heilen" Welt unkritische Identifikation mit längst untergrabenen Autoritäten erreicht werden, werden sich durch ein solches Buch bestätigt wissen. Es zeigt, wohin eine pädagogische Reflexion geraten kann, die wie hier gesellschaftliche Wandlungen nicht sehr präzise in den Blick nimmt.
V.
Zum Schluß müssen wir noch auf eine Schrift von Andreas Flitner (12) hinweisen, die wieder zum Problem der wissenschaftlichen Jugendforschung zurückführt. Die Schlagzeile auf dem Deckblatt: "Die Auseinandersetzung mit der 'skeptischen Generation"' ist ein wenig irreführend, denn selbstverständlich ist diese Auseinandersetzung in allen Einzelheiten längst geführt worden. Es geht F. auch502
weniger darum, sie noch einmal zusammenzutragen, als vielmehr darum, sie im Hinblick auf das Verhältnis von Soziologie und Pädagogik zu systematisieren.
Dazu gibt er einen kurzen Überblick über die Geschichte der Jugenduntersuchungen sowie über die wichtigsten Arbeiten nach 1945, wobei die Auseinandersetzung mit Schelskys Buch natürlich eine gewichtige Rolle spielt. Unter sechs Gesichtspunkten (Die soziologische Definition von "Jugend"; Das Problem der Generationsgestalt; Das Verhältnis zur Elterngeneration; Die Einstellung zum Beruf; Akademische Jugend; Straffällige Jugend) werden die bisherigen Ergebnisse noch einmal systematisch überprüft. Im Schlußteil, "Pädagogik und Sozialforschung", tritt F. für eine Zusammenarbeit zwischen Pädagogik und Soziologie ein. Drei grundlegende Gesichtspunkte werde die künftige Jugendforschung zu beachten haben: Erstens müsse sie die Inkongruenz von Verbalaussage und Wirklichkeit beachten; zweitens dürfe die Erziehungslehre sich nicht allein auf jene Sozialbefunde verlassen, die ihr selber in den Blick kommen, und drittens könne künftig keine Jugendforschung mehr unter Verzicht auf die Untersuchung der Erziehungssituationen und Erziehungsfelder auskommen (S. 131 f.). Gegen manche soziologische Autoren verteidigt F. mit pädagogischen wie soziologischen Argumenten den "freien Jugendraum" und die allein in ihm mögliche Jugendbildung. Im ganzen gesehen ist F.s Arbeit von der Absicht getragen, soziologische Befunde für die Pädagogik so ernst wie möglich zu nehmen, gleichzeitig aber auch vor allzu naiven pädagogischen Folgerungen aus soziologischen Befunden zu warnen. "Jugend" ist für ihn ein viel zu komplexes Phänomen, als daß es aus den Perspektiven einer einzelnen Wissenschaft hinreichend zu beschreiben wäre.
So sehr diese Schrift wegen ihrer Sorgsamkeit in der Problementfaltung sowie vor allem wegen ihrer in der Sache ent-
503
schiedenen, gleichwohl persönlich verbindlichen Streitlust imponiert, so hinterläßt sie dennoch eine Reihe von Fragen:
1. Wenn das Phänomen Jugend sich nicht in die soziologische Betrachtungsweise auflösen läßt, wer ist dann berechtigt und methodisch in der Lage, eine pädagogisch brauchbare Theorie der Jugend als Synthese fachwissenschaftlicher Einzelperspektiven herzustellen? Schelskys "Skeptische Generation" war ja nicht nur ein soziologisches Buch, das einer Grenzüberschreitung in andere Bereiche geziehen werden muß, sondern vor allem eine zwar auf soziologischen Befunden basierende, aber sie bewußt übersteigende Theorie der Jugend. Theorien aber haben immer an sich, daß sie durch neue empirische Befunde korrigiert werden müssen. Insofern ist der Nachweis der Korrekturbedürftigkeit prinzipiell kein Einwand gegen eine Theorie. Seit Schelsky gibt es keine Theorie der Jugend mehr, sondern nur noch Einzeluntersuchungen, die dessen Thesen zu demontieren trachten. Sollte sich aber die Kritik in dieser Weise weiterhin atomisieren, so wäre das auch ein Rückschritt. Wie ist also das Verhältnis von Einzelforschung der einzelnen Disziplinen und der umgreifenden Theorie, und wer kann und soll letztere entwickeln?
2. Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Erziehungswissenschaft, in deren Namen ja F. vor allem kritisiert? Über sie sagt er recht wenig. Aus der Tatsache, daß er Schelskys Vorschlag - Soziologie und andere Fachwissenschaften liefern die Tatsachen, Pädagogik habe diese umzusetzen und anzuwenden - ablehnt (S. 128), läßt sich schließen, daß er der Pädagogik die Aufgabe der umfassenden Theoriebildung nicht übertragen will. Im übrigen wäre Schelskys Vorschlag einer Überlegung wert. F.s Einwand, es gäbe keine Tatsachen außerhalb der Kategorien, mit denen sie festgestellt würden,
504
ist zunächst eine Angelegenheit der methodischen Reflexion jener Fachwissenschaften, nicht der Pädagogik. Wie also ist dann der spezifische erziehungswissenschaftliche Aspekt des Phänomens "Jugend" zu bestimmen? Verfügt Pädagogik über Methoden einer eigenen Empirie, oder kann sie anderen empirischen Wissenschaften lediglich Fragen zur Verfügung stellen? Da aber pädagogische Fragen nicht mit soziologischen Methoden zu beantworten sind, wogegen F. sich ja ständig wehrt, welchen Wert haben sie dann für die pädagogische Betrachtung? Im letzten Teil des Buches entsteht der Eindruck, als ob das alles eine Frage der mehr oder weniger vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen sei. Aber methodisch strenge Empirik ist eben heute nur mit einer ungemein begrenzten Relation von Methode und Ergebnis zu machen.
3. Damit entsteht die grundsätzliche Frage nach der Reichweite empirischer Verfahren in der Jugendforschung überhaupt. F. hat sich - vor allem in der Kritik der Meinungsforschung - ausführlich damit befaßt. (Sie gilt aber auch für zahlreiche neuere Arbeiten, wo das pädagogische Engagement die methodische Zuverlässigkeit überspielt und das "Ma-
505
terial" überwiegend zur Rechtfertigung vorgefaßter Meinungen dient). Die Unterscheidung zwischen dem, was überhaupt nur einer empirischen Forschung zugänglich ist, und dem, was man durch die reflektierte Beobachtung des Pädagogen mindestens genau so gut ermitteln kann, und schließlich dem, was weder durch das eine noch durch das andere, sondern nur durch die Überzeugungskraft des theoretischen Denkens "auf den Begriff" gebracht werden kann, ist unumgänglich notwendig.
4. Jede Theorie muß aus der Fülle der bekannten Fakten auswählen, gleichsam einige für wichtiger erklären als andere. Sonst könnte sie nie eine Struktur bekommen, bliebe sie gleichsam eindimensional. Man kann also gegen Schelskys Buch nicht damit argumentieren, daß man nachweist, die Fakten seien viel komplizierter und differenzierter. Man muß dann schon andere Auswahlkriterien nennen und sie in anderer Weise zur Theorie verdichten. Sonst wird sich die künftige Jugendforschung in empirische Handwerkelei auflösen, die weder der gesellschaftlichen noch der pädagogischen Praxis nutzen kann. In diesem Sinne ist die Diskussion um Schelskys Buch nicht zu Ende, sondern sie beginnt erst richtig.
506
Anmerkungen:
(1) Vgl. NPL, VIII/1963, Sp. 326 ff., IX/1964, Sp. 257 ff.
(2) Karl O. Paetel: Jugend in der Entscheidung 1913 - 1933 - 1945. 308 S., Voggenreiter Verlag, Bad Godesberg 1963; vgl. NEUE POLITISCHE LITERATUR, VIII/1963, Sp. 328 f.
(3) Die Jugendbewegung. Welt und Wirkung. Zur 50. Wiederkehr des freideutschen Jugendtages auf dem Hohen Meißner, i. Auftr. d. Hauptausschusses zur Vorbereitung des Meißnertages 1963, hrsg. v. Elisabeth Korn, Otto Suppert u. Karl Vogt. 254 S., Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf/Köln 1963; vgl. NEUE POLITISCHE LITERATUR, IX/1964, Sp. 260 f.
(4) Hans Heinrich Muchow: Sexualreife und Sozialstruktur der Jugend. = rowohlts deutsche enzyklopädie, Bd. 94, 7. Aufl. 164 S., Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbeck b. Hamburg 1963; vgl. NEUE POLITISCHE LITERATUR, V/1960, Sp. 921 ff. - Muchow hat den historischen Part in einem weiteren Band erweitert: Jugend und Zeitgeist. Morphologie der Kulturpubertät. Reinbeck b. Hamburg 1962.
(5) Walter Jaide: Eine neue Generation? Eine Untersuchung über Werthaltungen und Leitbilder der Jugendlichen, hrsg. vom Deutschen Jugendinstitut, 2. Aufl. 190 S., Juventa-Verlag, München 1963.
(6) Jugend in unserer Zeit. Eine Vortragsfolge der Freien Universität Berlin. 148 S., Juventa Verlag, München 1961.
(7) Konrad Pfaff: Die Welt der neuen Jugend. 278 S., Walter Verlag, Olten - Freiburg i. Br. 1962.
(8) Joseph Bader: Jugend in der Industriekultur. Ihre Verhaltensweisen zwischen Ideologie und Apparatur 1910, 1933, 1960. 557 S., Manz-Verlag, München 1962.
(9) Richard Kaufmann: Gebrannte Kinder. Die Jugend in der Nachkriegszeit. 377 S., Econ-Verlag, Düsseldorf 1961.
(10) Erich Knirck: Die junge Gesellschaft. 2. erw. Auflage. 151 S., Walter Rau Verlag, Düsseldorf 1960.
(11) Hans Zulliger: Horde - Bande - Gemeinschaft. Eine sozialpsychologisch-pädagogische Untersuchung. 202 S., Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1961.
(12) Andreas Flitner: Soziologische Jugendforschung. Darstellung und Kritik aus pädagogischer Sicht. = Anthropologie und Erziehung Bd. 7., 163 S., Verlag Quelle und Meyer Heidelberg 1963

29. Freizeitpädagogik (1964)
(In: deutsche jugend, H. 8/1964, S. 379-381)Nachdem bisher über das Problem der Freizeit vor allem von soziologischer Seite geschrieben wurde, ist man gespannt auf das erste umfassende und systematische Buch zu diesem Thema, das aus der Hand eines Pädagogen kommt. Erich Weber hat unter dem Titel "Das Freizeitproblem" eine "anthropologisch-pädagogische Untersuchung" dieses Themenkreises veröffentlicht. Obwohl zahlreiche Menschen Freizeitpädagogik betreiben müssen, gibt es bisher keine brauchbare pädagogische Freizeittheorie. Eine solche Theorie müßte vor allem klären, aus welchen historischen Situationen die heute herrschenden Vorstellungen über Freizeit und Freizeitgestaltung stammen, was sie in diesen Situationen leisteten und inwiefern sie heute noch gültig sein können. Außerdem fehlt uns eine kritische Zusammenfassung dessen, was die bisherige Freizeitforschung - unter pädagogischen Kategorien betrachtet - an gesicherten Erkenntnissen gebracht hat. Schließlich geht es um die Lösung der Frage, in welch besonderer Weise sich die Aufgaben der Freizeitpädagogik von denen anderer Bereiche (etwa der Berufspädagogik) unterscheiden und wie sie dennoch in den Zusammenhang der allgemeinen Bildung und Erziehung eingebettet bleiben. An diesen Forderungen gemessen enttäuscht diese jetzt veröffentlichte Münchner Habilitationsschrift. Zwar zeigt schon das Literaturverzeichnis - es enthält 538 Titel - , daß der Verfasser erhebliches Material zusammengetragen hat, und ohne Zweifel wurde hier die pädagogische Diskussion entschieden weiter getrieben. Dies im einzelnen zu belegen, würde hier mehrerer Seiten bedürfen. Einige grundsätzliche Einwände scheinen mir aber in einer Rezension wichtiger zu sein, zumal sie typische Unarten des gegenwärtigen pädagogischen Schrifttums betreffen:
1. Auffallend ist die mangelnde Systematik. Das Buch besteht aus drei Teilen: Das Freizeitleben der Gegenwart und seine Problematik; Anthropologische Betrachtung der Freizeit; Pädagogische Betrachtung der Freizeit. Diese drei Ebenen werden nirgends recht zu einem Gesamtbild zusammengeholt. Das liegt zum Beispiel daran, daß im ersten Teil die empirischen Ergebnisse der bisherigen Freizeitforschung merkwürdig positivistisch zusammengetragen werden. Sie bekommen aber keine Kontur, weil sie nicht mit pädagogischen oder sonstigen Kategorien befragt werden. Die Absicht ist offenbar, auf diese Weise das Feld zu beschreiben, in dem sich überhaupt Freizeit ereignet. Aber da die Wirklichkeit nie etwas verrät, ohne daß sie von einem bestimmten Bewußtsein danach befragt würde, ist es in diesem Falle auch gar nicht möglich, die vorgefundenen, bloß additiv ermittelten Ergebnisse nachher in die anderen Zusammenhänge einzubauen. Hier rächt sich der Verzicht auf die historische Perspektive, die solche Leitfragen an das empirische Material wesentlich erleichtert hätte.
379
Die Folge dieses Mangels ist, daß sich der Leser durch eine Vielzahl - an sich zum Teil höchst aufschlußreicher - Fakten und Aspekte hindurcharbeitet, ohne daß sich dabei eine fortlaufende Erkenntnis aufbaut.
2. Besonders ärgerlich ist der deklamatorische Umgang mit philosophischen Fragestellungen. Dafür nur ein Beispiel: Im Kapitel "Das Problem der sinnvollen Freizeiterfüllung" (Seite 146 ff.) werden zunächst verschiedene Bedeutungen des Wortes "Sinn" zusammengetragen. Die Überlegung endet: "Sinn hat, was als konstituierender Beitrag letztlich der Verwirklichung von in sich selbst gültigen Werten ( = Sinnwerten) dient". Diese Meinung (sie ist nämlich eine Setzung und keineswegs eine Lösung vorher erörterter Probleme!) wird nun auf das Freizeitverhalten angewendet: "Ein Freizeitverhalten hat Sinn, soweit es Werte realisiert ... Der vom Menschen anzustrebende umfassendste Sinnwert besteht in der möglichst totalen humanen Wesensverwirklichung, die den einzelnen seiner Bestimmung optimal näherbringt." Was damit gemeint sein könnte, kann nur der Leser erraten, der sich ein wenig in der aristotelisch-thomistischen Teleologie vom Menschen auskennt. Dann heißt das etwa folgendes: Vom Menschen kann man nicht nur im Hinblick auf das sprechen, was er gerade ist, sondern nur im Hinblick darauf, was er sein wird, wenn er seine (von Gott bzw. der Natur) verliehenen Möglichkeiten verwirklicht hat. Ein wahrlich großartiger Gedanke! Aber anstatt diesen großen Gedanken auf sein Thema anzuwenden und es damit zu bereichern, greift Weber zum Klischee der "Werte". Und weiter heißt es dann bei ihm: "Sinn- und Wertordnungen lassen sich nicht durch logischen Kalkül zwingend erweisen. Sie erhalten ihre Verbindlichkeit aus der Entscheidung, die letztlich unbegründbar ist und ihre Rechtfertigung allein aus der verwirklichten Lebensform empfängt, deren Gültigkeit nicht mehr rational diskutiert, sondern nur mehr geglaubt werden kann" (Seite 148). Sehen wir davon ab, daß der Verfasser hier den Zusammenhang von Rationalität und Irrationalität etwas zu einfach sieht, so müßte das Buch spätestens hier zu Ende sein. Denn: "Die Frage nach der sinnvollen Freizeiterfüllung wird hier also auf die Frage nach der Werteordnung verwiesen". Aber: "Die Werteordnung ist jedoch in unserer Gesellschaft fragwürdig geworden".
Jetzt gäbe es eigentlich nur noch zwei mögliche Folgerungen: Entweder müßte jeder Wertüberzeugung eine eigene Freizeitpädagogik belassen werden. Oder es müßte erörtert werden, wie weit die pädagogische Theorie doch noch - im Bewußtsein der prinzipiellen Grenze - vorstoßen könnte. Weber tut weder das eine noch das andere, sondern begibt sich mit einem wahren Salto mortale auf das Feld der weltanschaulichen Taktik. Nun optiert er für die weltanschauliche Solidarität derjenigen, die überhaupt Wertvorstellungen haben, im Unterschied zu denen, die gleichgültig gegenüber allen verbindlichen Werten sind. "Sie sind der Feind schlechthin, und ihnen gegenüber ist jede Philosophie mit einer festen Wertordnung, die den geistigen Werten den Vorrang vor den wirtschaftlichen zuerkennt, und jeder Anhänger einer solchen Wertordnung ein Verbündeter, allerdings nur dann, wenn er nicht nur Werte verkündet, sondern sich gleichzeitig selbst an sie hält" (Seite 152). Da es im Freizeitbereich eher möglich sei, eine differenzierte Ordnung solcher geistigen Werte zu verwirklichen (warum eigentlich?), wird genauso das Gegenteil des sinnlosen Freizeitverhaltens erörtert. Eigentlich müßte das nun in einem Satz zu sagen sein, denn sinnlos müßte das sein, was eben nicht "der Verwirklichung von in sich selbst gültigen Werten dient". Statt dessen werden auf den folgenden Seiten zahlreiche Autoren zitiert, die sich zum Problem der Langeweile geäußert haben, etwa Johannes Cassianus, Pascal, Kierkegaard, Heidegger, Sartre und Bollnow. Aber diese Zitate leisten überhaupt nichts zur weiteren Klärung des Problems, was allein ihre Benutzung rechtfertigen könnte. Dann kommt - so, als sei nun endlich das notwendige Pensum an "Metaphysik" absolviert - auf Seite 160 ein weiterer unvermittelter Sprung. Jetzt ist auf einmal von den "Bedingungen" die Rede, unter denen ein Freizeitverhalten "als sinnvoll gelten darf". Das Wort "sinnvoll" leistet hier aber nur einen rein assoziativen Übergang. Nun ist nämlich von der "Erfüllung anthropologisch bedeutsamer Funktionen durch das Freizeitverhalten" die Rede. Das Freizeitverhalten sei "sinnvoll", wenn es "Regeneration", "Kompensation" und "Ideation" bewirke - eine in der Tat einleuchtende Kategorisierung, die zu den inter-
380
essantesten Partien des Buches führt. Aber man fragt sich verzweifelt, was nun eigentlich die ganze bisherige philosophische Spekulation dafür geleistet habe.
Dem Buch fehlt das Konzept und eine klare Vorstellung von seinem Thema. Deshalb ist es nicht überzeugend gegliedert, bricht Gedankengänge einfach ab und erstickt in einer Fülle von Zitaten, die weder veranschaulichen, noch auch der Klärung von Problemen dienen. Philosophische Problematik geriert sich als weltanschauliche Deklamation. Hinzu kommt jene Umständlichkeit, die sich immer einstellt, wenn man sein Thema nicht übersieht. So wird etwa (auf Seite 201 ff.), um die Freizeitpädagogik zu begründen, erst auf die grundsätzliche Erziehungsbedürftigkeit des Menschen eingegangen und auch hier wieder mit einer Fülle von Zitaten von Kant bis Derbolaw operiert. Als ob das irgend jemand bezweifeln würde!
Wenn der Gedanke es gebietet, müssen wir auch in der Pädagogik mit einer komplizierten Sprache rechnen. Das, was Weber in seinen spekulativen Partien mit Recht sagen will, läßt sich aber auf ganz wenigen Seiten mit einfachen Worten sagen.
Erich Weber: Das Freizeitproblem. Anthropologisch-pädagogische Untersuchung. Ernst Reinhardt Verlag, München/Basel. 359 Seiten, Leinen DM 25,-—
381

30. Ist Tourismus jugendgefährdend? (1964)
(In: Sonntagsblatt Nr. 2/1964, 12.1.1964)Es bedarf offenbar immer erst eines sensationellen Anlasses, um Probleme der Jugendarbeit ins Gespräch zu bringen. Nachdem die Öffentlichkeit auf leerstehende "Heime der Offenen Tür" und die Verwaltungsausgaben der Jugendverbände durch Presse und Fernsehen hingewiesen wurde, wird neuerdings den moralischen Gefährdungen des Jugendreisens öffentliche Aufmerksamkeit gewidmet. Anlaß dazu war ein Bericht von Helmut Kentler in den Frankfurter Heften über ein Jugendlager in Sizilien, dessen Überschrift "Sonne und Amore" treffend das Ergebnis wiedergibt.
Es nutzte dem Verfasser nichts, daß er seine Befunde einschränkte und vor Verallgemeinerungen warnte. Sein Bericht rief eine hektische Aktivität hervor. Tagungen wurden einberufen, um dem Problem wissenschaftlich zu Leibe zu rücken. Einige Funktionäre des Jugendschutzes entwickelten Kontrollvorschläge, die allenfalls in einer mittelalterlichen Gesellschaft durchzuführen wären. Andere erkannten rasch, daß der Alarmruf "Die Jugend ist in Gefahr" auch hier vielleicht unverhofft zu weiteren Mitteln aus der Staatskasse verhelfen könne. Im Handumdrehen hatten sich die pädagogischen Argumente so mit den Verbandsinteressen vermischt, daß sie nur noch mit Mühe wieder auseinander zu sortieren sind.
Die Aufregung entstand allein durch die Beschreibung der amourösen Eskapaden der jungen Leute. Dabei sind diese Partien die uninteressantesten im ganzen Bericht. Sie können nur dem neu sein, der den Kontakt mit der heutigen Jugendgeneration verloren hat und daher nicht weiß, daß die Einstellung der Jugendlichen zum anderen Geschlecht auch zu Hause keineswegs dem entspricht, was die Erwachsenen für wünschenswert halten. Wenn daran überhaupt etwas zu ändern ist, dann ganz sicher nicht ausgerechnet im Urlaub.
Neu ist vielmehr die Erkenntnis, daß die beobachteten Jugendlichen offenbar unfähig sind, in einer Situation, wo die Kontrollen des Alltags entfallen und keine geeigneten Anregungen gegeben werden, der tödlichen Langeweile einer primitiven "Subkultur" zu entgehen, zumal sie ja gerade in Sizilien auch noch auf alle wichtigen Konsumangebote verzichten müssen. Ist dies nicht viel eher eine Bankrotterklärung unserer Erziehung als der Reiseunternehmen? Ist unsere Erziehung so belanglos, daß sie in dem Augenblick unwirksam wird, wo ihre Kontrollen entfallen? Auch eine sozialpolitische Frage drängt sich auf. Kann man Jugendlichen, die ohnehin zu früh in den Arbeitsprozeß eingegliedert werden und kaum mehr als zwei Wochen Jahresurlaub erhalten, verübeln, daß sie den Reklametraum von der "großen weiten Welt" und dem "süßen Leben" allzu wörtlich nehmen?
Etwa 80 Prozent unserer Jugendlichen gehen nach dem Besuch der Volksschule in einen Beruf. Ihr deutscher Sprachschatz reicht gerade zur Lektüre der Boulevardpresse, fremdsprachliche Kenntnisse haben sie bestenfalls aus Schlagertexten, ihre Vorstellungskraft übersteigt kaum das Verständnis einer mittelmäßigen Unterhaltungssendung im Fernsehen, und ihre Sozialerfahrung ist die der kleinen, intimen Gruppe - in der Schulklasse, am Arbeitsplatz und in der Familie. Woher sollten sie eigentlich die Fähigkeiten haben, die die Kritiker des Jugendreisens so vermissen: kultivierten Umgang mit ihnen fremden Menschen, Freude an der Neuartigkeit einer fremden Umgebung, Interesse für die Eigenarten fremder Menschen und Kulturen? Es ist unmodern geworden, an den Zusammenhang der Dinge zu rühren. Sensationelles Aufbauschen von Einzelereignissen und das Kurieren an Symptomen aber werden den Menschen nicht gerecht, denen geholfen werden soll.
Im Jahre 1961 machten 31 Prozent aller 17- bis 69jährigen Westdeutschen - das sind mehr als 16 Millionen - eine Urlaubsreise; davon fuhren 39 Prozent ins Ausland. Zunehmender Wohlstand und Verbilligung der Reisen durch touristische Unternehmen ermöglichen immer neuen sozialen Schichten, die Urlaubsreise zu einem Symbol ihres sozialen Prestiges zu machen. Am wenigsten ist die Landbevölkerung "touristisch erschlossen". In Großstädten wie Hamburg verreisen etwa 70 Prozent aller Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren, im Bundesdurchschnitt etwa 38 Prozent. Wie viele andere Errungenschaften der Wohlstandsgesellschaft brach auch das Reisen gleichsam über Nacht auf Millionen herein, die darauf nicht vorbereitet waren und ihre "Erfahrungen" erst selbst machen mußten. Es ist pure Menschenverachtung, wenn man diesen neuen Touristen heute ankreidet, was auch früher die bürgerlichen Schichten erst nach Jahrzehnten des Lernens überwanden. Jener Kaufmann, der vor hundert Jahren mit dem Baedeker in der Hand sich die Reiseerfahrungen des Adels zu eigen machen wollte, war gewiß nicht weniger komisch. Es gibt also im Grunde gar keine spezifische "Jugendproblematik" des Tourismus. Der Unterschied zu den reiseungewohnten Erwachsenen ist nur, daß Jugendliche die neue Unsicherheit besonders intensiv erleben und daß sie den Gefahren besonders erliegen, weil sie weniger finanzielle und gesellschaftliche Rücksichten nehmen müssen als Erwachsene.
Zahllose Jugendliche haben sich bereits "touristisch emanzipiert" sie sind in den Schlagzeilen nicht zu finden, aber auch nicht in den typischen Gegenden des Massentourismus. Sie wählen sorgfältig aus und wissen, was sie wollen. Andere - vor allem Angehörige der unteren Mittelschichten und der Arbeiterschichten - müssen ihre Unsicherheit erst noch überwinden, indem sie sich zunächst voll und ganz den massentouristischen Organisationen anvertrauen.
Die meisten Versuche, diesen Lernprozeß der Massen pädagogisch zu steuern, haben wenig Überzeugungskraft. Gewiß kann eine Reiseorganisation, die sich geschickt auf die Bedürfnisse der Reisenden einstellt, manches erreichen. Aber letztlich ist Reisen wohl nur durch Reisen zu lernen. Jeder muß da seine eigenen Erfahrungen machen und selbst merken, was sinnvoll für ihn ist. Reisen ist vor allem anderen eine Form des Vergnügens. Man kann niemandem vorschreiben was ihn vergnügen soll. Sogenannte "höhere" Vergnügungen sind das Ergebnis eines langwierigen Lernprozesses, den unsere Gesellschaft den meisten Jugendlichen ja gerade verwehrt. Man sollte sich aber überlegen, ob es sinnvoll ist, einen "jugendeigenen" Massentourismus ins Leben zu rufen.
Es ist wohl kein Zufall, daß die alarmierenden Berichte ausnahmslos aus Ferienveranstaltungen stammen, wo Jugendliche unter sich waren und eine "Eigenkultur" entwickeln konnten. Nach allen Beobachtungen haben solche Jugendveranstaltungen wohl nur dort Sinn, wo man zu einem bestimmten Programm zusammenkommt, sei es zu einer "Ferienuniversität" oder zur Ausübung einer bestimmten Sportart. Für die Jugendlichen aber, die ihre ersten touristischen Gehversuche unternehmen, wäre es besser, sie schlössen sich dem normalen Erwachsenentourismus an. Auch hier würde die Organisation einen Schutz gegenüber der eigenen Unsicherheit bieten und außerdem würden die Jugendlichen einer gewissen sozialen Kontrolle durch die Umgebung der Erwachsenen erliegen.
Lassen wir also, was die Jugendgefährdung durchs Reisen angeht, die berühmte Kirche im Dorf. Die Gefährdung ist nicht größer, als im sonstigen Freizeitbereich auch. Noch alle neuen gesellschaftlichen Freiheiten mußten mit einer zeitweiligen sittlichen Gefährdung ganzer Sozialschichten erkauft werden.

31. Die Entwicklung der Jugendhöfe (1964)
(In: deutsche jugend, H. 1/1964, S. 43-44)Die außerschulische Jugendarbeit läßt sich durch viele Gesichtspunkte charakterisieren, unter anderem durch den, daß sie im ganzen gesehen literarisch ziemlich unproduktiv ist. Obwohl man weiß, daß die interessantesten und modernsten pädagogischen Experimente heute außerhalb der Schule gemacht werden, lassen sich die Publikationen, die solche Versuche "auf den Begriff bringen", fast an den Fingern einer Hand abzählen - wenn man die Vielzahl der isolierten Erfahrungsberichte unterschlägt, die in diesem Zusammenhang ja nur "Material-Charakter" haben können. Würde man den Gründen für diese Erscheinung genau nachgehen, stieße man auf mindestens zwei Überlegungen. Zum einen ist unsere pädagogische Wissenschaft so sehr "Schulpädagogik", daß sie für Erziehungssituationen außerhalb der Schule auch nicht annähernd hinreichende Kategorien entwickelt hat. Andererseits scheint die Praxis der außerschulischen Jugendarbeit an einer theoretischen Formulierung dessen, was sie tut, merkwürdig uninteressiert zu sein.
Damit sind einige grundsätzliche Schwierigkeiten angedeutet, die für jede Arbeit gelten, die in diesen "offenen Horizont" vorzustoßen wagt. Auch Schepp mußte für seine Arbeit über die Jugendhöfe, die vor kurzem unter dem Titel "Offene Jugendarbeit" erschienen ist, eigene Kategorien entwickeln. Er kennzeichnet diese Institutionen als "Mehrzweck- ", "Anpassungs- ", "Übergangs- " und "Vermittlungsinstitutionen". Solche Begriffe beschreiben aber soziologische Beziehungen, nicht unbedingt schon pädagogische. Überall dort nun, wo es nach der soziologischen Analyse um die pädagogische Fixierung der Sachverhalte geht, stockt der Leser. Er hat den Eindruck, daß die in der Schulpädagogik tradierten Begriffe, mag man sie noch so modifizieren, den Sachverhalt nicht mehr ganz treffen. Obwohl Schepp etwa den Begriff des "Lehrgangs" erheblich differenziert, hält er letztlich doch am "Stufengang der Lehre" vom Einfacheren zum Komplizierteren fest. Andere Formen des didaktischen Aufbaus bleiben damit außerhalb des Blickfeldes. Ebenso bleibt zu fragen, ob man solch neuartige, aus ganz anderen historischen, philosophischen, soziologischen und vor allem politischen Dimensionen erwachsene Einrichtungen wie die Jugendhöfe angemessen mit Überlegungen Schleiermachers oder Pestalozzis beschreiben kann, wie es Schepp gelegentlich tut. Dabei ist man nämlich unversehens vor die Frage gestellt, ob die Geschichte der Pädagogik uns ein ständig wachsendes Potential "gesicherter Einsichten" bieten kann oder lediglich einen Kanon von Problemen, auf den unter neuen Bedingungen neu zu antworten wäre. Neue Antworten aber müßten sich wohl auch einer neuen Sprache bedienen.
43
Diese Bemerkungen sollen zeigen, daß in dem Buch von Schepp mehr steckt, als der Titel vermuten läßt. Im engeren Sinne geht es ihm um die Jugendhöfe. Der erste Teil behandelt deren Entwicklung nach 1945. Auch hier wird der Blick notwendigerweise - weil es sich um ein "offenes Feld" handelt - auf den Gesamtzusammenhang der Jugendarbeit ausgedehnt: Die Geschichte der Jugendhöfe wird zu einer kleinen Geschichte der Jugendarbeit, mindestens zu einer Geschichte ihrer wichtigsten Probleme. Dabei werden die Wechselwirkungen von gesellschaftlich-politischer Situation, kulturpolitischer Intention verschiedener Träger und Zielsetzung der Häuser beschrieben.
Im zweiten Teil wertet Schepp eine eigene Befragung von Besuchern der Jugendhöfe aus und benutzt die Ergebnisse zur Erörterung der spezifischen pädagogischen Beziehungen sowie der didaktischen und methodischen Probleme. Die Befragungsergebnisse werden dabei mit einem Höchstmaß an kritischer Distanz verwertet und mit der eigenen Beobachtung überzeugend verbunden.
Es würde zu weit führen, hier die Fülle der praktischen Hinweise, die sich aus diesem zweiten Teil für das Verhalten der Pädagogen, für die Programmgestaltung oder für die Einstellung zu den Teilnehmern ergeben, auch nur andeutungsweise zu referieren. Ähnliches gilt für die theoretischen und praktischen Folgerungen, die Schepp aus der Tatsache ableitet, daß die Jugendhöfe auf der einen Seite pädagogische, auf der anderen Seite aber kommerzielle Institutionen sind, insofern sie für den Ausgleich des Haushaltes selbst zu sorgen haben. Daß diese Widersprüchlichkeit nicht bloß etwas Äußeres ist, sondern bis in methodische und didaktische Einzelheiten der Arbeit hineinwirkt, ist hier zum erstenmal mit allem Nachdruck gesagt worden. Im Grunde erstrecken sich, wie dieses Beispiel zeigt, die Probleme, die Schepp am Beispiel der Jugendhöfe exemplifiziert hat, in jeweils abgewandelter Form auf die gesamte außerschulische Jugendarbeit. Im Hinblick auf die Jugendhöfe selbst wäre eine Einschränkung zu machen, der Schepp wohl zustimmen würde. Da zwischen der Fertigstellung des Manuskripts und der Drucklegung geraume Zeit verstrichen ist, hat sich die Situation zum Teil grundlegend gewandelt. Das Bild, das Schepp von den Jugendhöfen entwirft, entspricht nicht mehr der gegenwärtigen Situation. Nur sehr wenigen Jugendhöfen ist es gelungen, ein eigenes pädagogisches Konzept durchzuhalten. Andere sind inzwischen verschwunden oder zu bloßen "Tagungshotels" für Jugend- und Erwachsenenorganisationen geworden.
Daß sich über manche pädagogische und gesellschaftliche Deutungen in der Veröffentlichung von Schepp Diskussionen ergeben werden, ist kein Mangel, sondern ein Vorzug. Das Risiko, einen aktuellen und schnell sich wandelnden pädagogischen Tätigkeitsbereich zum Gegenstand wissenschaftlicher Forschung zu machen, hat sich gelohnt: Für die Praktiker bietet Schepp Maßstäbe und Forschungsergebnisse zur Verbesserung des erzieherischen Selbstverständnisses an. Für die Theoretiker hat er ein Modell dafür geliefert, wie man in diesem komplizierten Bereich Kategorien entwickeln kann, die die Bedeutsamkeit des Faktischen einfangen, ohne die bloße Praxis zu duplizieren.
Heinz Hermann Schepp: Offene Jugendarbeit - Jugendhöfe und Jugendgruppenleiterschulen in der Bundesrepublik und in West-Berlin. Eine Untersuchung ihrer Entwicklung und ihrer gegenwärtigen Arbeit. Verlag Julius Beltz. Weinheim/ Bergstraße. 251 Seiten, broschiert, DM 10.-
44

32. Erziehung im "Dritten Reich" (1964)
(In: Neue Politische Literatur, H. 6/1964, S. 442-447)Rolf Eilers: Die nationalsozialistische Schulpolitik. Eine Studie zur Funktion der Erziehung im totalitären Staat. = Staat und Politik, Bd. 4. 152 S., Westdeutscher Verlag, Köln/Opladen 1963.
Wir haben uns - leider auch in manchen Partien der wissenschaftlichen Diskussion -
442
angewöhnt, ein recht vereinfachtes Bild vom "totalitären Staat" zu entwerfen: Er sei ein Staat, der nicht nur die staatlichen, sondern auch die gesellschaftlichen und sogar privaten Lebensäußerungen seiner Menschen bis in Einzelheiten hinein zu dirigieren trachte. Daß diese Sicht ungebührlich simplifiziert, nimmt der Verf. in seiner Bonner Dissertation für seinen speziellen Gegenstand im Vorwort vorweg: "Es wird deutlich, daß die Interessengegensätze auch im totalitären Staat nicht aufgehoben sind, sondern nur in anderer Form ausgetragen werden. Das Bild vom monolithischen totalitären Staat erweist sich als falsch."
Dieses Ergebnis folgt nun allenthalben aus dem Material eines Themas, das bisher nicht in rechter Weise gewürdigt worden ist, obwohl - oder weil? - es zu den aktuellsten Problemen der "unbewältigten Vergangenheit" gehört. Mit entsprechenden Verweisen auf die nationalsozialistische Ära wird heute angesichts der drängenden Fragen der Schul- und Bildungsreform allenthalben diskutiert und argumentiert. Verführt politische Bildung in der Schule nicht zu deren Politisierung wie im Nationalsozialismus? Ist nicht jede auf Gemüt und Willen gerichtete Erziehung für lange Zeit diskreditiert? Ist das, was sich heute als "Lagererziehung", "Gemeinschaftserziehung" und "freiwilliger Arbeitsdienst" ausgibt, mehr oder anderes als eine ungebrochene Fortsetzung nationalsozialistischer Tendenzen? E. geht bei seiner Darstellung nicht von solchen Fragen aus, sondern von einer Gliederung, wie sie sich einer politikwissenschaftlichen Darstellung aufzwingt. In einem ersten Teil ("Die Indoktrination in der Schule") werden die Maßnahmen beschrieben, die das "NS-Gedankengut" bei den Massen der Schüler und Lehrer verbreiten sollten. Dies geschah durch eine Fülle sehr detailliert beschriebener Maßnahmen wie Umschulung der Lehrerschaft, Neuordnung der Ausbildung, Beseitigung des Religionsunter-
443
richts, Reduktion der Mädchenbildung, neue Lehrpläne und Lehrmittel und Errichtung eigener Eliteschulen.
Der zweite Teil behandelt die Beziehungen zwischen Schule und totalitärem Staat, die Zentralisierung des vorher föderativen Schulwesens und die Gleichschaltung aller am Erziehungsprozeß beteiligten Stellen und Organisationen. Diese auf dem Verwaltungsweg durchgeführten Maßnahmen waren überaus gezielt, hemmten aber oft einander, weil es nicht gelang, alle widerstreitenden Interessen und Vorstellungen zu koordinieren. Noch stärker gilt dies für das Verhältnis von "Schule und Bewegung", das den Inhalt des dritten Teiles bildet. Die Maßnahmen ergänzten sich keineswegs einsinnig, sondern litten unter einer Vielzahl von Konkurrenzen zwischen Parteistellen untereinander, oder zwischen einzelnen Parteigrößen und staatlichen Verwaltungsinstanzen, oder zwischen HJ und Schule.
Das Ergebnis dieser von E. minutiös nachgezeichneten Entwicklung war unter anderem ein radikaler Leistungsverfall der schulischen Bildung und Ausbildung, der je länger je mehr auch von offizieller Seite - vor allem von der Wehrmacht - kritisiert wurde. Es hatte sich gezeigt, daß eine hochkomplizierte Gesellschaft auch in ihrer totalitären Version eines ganz anderen Maßes an intellektueller Ausbildung ihrer künftigen Staatsbürger bedurfte, als die Nationalsozialisten geglaubt hatten. In Wahrheit konnten sie von ihrem irrationalistischen, die emotionale Gesinnungsbildung übersteigernden Ausgangspunkt her gar keine den modernen Notwendigkeiten auch nur annähernd entsprechende Bildungskonzeption entwickeln, obwohl alle Macht zur Durchsetzung ihnen dafür zur Verfügung gestanden hätte.
Alle diese Zusammenhänge, die wir hier nur knapp skizzieren können, werden von E. überzeugend dargestellt und mit reichem Material gestützt. Einwände erge-
444
ben sich erst, wenn man sich aus seinem methodischen Modell herausbegibt. E. ordnet sein Material "logisch", nicht historisch. Ihn interessieren vor allem die Beziehungen zwischen totalitärem Staat und seinem Erziehungswesen. Der logische Gang ist etwa folgender: Der Nationalsozialismus will seine Weltanschauung durchsetzen. Er tut das unter anderem mit Hilfe der Schule. Die Schule und die anderen Erziehungsmächte müssen dafür "gleichgeschaltet" werden, um die "Indoktrination" mit einem höchstmöglichen Effekt zu bewirken. Die Gleichgeschalteten widersetzen sich mehr oder weniger, weshalb diese Maßnahmen Prozeßcharakter annehmen und zum Teil erst in den ersten Kriegsjahren mit einigem Erfolg beendet werden können. Für die Gleichschaltung selbst gibt es eine Reihe erfolgreicher und weniger erfolgreicher "Techniken", außerdem wird sie durch den charakteristischen "Kryptopluralismus" im NS-Staat behindert.
Die Stärke dieses Modells liegt darin, daß sich mit ihm der an sich dynamische Stoff logisch systematisieren läßt. Sein Nachteil aber, der m. E. ganz offensichtlich ist, liegt eben in der damit verbundenen unhistorischen Betrachtungsweise. Das beginnt schon bei der verständlicherweise knappen Darstellung der "schulpolitischen Situation bei der Machtergreifung" (S. 50 ff.), die folgendermaßen zusammengefaßt wird: "Die Schulpolitik der Weimarer Zeit war gekennzeichnet durch das Streben nach größerer Einheitlichkeit, Anpassung des Schulsystems an die Moderne, vor allem durch Ausbau des Berufsschulwesens und der weiblichen Bildung und einer ungehinderten gesellschaftspolitischen Initiative der Lehrerschaft" (S. 53).
Das ist eine mehr als wohlwollende Charakteristik! Sie übergeht nicht nur die erbitterten schulpolitischen Auseinandersetzungen in der Weimarer Republik um die Lehrerbildung, die Konfessionalisierung des Schulwesens und die
445
Einheitsschule, sie macht darüber hinaus wichtige Aspekte der nationalsozialistischen Schulpolitik schlechterdings unverständlich. Warum identifizierten sich anfangs vor allem Volksschullehrer mit der nationalsozialistischen Schulpolitik? Wird uns das durch Hinweise auf die "Bildung eines romantisch-verschwommenen Lebensideals", die "Jugendbewegung", die "allgemeine Reformbereitschaft", den "Zeitgeist" und die "fast schichtentypische politische Bereitschaft des Mittelstandes ... zur Identifizierung mit dem Nationalsozialismus" (S. l f.) hinreichend verständlich? Sahen nicht gerade viele Volksschullehrer in den entscheidenden Maßnahmen der Nazis - Vereinheitlichung des Schulwesens; Entkonfessionalisierung der Schule - Lösungen, für die sie selbst jahrzehntelang erfolglos gekämpft hatten? Warum regte sich im "Krypto-Pluralismus" des Nationalsozialismus niemand für die Beibehaltung der konfessionellen Schule? War sie vielleicht - unabhängig vom Nationalsozialismus - überfällig geworden? An welchen Punkten waren die Maßnahmen der Nazis - gemessen an den Notwendigkeiten der hochindustrialisierten Gesellschaft - "fortschrittlich" und mobilisierten deshalb nicht nur die Dummen, und an welchen waren sie ganz einfach "reaktionär" oder gar rückständiger als die bestehende Lage? (Letzteres ganz sicher bei den geradezu verklemmten Vorstellungen von Mädchenbildung.)
Gerade die letzte Frage und ihre Beantwortung würde das Thema dieser Arbeit "heikel" und "aktuell" für unsere gegenwärtigen bildungspolitischen Diskussionen machen. Vielleicht hätte ein solch zusätzlicher historischer Aspekt den Rahmen der Untersuchung gesprengt. Dennoch scheint es mir eine grundsätzliche methodologische Frage zu sein, ob man bei einem solchen zeitgeschichtlichen Thema nicht außer einer an sich brauchbaren Methode auch eine Theorie braucht, die die Ergebnisse in den Zusammenhang der
446
historischen Kontinuität stellt; denn die Arbeit von E. stellt das Thema der nationalsozialistischen Schulpolitik zum ersten Mal dar und wird deshalb zweifellos in den gegenwärtigen Diskussionen eine Rolle spielen. Deshalb wäre es fatal, wenn der Eindruck entstehen würde - was der Verf. zweifellos nicht will - als ob der Nationalsozialismus eine im ganzen produktive schulpolitische und erziehungspolitische Situation liquidiert hätte, an die wir jetzt nur anzuknüpfen brauchten.
Daher bleibt zusammenfassend zu sagen: Die politologische Aufgabe, die sich E. vorgenommen hat, nämlich den Zusammenhang von Herrschaftsstruktur und Schule im Nationalsozialismus zu beschreiben, ist überzeugend gelöst. Die historische und politische Aufgabe, d. h. das Zurückfragen von den Problemen der Gegenwart her und das Einordnen in die historische Kontinuität, bleibt noch zu leisten.
447

33. Was ist Jugendarbeit? (1964)
(In: Müller, W./Kentler, H./Mollenhauer, K./Giesecke, H.: Was ist Jugendarbeit. Vier Versuche zu einer Theorie. München 1964, S. 119-176)
Kritik der Praxis
Wolfgang Müller (gemeint ist sein Beitrag im selben Band, S. 11-36, H.G.) hat die Schwierigkeit, eine Theorie zu entwerfen, mit der Schwierigkeit verglichen, ein Dutzend Flöhe einzeln und zugleich in ihren wechselseitigen Beziehungen zu beschreiben. In der Tat ist das nicht nur ein amüsantes, sondern auch ein höchst instruktives Bild. Es enthält nämlich den Gedanken, daß unsere Theorie weniger Tatsachen als vielmehr Prozesse zu ihrem Gegenstand hat, also etwas, was sich ständig ändert. Dennoch enthält das Bild auch eine nicht unproblematische Vorentscheidung, daß es sich bei den Flöhen nämlich zweifelsfrei um Flöhe handele und nicht etwa um Tiere, die unter bestimmten Aspekten den Flöhen nur ähnlich sind. So könnte also der Eindruck entstehen, daß eine Theorie der Jugendarbeit von einer Reihe zweifelsfreier Grundtatsachen ausgehen könne, die nur in einen gedanklichen Zusammenhang gebracht werden müßten. Dies hat Wolfgang Müller mit seinem Bild - wie sein ganzer Beitrag zeigt - keineswegs gemeint. Aber indem wir seinen Einstieg ein wenig strapazieren, gewinnen wir einen ersten Einblick in die grundsätzlichen Schwierigkeiten, die sich einer Theorie der Jugendarbeit in den Weg stellen.Schwierigkeiten beim Begriff "Theorie"
Gäbe es eine übereinstimmende Meinung darüber, was Theorie überhaupt sei, so ginge es hier lediglich darum, sie an unser Problemfeld anzulegen und die dabei gewonnenen Ergebnisse mitzuteilen. Tatsächlich aber gibt es mehrere, einander widersprechende Theorievorstellungen, die nicht nur zu verschiedenen Ergebnissen führen, sondern schon die Tatsachen selbst verschieden interpretieren. Wir müssen uns also von Anfang an darüber klar sein, was wir mit "Theorie" meinen. Erst dann können wir auch die Ergebnisse recht prüfen.
Da gibt es etwa die weit verbreitete Vorstellung, eine Theorie der Jugendarbeit müsse die "Wirklichkeit" der120
Jugendarbeit möglichst umfassend beschreiben und darstellen. Aber was ist diese "Wirklichkeit"? Ist es das, was diejenigen, die sie herstellen, darüber denken und sagen? Ist sie überhaupt erkennbar ohne das, was darüber gesagt und gedacht wird? Bei allen empirischen Untersuchungen von Phänomenen der Jugendarbeit sind wir gezwungen, von Äußerungen und Reaktionen von Menschen auszugehen, von denen wir auf die Sachverhalte zurückschließen müssen. Die Sachverhalte selbst - ohne die Meinungen der Menschen - sind der Empirie überhaupt nicht zugänglich, und indem wir auch nur zwei solcher Äußerungen gedanklich miteinander verbinden, haben wir den Boden der Empirie bereits wieder verlassen und stehen erneut vor der Frage, was Theorie der Jugendarbeit denn nun heißen könne.
Immer wenn solche methodischen Schwierigkeiten auftauchen, ist es nützlich, sich daran zu erinnern, um welche Aufgaben es sich eigentlich handelt, was man also mit einer Theorie der Jugendarbeit eigentlich lösen will. Dazu ein Beispiel: Wenn wir pädagogisch beschreiben und deuten wollen, was in irgendeinem beliebigen Haus der Offenen Tür vor sich geht, so könnte man sich ja auf das beschränken, was sich innerhalb der "vier Wände" ereignet: Da gibt es Erwachsene, die in bestimmter Weise auf Jugendliche einwirken wollen, und Jugendliche, die das einfach annehmen, es ablehnen oder modifizieren. Noch sehr viel mehr ließe sich unter Anwendung gruppensoziologischer Gesichtspunkte ermitteln, und zweifellos wäre das alles sehr wichtig für das Verständnis dieser Arbeit. Aber schon ein flüchtiges Nachdenken lehrt uns, daß das nicht ausreichen kann: Vielleicht hat das Heim in bestimmten bürgerlichen Kreisen einen "schlechten Ruf", so daß die Jugendlichen aus diesen Kreisen gar nicht deswegen fernbleiben, weil ihnen etwa das Programm des Heimleiters nicht paßt. Oder die anwesenden Jugendlichen behaupten zum Beispiel, sie wollten nur tanzen und nichts anderes, aber das liegt vielleicht nur daran, daß sie sich andere Bedürfnisse noch gar nicht klar gemacht haben und
121
sich diese Klärung gerade insgeheim von dem Erwachsenen erwarten. Oder der Heimleiter mag ständigen Ärger mit seiner beschränkten Verwaltung haben, und er merkt irgendwann gar nicht mehr, daß dieser Ärger immer stärker eingeht in das, was er in den politischen Gesprächen seinen Jugendlichen allgemein über Politik erzählt. Vielleicht wundert sich der Heimleiter auch darüber, daß sich die Jugendlichen bei Themen, die sie eigentlich brennend interessieren müßten, zurückhaltend äußern, und er führt das auf seine schlechte Methode zurück, in Wahrheit liegt es aber vielleicht nur daran, daß seine Partner in einem Betrieb beschäftigt sind, der ihre Initiative und ihre "Fragerei" rücksichtslos unterdrückt.
Diese wenigen Gesichtspunkte, die beliebig zu vermehren wären, machen wohl genügend deutlich, daß unser Heimleiter sehr viel wissen muß, wenn er voll begreifen will, was er pädagogisch tut. Da seine Arbeit - und vor allem er selbst - von vielen Punkten der Gesellschaft her beeinflußt wird, kann er sie auch nicht mehr isoliert verstehen. Um sie richtig deuten zu können und um sich nicht immer wieder selbst zu täuschen, bedarf er offensichtlich eines weit über seine eigene Praxis hinausreichenden Orientierungssystems.
Damit ist die Grundsituation bereits markiert, in der eine pädagogische Theorie nötig wird: Seitdem Massenkommunikation sowie horizontale und vertikale Mobilität alle denkbaren pädagogischen Handlungssituationen von allen Punkten der Gesellschaft her beeinflußbar machen, gibt es keine isolierten pädagogischen Akte mehr. Pädagogische Theorie ist der Versuch, in dieser Lage dennoch sinnvolle pädagogische Akte zu ermöglichen. Sie schafft auf diese Weise einen Orientierungszusammenhang, der dem Pädagogen ein angemessenes Verständnis seines pädagogischen Tuns ermöglicht. Es ist wichtig zu sehen, daß dieses Problem erst verhältnismäßig jungen Datums ist. Es tauchte erst auf, als sich die moderne Gesellschaft immer mehr entfaltete, indem sie sich immer mehr differenzierte. Pestalozzi etwa waren die gesellschaftlichen Bedingungen
122
seiner Erziehungsarbeit in der Armut der Kinder noch unmittelbar und hinreichend einsichtig. Unser Heimleiter hingegen hat es mit abstrakten, anonymen Zusammenhängen zu tun, die ihm überhaupt erst dann auffallen, wenn er mit der Brille der Theorie nach ihnen sucht.
Nehmen wir an, ein Heimleiter sei sich dieser Lage bewußt und versuche sich auf eigene Faust einen solchen Horizont zu verschaffen: Er liest soziologische und psychologische Bücher und diskutiert mit seinen Kollegen. Aber dabei stellt sich sehr bald folgendes heraus:
(a) Je mehr er liest, um so unklarer wird, was das alles mit seiner Praxis zu tun haben könnte; denn diese Bücher sind nach den systematischen Gesichtspunkten der jeweiligen Wissenschaft geschrieben, ihn interessiert aber gerade, was das alles für sein eigenes pädagogisches Handeln bedeutet. Er muß diese Darstellungen nicht nur verstehen, sondern sie immer auch in seinen eigenen Handlungszusammenhang übersetzen. Dabei macht er eine wichtige, für eine jede pädagogische Theorie konstitutive Entdeckung: daß nämlich eine jede fachwissenschaftliche Aussage erst dann zu einem Element der pädagogischen Theorie wird, wenn sie auf eine bestimmte pädagogische Handlungssituation hin zugeordnet wird, daß also die quantitative Anreicherung von Wissen nicht von selbst in die Qualität einer pädagogischen Theorie umschlägt. Mit anderen Worten: Pädagogische Theorie ist mehr als nur die bloße Addition psychologischer, soziologischer und ähnlicher Erkenntnisse.
(b) Je mehr er liest, um so zufälliger erscheint ihm die Auswahl. Seine Zeit ist ohnehin begrenzt, und wie soll er wissen, ob er das richtige trifft. Wenn es bei einer pädagogischen Theorie darum geht, die wichtigsten Zusammenhänge einer pädagogischen Handlungssituation aufzuhellen, dann kann sie offenbar nicht von einem Einzelnen hinreichend formuliert werden. Voraussetzung ist offenbar eine gut durchdachte Kommunikation derjenigen, die etwas von der pädagogischen Handlungssituation verstehen, mit denjenigen, die etwas von den dabei zu beachtenden Sach-
123
zusammenhängen verstehen. Vernünftige Theoriebildung ist also an organisatorische und technische (Forschungsmittel!) Voraussetzungen gebunden. Damit ist auch schon entschieden, daß sie in der Praxis prinzipiell nicht geleistet werden kann - es sei denn, die Jugendarbeit etwa würde diese Aufgabe aus sich selbst in Gestalt eigener Forschungsstätten ausgliedern. Deshalb könnte unser imaginärer Heimleiter mit Recht erwarten, daß ihm die Erziehungswissenschaft eine oder mehrere solcher Theorien vorlegt. Es ist ihre Aufgabe, nicht die seine. Daß er selbst dennoch einen wichtigen Beitrag dazu liefern kann, wird uns noch beschäftigen.
Verlassen wir nun den ohnehin genug strapazierten Heimleiter und versuchen wir, ausgehend von unserer Grundsituation, noch einige Folgerungen zu ziehen.
1. Es geht bei einer Theorie der Jugendarbeit natürlich nicht nur darum, eine Praxis zu verstehen, sondern auch darum, sie zu verändern. Weil uns die "Wirklichkeit" der Jugendarbeit in den Prinzipien fragwürdig erscheint, gerade deshalb bemühen wir ja die Anstrengungen einer Theorie - andernfalls könnten wir uns mit der Verbesserung von Methoden begnügen. Unsere Theorie muß also sowohl kritisch gegen das pädagogische Handeln und seine Motive eingestellt sein wie vor allem auch gegen die Bedingungen, die das Handeln mitbestimmen. Damit entwirft die Theorie auch notwendig ein Bild des veränderten und verbesserten Zustandes: Sie entwickelt Prognosen.
2. Auf diese Weise verbindet sich aber nun das Ziel des Erkennens mit dem des Veränderns und macht die Theorie zu einer "engagierten Theorie": Der Wille zur Lösung geht ein in die Erkenntnis der Probleme, die gelöst werden sollen. Er kann aus den Denkergebnissen nicht ganz herausoperiert werden. Damit ist immer die Gefahr gegeben, daß diese Willensmomente die Denkergebnisse ideologisch fixieren. Dieser Gefahr kann man nur dadurch entgegenarbeiten, daß man sie sich bewußt macht, nicht dadurch,
124
daß man ihr auszuweichen versucht und sie damit nur verdrängt.
Die sorgfältige Beachtung der Willensmomente ist von großer Wichtigkeit. Wenn zum Beispiel eine Kirche durch die Jugendarbeit "Christen" heranbilden will und die Gewerkschaft "bewußte Arbeiter" - was immer das im einzelnen heißen mag - so gibt es dagegen keinen prinzipiellen Einwand der pädagogischen Theorie. Sie kann höchstens belegen, daß dieses Ziel mit erfolglosen Mitteln betrieben werde; daß es einen ganz bestimmten historischen Ursprung habe; daß die anthropologischen Begründungen unzutreffend seien; daß es diese oder jene Folgen für das konkrete Dasein des Jugendlichen oder auch der ganzen Gesellschaft habe und anderes mehr. Unsere Theorie kann und muß sich in einem "vorletzten Horizont" bewegen, will sie nicht den falschen Eindruck erwecken, als könne sie die Mehrdeutigkeit der Werte und Erscheinungen in einer "höheren Einheit" aufheben. Umgekehrt kann sich aber auch keine Erziehungsvorstellung mehr der Kritik dadurch entziehen, daß sie bloß auf ihre eigentümliche Weltanschauung verweist. Gäbe es nicht einen breiten Bereich dessen, was sich im Rahmen einer pädagogischen Theorie vor jeder Willensentscheidung mit Vernunft kritisieren läßt, so gäbe es folgerichtig auch keine Legitimation mehr, irgendeinem Träger noch öffentliche Mittel zukommen zu lassen - es sei denn, man erlaubte den Trägern den reinen Machtkampf um die staatlichen Fleischtöpfe. Die Vorstellung von der staatlichen Subsidiarität darf nicht zum gedankenlosen Gerede werden. Aber nicht nur der in einer Kirche oder einer anderen gesellschaftlichen Gruppe engagierte, sondern jeder Erzieher trifft solche Willensentscheidungen, die in seiner Erziehungsarbeit unmittelbar praktisch werden, und auch er trifft sie nicht nur als Einzelner, sondern immer schon im Rahmen eines bestimmten Gruppenverständnisses. Die vereinfachte Vorstellung, auf der einen Seite gäbe es an gesellschaftliche Gruppen gebundene Erzieher, auf der anderen von ihnen losgelöste "autonome Pädagogik", die
125
sich allein zum "Anwalt des Kindes" mache, war schon in den Kampfzeiten, in denen sie entstand, gedankenärmer als die ihrer Gegner.
3. Unsere Theorie kann nicht zum Ziele haben, alle Tatsachen und Erscheinungsweisen der Jugendarbeit in gleicher Weise zu würdigen. Würde sie das versuchen, so käme sie über eine völlig inhaltsleere und formale Begrifflichkeit nicht hinaus, die wiederum dem pädagogischen Handeln nichts nutzen würde. Damit eine Theorie überhaupt eine Struktur bekommen kann, muß sie gleichsam einige Tatsachen für wichtiger erklären als andere. Wenn auf den folgenden Seiten vieles unterschlagen wird, was der Leser für wichtig hält, so mag er bedenken, daß nicht diese Tatsache als solche kritisierbar ist, sondern nur, ob die dabei getroffene Auswahl einleuchtet oder nicht.
Fassen wir die bisherigen Überlegungen zusammen, so erhält die pädagogische Theorie eine eigentümliche Stellung zwischen der Erziehungsphilosophie einerseits und den pädagogisch relevanten Fachwissenschaften andererseits. Geht es den erziehungsphilosophischen Überlegungen um die Reflexion der Prinzipien der Erziehung und den Fachwissenschaften (Soziologie, Psychologie, Anthropologie, Geschichte usw.) um die "empirische" Ermittlung von Tatbeständen der verschiedensten Art, so schafft unsere pädagogische Theorie eine auf die Praxis der Jugendarbeit hin verdichtete Vermittlung zwischen beiden Erkenntnisweisen und Erkenntnisergebnissen. Sie addiert also nicht einfach einzelwissenschaftliche Ergebnisse, sondern sie integriert sie unter dem Maßstab einer bestimmten pädagogischen Handlungssituation.
Diese Unterscheidung ist wichtig, weil man eine pädagogische Theorie nicht in gleichem Maße "wissenschaftlich" nennen kann wie etwa eine soziologische oder psychologische Untersuchung. Letztere sind heute allein dadurch wissenschaftlich, daß sie mit dem jeweils höchsten Stand methodischer Zuverlässigkeit arbeiten. Für die Entwicklung einer pädagogischen Theorie gibt es aber in diesem
126
Sinne keine verbindliche Methode, weil das Ordnungsprinzip hier die Problematik des pädagogischen Handelns ist, das sich nicht in objektivierbare Methodik umsetzen läßt. Daher besteht auch zwischen einer pädagogischen und einer fachwissenschaftlichen "Theorie" ein gewichtiger Unterschied. Eine fachwissenschaftliche Theorie entwirft ein Hypothesenmodell, das der empirischen Erkenntnis vorauseilt und von dem man hofft, daß es sich durch künftige Untersuchungen bewahrheiten wird. Auch hier bleibt also das den heutigen Fachwissenschaften eigentümliche Verhältnis von Methode und Ergebnis gewahrt.
Während man also die Ergebnisse einer erziehungsphilosophischen Erörterung als "wahr" und "unwahr", die einer fachwissenschaftlichen Untersuchung als "richtig" und "falsch" klassifizieren kann, kann man bei einer pädagogischen Theorie nur von "angemessen" und "nicht-angemessen" sprechen. Eine "angemessene" pädagogische Theorie muß folgendes leisten:
(a) Sie muß die wesentlichen Faktoren, die die Praxis bestimmen, berücksichtigen. Dabei ist sie auf die öffentliche Diskussion ihrer Aussagen angewiesen, weil es keine Möglichkeit gibt, diese Faktoren allein "am grünen Tisch" zu ermitteln.
(b) Sie muß "praktikabel" sein; das heißt nicht etwa, daß sie eindeutige Rezepte für die Praxis abgeben muß, sondern daß sie den Spielraum des Rationalisierbaren soweit wie möglich ausfüllt, so daß die pädagogische Entscheidung sich innerhalb eines klaren, pädagogisch-theoretisch aufgehellten Rahmens bewegen kann.
(c) Ihre Ergebnisse müssen sich der fachwissenschaftlichen Überprüfung stellen. Sie muß jene ihrer Aussagen korrigieren, die sich durch den Fortschritt der fachwissenschaftlichen Erkenntnisse als unrichtig erweisen. Damit erhält die pädagogische Theorie ein prinzipiell dynamisches, auf Korrigierbarkeit hin angelegtes Moment.
(d) Sie muß sich von ihren ausdrücklichen oder impliziten voluntativen Elementen her kritisieren lassen. Durch diese Elemente, die, wie wir sahen, konstitutiv für eine pädago-
127
gische Theorie sind, erhält jede pädagogische Theorie ein Moment des Relativen: Es gibt über denselben Gegenstand grundsätzlich verschiedene "angemessene" Theorien.
(e) Sie muß sich von erziehungsphilosophischen Erörterungen überprüfen lassen.
(f) Ihre Argumentation muß schlüssig und überzeugend sein.
"Wissenschaftlich" ist eine pädagogische Theorie dann zu nennen, wenn sie alle diese Forderungen erfüllt, mit anderen Worten: wissenschaftlich ist eine pädagogische Theorie dann, wenn sie wissenschaftlich kontrollierbar bleibt - sowohl im Hinblick auf ihre Argumentationsweise wie auch im Hinblick auf die Richtigkeit ihrer einzelnen Aussagen.
Daraus folgt nun aber, daß angemessene pädagogische Theorien nur in einer Atmosphäre breiter öffentlicher Diskussion gedeihen können. Schon für jede Fachwissenschaft ist es unerläßlich, daß ihre Fachvertreter miteinander in Diskussion bleiben. Vollends gilt dies für die Entwicklung pädagogischer Theorien, die vielerlei fachwissenschaftliche Ergebnisse ebenso berücksichtigen müssen wie die Probleme der "Praxis", also die der Kulturpolitiker und der handelnden Erzieher. Unsere Forderung nach "Praktikabilität" einer Theorie kann überhaupt nur im ständigen Gespräch mit diesen Akteuren verwirklicht werden.
Allerdings darf nicht die Illusion entstehen, daß die öffentliche Diskussion nun auch unbedingt zu einheitlichen Ergebnissen führen muß. Wenn wir sagten, daß es über denselben Gegenstand je nach der Art der voluntativen Elemente und des politischen Engagements mehrere "angemessene" Theorien gibt, so bedeutet das, daß übereinstimmende praktische Lösungen entweder durch öffentliche Diskussion erfolgen oder durch kulturpolitische Entscheidungen, die um so vernünftiger sein werden, je breiter die Diskussion des Diskutierbaren genutzt wurde.
In einem ersten Entwurf ist es nicht möglich, die sechs Forderungen an eine angemessene Theorie vollständig zu
128
erfüllen. Es geht hier zunächst nur darum, das Feld abzutasten, das von einer solchen Theorie erschlossen werden müßte. Die fragmentarischen Vorbemerkungen sollten aber deutlich machen, daß unser Beitrag die pädagogischen Probleme der Jugendarbeit zum Gegenstand hat, obwohl auf den ersten Blick wenig pädagogische Überlegungen im herkömmlichen Sinne zu erkennen sein werden.
Unsere Behauptung, eine Theorie der Jugendarbeit sei nötig, wollen wir nun an vier Thesen erhärten.
Theorie und Organisation
Die Jugendbewegung kannte und brauchte in ihren Anfängen keine Theorie. Was sie vor dem ersten Weltkrieg über sich selbst dachte, erhob nicht den Anspruch einer Theorie und darf daher auch nicht mit einem solchen Anspruch interpretiert werden. Die wandernde Jugendgruppe formulierte zwar so etwas wie einen Sinn ihres eigenen Tuns, aber die wesentlichen Dinge blieben - wie die Apologeten der Jugendbewegung immer wieder mit Recht betont haben - unausgesprochen. Was man tat oder nicht tat, was man wollte oder nicht wollte, war zum größten Teil eine Sache des stillschweigenden Einverständnisses innerhalb der kleinen Gruppen. In dem Augenblick aber, wo es galt, räumlich weit verstreute Menschen zu einer gemeinsamen Gruppe zusammenzufassen, mußte man formulieren, was nun nicht mehr nur unmittelbares Einverständnis sein konnte. In diesem Sinne ist die berühmte Meißner-Formel so etwas wie der erste Ansatz zu einer Theorie der Jugendbewegung gewesen. Daß es dieser Bewegung andererseits nicht gelang, aus den irrationalen Dimensionen des gruppenhaften Selbstverständnisses zu einer rationalen und verbalisierbaren Theorie zu finden, war der Kern ihres Unterganges nach dem Ersten Weltkrieg. Unaussprechbare Gefühle sind zu vage und mehrdeutig, als daß sie einen Zusammenhalt über die face-to-face-Situation hinaus stiften könnten. Ein klassisches Beispiel aber dafür, welche Bedeutung eine Theorie für den
129
Zusammenhalt von räumlich getrennten Menschen haben kann, ist die Geschichte der deutschen Sozialdemokratie: Ohne ihre Theorie hätte sie wohl die Sozialistengesetze Bismarcks nicht in dieser Geschlossenheit überlebt.
Damit ist schon der notwendige Zusammenhang von Theorie und Organisation angedeutet. In dem Augenblick, wo es überregionale Jugendverbände gibt, wo staatliche Jugendpflege sich auftut, wo gar ganze Finanzierungsprogramme eingerichtet werden wie im Bundesjugendplan, ist eine gewisse gemeinsame Theorie das einzige Bindemittel zwischen Menschen, die indirekt miteinander verkehren, sich aber vielleicht nie zu Gesicht bekommen. Die Beziehungen etwa zwischen dem Beamten, der über die Mittelvergabe entscheidet, und dem Mittelempfänger ist nicht nur eine sachliche - etwa durch die Bestimmungen der Reichshaushaltsordnung geregelte - sondern auch eine theoretische. Beide sind sich weitgehend über den Verwendungszweck der Mittel einig und würden ihn "theoretisch" begründen können, beide akzeptieren andererseits das Subsidiaritätsprinzip als Grundlage ihrer Beziehung. Etwas überspitzt könnte man also sagen: Theorie ist notwendig als Ersatz für die unmittelbare Kommunikation. Nun sind heute ohne Zweifel unsere "Theorien" der Wirklichkeit der organisatorischen Zusammenhänge nicht mehr angemessen. Während man in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg keine ausformulierte Theorie brauchte, um die demokratische Jugendarbeit wieder zu installieren, weil die Aufgaben unmittelbar einleuchtend waren und die Menschen sich spontan zu ihrer Lösung zusammentaten, hat sich inzwischen ein hochkompliziertes organisatorisches Gefüge gebildet, das nur unter Einsatz erheblicher öffentlicher Mittel noch funktionsfähig erhalten werden kann. Die organisatorische Struktur ist so unübersichtlich geworden, daß politikwissenschaftliche Dissertationen über ihre Aufhellung vergeben werden könnten. Dabei ist nicht nur das, was die Organisationen im einzelnen tun, also die pädagogischen Inhalte, sondern darüber hinaus die Struktur der Organisationen selbst fragwürdig geworden.
130
Die Beziehungen zwischen dem Staat und den freien Trägern der Jugendarbeit sind nicht mehr selbstverständlich. Die Begriffe der "Defizitdeckung", des "Zuschusses", ja sogar der "Subsidiarität" drohen zur bloßen Rechtfertigung des Bestehenden zu werden, der keine überzeugende Kraft mehr innewohnt. Ähnlich fragwürdig ist das Verhältnis von Organisation und Organisiertem in den Jugendverbänden geworden. Hier wie überall in Großverbänden gilt der Widerspruch zwischen den Interessen der Mitglieder und dem Verbandsinteresse. Offenbar muß also eine Theorie der Jugendarbeit unter anderem eine Theorie ihrer Organisationsformen sein. Anders ausgedrückt: unsere Vorstellungen über Jugendarbeit stammen aus Organisationszusammenhängen, die noch die unmittelbare Kommunikation der Beteiligten zuließen. Wird der inzwischen eingetretene Widerspruch nicht theoretisch aufgehellt, dann droht er als Ressentiment die Jugendarbeit selbst zu zersetzen - sei es als Verdächtigung der Organisation oder als Verdächtigung dessen, was sich nicht organisieren lassen will. Anders ausgedrückt: Unsere gedanklichen Vorstellungen über die in der Jugendarbeit wirksamen Zusammenhänge haben nicht den Rang von Theorien, sondern sind Klischees geworden, Redensarten mit großen Worten ("Freiheit", "Bindung", "Gemeinschaft", "gesellschaftlicher Auftrag"), mit denen wir gedankenlos eine schlechte Praxis tarnen.
Theorie und Planung
Eine zweite Notwendigkeit für eine Theorie der Jugendarbeit ergibt sich aus ihrem Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Entwicklung im ganzen. In den Jahren nach dem Kriege war die Jugendarbeit so dynamisch wie die anderen Felder der Kulturarbeit auch. Inzwischen hat auch hier eine Besitzverteilung stattgefunden. Wer es bisher geschafft hat, an den öffentlichen Mitteln zu partizipieren, wird es wohl auch in Zukunft schaffen. Neulinge aber werden kaum noch in den Kreis der Beteiligten aufge-
131
nommen. Diese Situation, deren Diskussion vor allem im Zusammenhang mit der Novelle zum Jugendwohlfahrtsgesetz entbrannte, läßt sich aber nur dann vertreten, wenn man guten Gewissens sagen könnte, daß jede neue Trägerschaft und jedes neue Unternehmen der Jugendarbeit nur schon bereits Vorhandenes wiederholen würde, daß es also unökonomisch sei, neue Trägerschaften ins Uferlose hinein zu akzeptieren. Eine solche Meinung hätte wenig Evidenz für sich. Nicht zu Unrecht kann man vielmehr befürchten, daß eine derartig vollinstitutionalisierte Jugendarbeit risikoarm und experimentierunlustig wird, daß sie den Markt aufteilt, anstatt in der Konkurrenzsituation zu bleiben, die ihr bisher ihre Erfolge eingebracht hat. Deshalb die zweite Überspitzung: Theorie der Jugendarbeit ist nötig, weil der kultur- und erziehungspolitische Frieden in Zukunft nur durch eine sorgfältige und überzeugende jugendpolitische Planung erhalten bleiben kann.
Das öffentliche Unbehagen an den jugendpolitischen Grundsätzen bezieht sich nicht nur auf die Privilegierung bestimmter Trägergruppen - dafür gäbe es eine Reihe verwaltungstechnischer Argumente - sondern vor allem auf die inhaltlichen Ziele der Mittelvergabe. Die geförderten Aktivitäten erscheinen zum Teil sinnlos oder überflüssig, und erst deshalb mehrt sich der Verdacht der finanziellen Begünstigung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen. Selbst wenn man berücksichtigt, daß Richtlinien über die Zwecke der Mittelvergabe nur allgemein gehalten sein können, verraten sie doch allenthalben eine gewisse Dürftigkeit und Ahnungslosigkeit.
Wenn bestimmte pädagogische Experimente (Mädchenklubheime, Jugendfreizeitstätten) teilweise oder ganz mißlingen, dann ist das zwar generell ein dem Pädagogen bekanntes Risiko; wenn man aber vorher schon wissen konnte, daß sie aufgrund falscher Voraussetzungen mißlingen mußten, dann wird dies zu einem politischen Problem falscher Verwendung von Steuermitteln.
Angesichts des finanziellen und organisatorischen Umfangs der Jugendarbeit wird heute eine jugendpolitische Planung132
notwendig, die wiederum davon abhängt, ob es gelingt, eine Theorie der Jugendarbeit zu entwickeln. Planung und Theorie bedingen inander.
Theorie und Spontaneität
Die unumgänglich notwendige kulturpolitische Planung beschwört nun aber vollends eine Gefahr herauf, die sich im bisherigen Mechanismus der Organisationen und Verwaltungen längst bemerkbar gemacht hat: die Gefahr der totalen Vergesellschaftung der Jugendarbeit. Je übermächtiger die Vergesellschaftung wird, um so weniger Raum bleibt für die Spontaneität der pädagogischen Arbeit selbst, um so mehr droht sie zu verschulen. Deshalb die dritte Überspitzung: Theorie der Jugendarbeit ist notwendig als Unterstützung der Spontaneität und Dynamik, die sich angesichts der organisatorischen und kulturpolitischen Umklammerung nicht mehr von selbst einstellt: Theorie ist eine notwendige intellektuelle Waffe, um vor dieser Umklammerung auf Distanz zu kommen, um zu verhindern, daß der Widerspruch von Organisation und Organisiertem einseitig zugunsten der Organisation liquidiert wird.
Dieser Widerspruch gehört zu denen, die wir ertragen müssen, weil sie den möglichen Spielraum der Freiheit kennzeichnen. Das Postulat "planning for freedom" (Mannheim) weist darauf hin, daß die notwendige Planung ein Mittel ist, das einem bestimmten Ziele dient. Ohne Theorie verlieren sich die Ziele aus dem Blick, verwandeln sich die Organisationsformen aus Mitteln in autonome Ziele.
Nun ist ohne Zweifel der gegenwärtige ungeplante Zustand der Jugendarbeit - was nur die andere Seite seines untheoretischen Zustandes ist - keineswegs deshalb der Spontaneität zuträglicher als es der geplante wäre. Im Gegenteil: Bis in den Sprachgebrauch hinein werden pädagogische von verwaltungstechnischen Kategorien überfremdet ("Multiplikator"); zwischen den Organisationen
133
der Jugendverbände und ihren Jugendgruppen ist die Verbindung weitgehend abgerissen, so daß letztere ebenso wie in den Zeiten der Jugendbewegung in die Lage sektiererischer Gruppen zu geraten drohen. Die These, die Jugendverbände böten einen Übergang zwischen gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Horizonten, ist nur eine soziologische Konstruktion, weil sie tatsächlich bestenfalls für einige wenige Jugendliche gilt, die sich im Apparat nach oben arbeiten (vgl. Gerhard Wurzbacher: Gruppe - Führung - Gesellschaft, München 1961, vor allem S. 43 ff. und die Kritik von Fridolin Kreckl in "deutsche jugend" Juliheft 1963, S. 307 ff.). Nur dem ersten Augenschein nach agieren solche Gruppen spontan - da sie ja von der Organisation in Ruhe gelassen werden - in Wahrheit sind sie damit nur historischen und milieubedingten Klischees ausgeliefert. Produktive Spontaneität bedarf des planenden Anspruchs, an dem allein sie sich entzünden kann. Mit anderen Worten: Die umstrittene "Vergesellschaftung" der Jugendarbeit rührt nicht daher, daß die Jugendverbände im Gegensatz zu früher ihre Tätigkeit als einen "gesellschaftlichen Auftrag" empfinden. Wenn man mit der Formel vom "gesellschaftlichen Auftrag" den Eindruck erweckt, als habe die Loslösung der Jugendarbeit von den Vorstellungen der Jugendbewegung etwas mit geplanten und bewußten Entscheidungen der Verbände zu tun, die man in die untere Praxis umgesetzt habe, so täuscht man sich über den wahren Sachverhalt. Die Veränderungen sind vielmehr ausschließlich auf gesellschaftliche Veränderungen (Freizeit, Konsum usw.) zurückzuführen. Und jene Formel ist nicht etwa deshalb so gefährlich, weil damit eine bestimmte Absicht beschrieben wäre, sondern deshalb, weil sie überhaupt keine Intention zum Ausdruck bringt, es sei denn die, von dem offenbar übermächtigen Glanz der neuen Wirklichkeit durch die Anmaßung der Urheberschaft etwas abzubekommen.
134
Theorie als Traditionsersatz
Die Pädagogik der außerschulischen Jugendarbeit knüpfte nach dem Kriege fast bedingungslos an die Traditionen der Jugendbewegung und der Reformpädagogik an. Das schien aus vielen Gründen einleuchtend, nicht nur deshalb, weil die nationalsozialistische "Kanalisierung" diese pädagogischen Quellen zunächst einmal unbesehen wieder legitimierte. Die drängenden pädagogischen Aufgaben der ersten Nachkriegsjahre ließen sich zweifellos auch hinreichend auf diese Weise bewältigen. Die Jugendarbeit nach dem Kriege ging ebenso wie die sie unterstützenden Jugendpläne von einem "Notprogramm" aus. Dafür wurden die Mitarbeiter ausgebildet, die Jugendpläne entwickelt und die Jugendorganisationen geschaffen. Die Reformpädagogik und die Jugendbewegung sind ebenfalls von einer solchen Notpädagogik ausgegangen. Die Not der Arbeitslosigkeit, der hemmungslosen, nur vom Marktmechanismus diktierten Verstädterung, des geistigen und sozialen Elends der arbeitenden Jugend und der allgemeinen sittlichen Verwilderung waren damals die Ausgangspunkte.
In diesem unmittelbaren Sinne kann heute von einer Not der Jugend nicht mehr gesprochen werden. Eher besteht die Aufgabe der außerschulischen Pädagogik darin, zu einer "Luxuspädagogik" vorzustoßen. Politische Bildung etwa kann heute nicht mehr nur damit begründet werden, daß ohne sie die Demokratie in Gefahr sei, sondern eher damit, daß die zunehmende Bändigung der Not den Luxus erlaubt, daß die Massen sich politisch beteiligen, was sie zur bloßen Existenzerhaltung nicht mehr nötig haben. Musische Bildung kann sich nicht mehr allein verstehen aus der Erhaltung der im Arbeitsprozeß sonst verkümmernden Fähigkeiten, sondern eher schon aus der Hilfe dazu, daß man sich den Luxus kultureller Bildung leisten kann und will.
Eine Jugendarbeit, die sich die Kultivierung des Luxus zur Aufgabe macht - wobei die Pointierung nur die Akzent-
135
verschiebungen angeben soll - , kann sich aber nicht mehr auf ihre eigene Tradition berufen. Sie hat es, wie die moderne Freizeitpädagogik insgesamt, mit einer historisch neuartigen Problemstellung zu tun, auf die die bisherige pädagogische Tradition - jedenfalls soweit sie in der heutigen Jugendarbeit bewußt ist - keine Antworten geben kann, weil sie eben auch das Problem nicht kannte. In diesem Zusammenhang also wäre eine Theorie der Jugendarbeit notwendig als Traditionsersatz. Wenn es nicht gelingt, Theorie anstelle von naiver Tradition zu setzen, droht Jugendarbeit dem Diktat der vordergründigen Zweck-Mittel-Magie zu verfallen: der blinden Anpassung an kurzfristige und äußerliche Wünsche, Anforderungen und Aktivitäten, die mit ehemals richtigen Argumenten falsch begründet werden. Theorie muß dafür sorgen, daß naive zur reflektierten Tradition wird.
Die häufigsten Worte, mit denen die pädagogischen Aufgaben der Jugendarbeit umschrieben werden, sind: "Hilfe", "Not", "Gefährdung", "Verwahrlosung", "Schutz". Sie alle verraten etwas von dem ursprünglich berechtigten fürsorgerischen Impetus. So gewiß auch heute noch häufig genug Veranlassung besteht, Notsituationen pädagogisch zu bewältigen, so sicher ist andererseits, daß sie nicht mehr den Normalfall darstellen. Wenn wir etwa meinen, daß es eine Not der Jugendlichen gäbe, Herr über die übermächtigen Freizeitangebote zu bleiben, so ist das eine ganz andere Art von Not als die jugendlicher Flüchtlinge, jugendlicher Arbeitsloser oder ausgebeuteter Arbeiter. Die Not der klassischen Sozialpädagogik war immer die Not des sozial nicht Integrierten, des Abständigen, gesellschaftlich Unbrauchbaren, vielleicht würden wir heute sagen: des nicht Angepaßten. Heute hingegen handelt es sich eher umgekehrt darum, die Überanpassung der Jugendlichen zu entkrampfen. Dies aber wäre eben eine Pädagogik des Luxus und des Vergnügens: des Luxus, auch nicht angepaßt zu sein; nicht nur zu kaufen, wofür Reklame gemacht wird, nicht nur zu lernen, was nötig ist; nicht nur zu denken, was die Erwachsenen denken, und so weiter.
136
Mag man das nun Luxus nennen oder nicht, jedenfalls ist heute die pädagogische Praxis der Jugendarbeit nicht mehr durch methodische Variationen unter Beibehaltung der bisherigen Zielvorstellungen zu verbessern, sondern nur noch durch eine theoretische Befragung der Zielvorstellungen selbst. Wir sprechen in diesem Zusammenhang deshalb von Luxus, weil das damit Gemeinte nicht mehr nur auf das gesellschaftlich Notwendige - auf politische und ökonomische Leistungen etwa - ausgerichtet werden muß, sondern auf den Bereich des individuell Beliebigen zielen kann. Gerade dies aber ist im Hinblick auf die Masse der Jugendlichen pädagogisches Neuland; denn bisher sind die Kategorien der Freizeitpädagogik noch überwiegend an fremdbestimmten Leistungen orientiert: Erholung meint zum Beispiel Rekreation zum Zwecke besserer beruflicher Leistungen, die immer noch als die eigentlichen menschlichen und sozialen Leistungen gelten. Tätigkeiten hingegen, die sich nicht derartig ableiten lassen - sich vergnügen, faul sein, modisch sein, ein Hobby haben - gelten wie alles wirkliche Privatsein als verdächtig.
Diese Hinweise sollen genügen, um die Notwendigkeit einer Theorie schon für das bloße Funktionieren der Jugendarbeit zu beweisen. Mit welchen Grundproblemen hat sie es nun zu tun?
Theoretische Grundprobleme
Der Ort der Jugendarbeit im Erziehungsfeld des JugendlichenDie erzieherischen Wirkungen auf den Jugendlichen, also alle Wirkungen, die Verstand, Gefühl, Willen, Vorstellung und Verhalten beeinflussen, sind mannigfaltig und nahezu unbegrenzt. In diesem Sinne ist heute eine jede Wirklichkeit auch Erziehungswirklichkeit, weil jede gesellschaftliche und kulturelle Wirklichkeit an den Jugendlichen herangetragen werden kann und herangetragen
137
wird. Die politischen, gesellschaftlichen, betrieblichen, literarischen Einflüsse sowie vor allem die Massenmedien erziehen nicht minder - eher stärker - als die geplanten Erziehungsfelder wie Elternhaus, Schule und Jugendgruppe. Das Ganze der Jugenderziehung ist zwar noch vorstellbar und denkbar, nicht aber mehr in einer einzigen Erziehungsinstitution praktizierbar. Wir tun gut daran, die Pluralität der Erziehungsfaktoren so ernst wie möglich zu nehmen. Wir tun noch besser daran, den Begriff der "Erziehungswirklichkeit", der meist nur für die geplanten Erziehungsfelder gebraucht wird, so weit zu fassen, daß wir jede Wirklichkeit, die nachweislich erziehende Wirkungen hat, darunter subsumieren. Dann würden wir von einer Fülle von Erziehungseinflüssen ausgehen, die den Jugendlichen formen,
und von denen nur einige, vielleicht nicht einmal mehr die nachhaltigsten, der pädagogischen Planung offenstehen. Ohne uns näher vorzustellen, welche Erziehungsfaktoren in welcher Weise den Bildungsgang und die erzieherische Entwicklung des Jugendlichen heute beeinflussen und mitformen, können wir auch keine Ortsbestimmung der Jugendarbeit in diesem Feld der Einflüsse vornehmen. Wir müssen also die Summe dieser Einflüsse und damit das Ganze der Erziehung bedenken. Dafür bieten sich - ganz abstrakt - zwei Möglichkeiten an.Man kann versuchen, im direkten Zugriff den "erzogenen Menschen" sich denkend vorzustellen. Von einem solchen "Menschenbild" aus ergäbe sich dann Erziehung als deduktive Ableitung der Mittel und Wege, die der Verwirklichung des Bildes dienen. Dieser utopische Weg wäre zugleich notwendig und gefährlich: notwendig, weil man nur im Hinblick auf das Ganze des Menschseins - zudem in seiner vollendeten Form - über den Menschen menschenwürdig denken kann; gefährlich, weil das Bild über den wirklichen Menschen triumphieren und sein Anspruch ihn unentwegt vergewaltigen kann. Wir können diesen Weg nicht verfolgen, weil er - wenn überhaupt - nicht mit einigen wenigen Zeilen zu beschreiben wäre.
Wir können aber einen anderen, für unsere Zwecke hier
138
ausreichenden Weg einschlagen. Dabei gehen wir von den erziehenden Wirkungen aus, denen der heranwachsende Mensch tatsächlich unterworfen ist. Auf den ersten Blick bietet sich dann die Unterscheidung von pädagogisch geplanten und nichtgeplanten Einflüssen an. Diese Unterscheidung ist nicht rein durchzuhalten, weil auch die geplanten Einflüsse - Elternhaus, Schule, Jugendarbeit, Lehrbetrieb - viele ungeplante und unplanbare Elemente enthalten. Dennoch kann man sagen, daß alle gesellschaftlichen Einflüsse nicht pädagogisch, sondern nach ganz anderen Gesetzen - etwa denen des Marktes - strukturiert sind. Nun wissen wir, daß in zunehmendem Maße die Heranwachsenden durch diese nicht pädagogisch geplanten Faktoren geprägt werden - und zwar auch auf Gebieten, die herkömmlich den geplanten Situationen vorbehalten waren. "Weltkunde" leisten vor allem die Massenmedien, "Stilbildung" leisten weitgehend Mode und gesellschaftliche Vorbilder (Schauspieler), "Verhaltensbildung" beeinflussen die Gleichaltrigen (peer-groups). Auf manchen Gebieten (politische Information durch das Fernsehen) sind die gesellschaftlichen Institutionen den traditionellen Erziehungseinrichtungen eindeutig überlegen, auf anderen sind sie in eine attraktive Konkurrenz getreten (Stilbildung, Verhaltensbildung). Diese Entwicklung kann man für schlecht oder gut halten, aber man kann sie nicht ignorieren. In der Jugenderziehung wird man zunehmend fragen müssen, was an erzieherischer Prägung ohne geplante Pädagogik geschieht, bevor man die Inhalte der pädagogischen Planung sinnvoll fixieren kann. Auf die Jugendarbeit angewendet heißt das zu fragen, was ohne sie schon geschieht, oder besser, was nicht geschieht, aber geschehen müßte.
Theorie der Jugendarbeit ist also immer nur partielle Theorie, wiewohl sie in der beschriebenen Weise das Ganze der Erziehung im Blick haben muß. Von der Klärung ihres Standortes innerhalb des Erziehungsfeldes wird die Klärung ihrer Inhalte und Methoden entscheidend abhängen. Im Sinne der Pluralität, also der Nichtidentität der ver-
139
schiedenen Erziehungsfaktoren, kann eine Theorie der Jugendarbeit keine Reformtheorie für die anderen Erziehungsfaktoren sein. Der oft geäußerte Wunsch nach einer näheren Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendpflege hat wenig Überzeugungskraft. Er kommt weder der Selbstbesinnung der Schule noch der der Jugendarbeit zugute. Er versucht, was objektiv unmöglich ist, nämlich den notwendigen Verlust der Einheit der Erziehung auf institutionellem Wege wieder herzustellen. Dies wäre nur möglich in einer Gesellschaft, die einsinnige Vergesellschaftungen noch zuläßt. Daß dies nur noch mit Gewalt möglich ist, lehrt uns die DDR. Ähnlich sind alle Versuche zu sehen, die pädagogische Qualität des Fernsehens nur auf dem Umweg über das Schulfernsehen zur Kenntnis zu nehmen. Eine pädagogische Analyse des Fernsehens hat es dagegen zunächst immer mit einem prinzipiell nichtpädagogischen Feld zu tun.
Nicht-änderbare Bedingungen für die Jugendarbeit
Jedes Handeln, also auch das pädagogische, kann bestimmte Bedingungen herstellen, während andere als unabänderbar vorgegeben sind. Die möglichst genaue Ermittlung solcher Bedingungen und die Beschreibung ihrer Folgen für die pädagogische Praxis sind wichtige Leistungen der pädagogischen Theorie. Unter den verfassungsmäßigen und normativen Voraussetzungen unserer Gesellschaft scheinen mir folgende Bedingungen unabänderbar:
1. Jugendarbeit ist Teil des Freizeitsystems, weil unsere Gesellschaft die Jugendlichen nicht zwingen kann, an Maßnahmen der Jugendarbeit teilzunehmen. Da sie vielmehr in ihrer Freizeit an Veranstaltungen der Jugendarbeit teilnehmen, sehen sie diese Angebote unter ähnlichen Maßstäben, mit denen sie auch die übrigen Freizeitangebote bewerten. Dabei unterliegt die Jugendarbeit ökonomisch gesehen weitgehend industriellen Bedingungen: Sie muß für ihre Angebote "werben"; sie "steht in Konkurrenz" zu
140
anderen Angeboten der Jugendarbeit oder kommerzieller Freizeitunternehmen; sozialökonomisch gesehen ist der Unterschied nur der, daß sie aus pädagogischen - oder vorgeblich pädagogischen - Motiven staatlich subventioniert wird. Die sich aus diesem Tatbestand ergebenden Folgerungen sind mehrdeutig. Einmal können sie dazu führen, mit den Methoden auch die Inhalte "industriell zu manipulieren", wie überhaupt der vordergründige Methodismus in der Jugendarbeit hier wohl eine Ursache hat. Andererseits eröffnet dieser Bezug auch die Möglichkeit eines realistischen pädagogischen Selbstverständnisses: Das kritische Verständnis der gesellschaftlichen Umwelt wird leichter, je genauer die eigene Verflochtenheit mit ihr eingesehen wird.
Alle Institutionen der Jugendarbeit sind durch den Widerspruch von "Unternehmen" und "pädagogischer Anstalt" gekennzeichnet. Mit diesen Begriffen, die an einer Untersuchung der Jugendhöfe entwickelt wurden, die aber prinzipiell für alle Unternehmen der Jugendarbeit, wenn auch in verschiedener Weise, gültig sind, hat Heinz Hermann Schepp auf die pädagogischen Implikationen der Organisationsformen hingewiesen und sie damit auch in den Horizont der genuin pädagogischen Betrachtung gerückt (Heinz Hermann Schepp Offene Jugendarbeit, Weinheim 1963, vor allem S. 154 ff.). Als Unternehmen unterliegen diese Institutionen den Strukturgesetzen des Marktes, als pädagogische Anstalt denen des geplanten Erziehungsfeldes. Die eine Seite muß die andere beschränken. Überläßt man diesen Widerspruch dem Mechanismus der Dinge selbst, so werden die ökonomischen Gesetze des Marktes einseitig herrschend. Dann wäre Jugendarbeit nichts anderes als ein Teil staatlich subventionierter Freizeitindustrie.
2. Jugendarbeit basiert auf der Freiwilligkeit der Teilnahme. Diese Bedingung folgt eigentlich aus der ersten und ist der wesentliche Grund dafür, daß in der Jugendarbeit die Jugendlichen selbst eine mitbestimmende Rolle bekommen haben. Während es für die Existenz einer Schule
141
nicht entscheidend ist, ob sie autoritär oder kooperativ geleitet wird, werden die meisten Jugendlichen einer Maßnahme der Jugendarbeit fernbleiben - und damit die Existenz des Trägers gefährden - wenn sie in ihr nicht als gleichberechtigte Partner von den Erwachsenen ernst genommen werden. Diese Bedingung ist bis in die kooperative Methodik, wie sie in der Jugendarbeit vorherrscht, eingedrungen. Es tut der gesellschaftsfeindlichen Betrachtungsweise mancher Pädagogen gut, wenn sie daran erinnert werden, daß primär nicht pädagogische Intentionen, sondern gesellschaftliche Wandlungen die "freie Jugendarbeit" ermöglicht haben.
3. Die Jugendarbeit vergibt im allgemeinen keine Zeugnisse und sonstige Leistungsbenotungen, die für den sozialen Status der Jugendlichen von Belang wären. Im Vergleich zu Elternhaus, Schule und Betrieb hat die Jugendarbeit relativ wenig Macht über den Alltag der Jugendlichen. Dadurch bestimmt sich aber auch die Qualität des pädagogischen Umgangs. Die Beziehungen zwischen erwachsenen Pädagogen und den Jugendlichen können relativ wenig fremdbestimmt, verhältnismäßig wenig von äußeren Ansprüchen diktiert sein. Wichtiger ist vielleicht noch, daß die Beziehung mehrdeutig und widersprüchlich wird. In der Jugendarbeit tritt der Erwachsene den Jugendlichen nicht in einer verengten Rolle - als Lehrer, Leiter, Chef - sondern in mehreren Rollen gegenüber: als Erwachsener, als gesellschaftlicher Partner, als Mann oder Frau, als Freund, als Fachmann, als interessierter Laie. Je nachdem, um welche Rolle es sich dabei handelt, ändert sich auch die Art der Beziehung.
4. Jugendarbeit ist eine unstete Erziehungsform. Weitreichende Planungen, etwa unterrichtlicher Art, sind wegen der Fluktuation der Teilnehmer nicht möglich.
5. Jugendarbeit ist eine phasenspezifische Erziehungsform. Sie wendet sich an Jugendliche, also im Gegensatz zur Erwachsenenbildung nur innerhalb eines begrenzten zeitlichen Rahmens an den Menschen. Schon deswegen sind ihr längere Planungen kaum möglich.
142
Zur Zielsetzung der Jugendarbeit
Erst auf diesem Hintergrund ist es sinnvoll, Zielvorstellungen für die Jugendarbeit zu entwickeln. Auch hier müssen wir uns kurz fassen.Jungsein und Erwachsenwerden
Die Einsicht Rousseaus, daß das jugendliche Dasein nicht nur vorbereitenden Charakter im Hinblick auf das Erwachsenwerden, sondern zugleich einen eigenständigen Sinn habe, darf nicht falsch angewandt werden. Rousseau hat seine Forderung in einer bestimmten Zeitsituation gegen einige darin - ebenso wie er - verstrickte Gegner formuliert.
Sein Problem stellt sich uns heute gar nicht mehr in dieser Weise. Es ist selbstverständlich, daß wir alle immer zugleich in der Erfüllung des Augenblicks leben wollen, wie wir andererseits von unserer Entwicklung wissen, und das heißt, daß die Gegenwart zu einem guten Teil ihre Erfüllung erst in der Zukunft findet. Es scheint mir auch nicht ausgemacht, daß Jugendliche ihre Gegenwart grundsätzlich intensiver erleben als Erwachsene. Gerade in der Freizeitgesellschaft verwischen sich hier die Grenzen zwischen den Generationen. Es widerspricht also nicht der Grunderkenntnis Rousseaus, wenn wir formulieren, daß das Ziel aller Erziehung nicht das Jungsein, sondern das Erwachsenwerden in einer konkreten gesellschaftlichen Situation ist.
Überall in pädagogischen Zusammenhängen geht es primär um Lernen, und Lernen geschieht immer im Hinblick auf Ernstsituationen, also letztlich auf die Erwachsenenwelt. Dabei leben die Jugendlichen heute, wie ein Blick auf die Faktoren des Erziehungsfeldes verrät, zugleich in Lern- und Ernstsituationen, so daß man eigentlich nicht mehr von einem zeitlichen Nacheinander von Lernen und Anwendung des Gelernten sprechen kann. Daß Lernen nur Freude macht, wenn es auch im Augenblick Vergnügen
143
bereitet, ist ein übereinstimmendes Ergebnis aller Lernforschung, das uns aber nicht dazu verführen darf, die Eigenständigkeit der Jugendphase überzubetonen.
Damit sollen keineswegs die bekannten soziologischen und psychologischen Besonderheiten des jugendlichen Daseins geleugnet werden. Wenn die Pädagogik im allgemeinen und die Jugendarbeit im besonderen den Blick einseitig auf diese Momente der Eigenständigkeit richten und zum Beispiel zum Zwecke des Ausreifens Befreiung von allzu früher gesellschaftlicher Inanspruchnahme für das Jugendalter fordern, dann laufen sie Gefahr, alle Wünsche und Sehnsüchte, die in der Erwachsenenwelt tatsächlich oder angeblich nicht zu verwirklichen sind, auf die Jugendwelt zu transponieren und damit die Verhältnisse der Erwachsenenwelt unbehelligt zu lassen. Man sagt mit Recht, die Jugendbewegung habe für die kommenden Jugendgenerationen das Recht auf Eigenständigkeit und Schutz vor allzu früher gesellschaftlicher Inanspruchnahme durchgesetzt. Wenn man aber nun mit Hermann Mau (Die deutsche Jugendbewegung. Rückblick und Ausblick, in: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte, I, 1948) die Jugendbewegung geschichtlich in die Reihe der allgemeinen Emanzipationsbewegungen einordnet, wäre dann nicht die Überlegung angebracht, daß die Jugendbewegung ihr Postulat nach zeitweiliger Freiheit von fremdbestimmten Einflüssen nicht nur für alle kommenden Jugendgenerationen, sondern darüber hinaus für die Erwachsenenwelt insgesamt erhoben habe? War nicht vielleicht dies, gewollt oder ungewollt, letztlich ihr historischer Ertrag? Beginnt nicht ein solches Bedürfnis sich im Freizeitleben der Erwachsenen bereits Bahn zu brechen? Ist andererseits die Betonung der jugendlichen Eigenständigkeit bei uns nicht auch ein nur mühsam kaschierter Versuch, die junge Generation möglichst lange von wirklicher gesellschaftlicher Verantwortung und Einflußnahme abzuhalten?
Für die Jugendarbeit liegt die pädagogische Kernfrage also nicht darin, wie sie der Jugend helfen könne, zu jugendeigenen Stilen und Formen zu finden - dies kann
144
sie getrost der jugendlichen Spontaneität überlassen und sollte sie nicht verhindern. Die Kernfrage lautet vielmehr, welchen spezifischen Beitrag die Jugendarbeit zum Erwachsenwerden leisten könne. Schon gar nicht verfügt die Jugendarbeit über jugendeigene Gegenstände. Inhalt der Arbeit ist vielmehr die Wirklichkeit der Erwachsenenwelt, die ja heute fast vollständig die der Jugendlichen geworden ist. Es ist ein Fehler, daß mancherorts etwa der musischen Bildung die Position einer Maßnahme eingeräumt wird, die die jugendliche Eigenständigkeit fördern und ihr zu bestimmten Formen verhelfen könne. Pädagogisch ertragreich kann musische Bildung hingegen nur sein, wenn sie auch die Transposition ins spätere Erwachsenenleben übersteht. Erwachsene können der Jugendgeneration nicht bestimmte Inhalte und Methoden liefern, damit diese sich in jugendeigener Weise kultivieren kann.
Die "pädagogische Provinz" der Jugendarbeit
Wie jedes geplante Erziehungsfeld so ist auch die Jugendarbeit eine Variante der pädagogischen Provinz: Sie ist nie ganz und nur Ernstsituation. Sie bietet dem Jugendlichen einen gewissen Schonraum, in dem er mit Meinungen und Verhaltensweisen experimentieren kann, ohne daß er gleich beim Wort genommen wird, ohne daß er in voller Tragweite für Meinungen und Verhalten einstehen muß. Andererseits hat die Jugendarbeit in unterschiedlichem Maße den Schonraum verlassen, am weitesten vielleicht bei dem Typ des Jugendlichen, der schon Verantwortung in einem größeren gesellschaftlichen Zusammenhang, etwa eines Jugendverbandes, übernommen hat.
Hier ist nun der Ort, noch einmal auf die Bedeutung der Organisation für die pädagogische Arbeit zurückzukommen. Neben der rein technischen Bedeutung - Verteilung der Mittel, öffentliche Verantwortung der Mittel usw. - hat sie auch eine unmittelbare pädagogische Bedeutung. Ohne eine Organisation, die stark genug ist, sie zu protegieren, kann in unserer Gesellschaft keine pädagogische
145
Provinz mehr existieren. Die Veröffentlichung der privaten Bereiche, die durchgehende Politisierung aller gesellschaftlichen Bereiche und damit zusammenhängend der Konformismus der alltäglichen Rollenerwartungen haben ein allgemeines Klima heraufbeschworen, in dem Privatsein ohne Kontrolle der Umwelt, Begegnung mit nicht schon funktionalisierter - vor allem ökonomisierter - Kultur, nicht angepaßtes Verhalten und Distanzierung von der Unmittelbarkeit des Daseins kaum noch spontan möglich sind. Die Räume dazu müssen paradoxerweise von der Organisation, die sie einstmals zertrümmerte, wieder neu geschaffen und geradezu verteidigt werden. Einer dieser Räume ist die pädagogische Provinz. Sie wird heute nicht mehr von jenen lokalen Jugendgruppen repräsentiert, die stolz darauf sind, keiner Organisation anzugehören und dabei übersehen, daß sie - schon mangels finanzieller Mittel - notwendig in eine eigenbrötlerische Sektiererrolle geraten. Sie wird aber auch nicht garantiert von jenen Jugendverbänden, die bei der Feststellung, ein eigenes Jugendreich werde nicht angestrebt, vielleicht nicht bemerken, daß ihre Organisation möglicherweise die ohnehin schon vorhandenen Formen der bloßen Vergesellschaftung nur um eine weitere vermehrt. Aufgabe der Organisationen der Jugendarbeit ist vielmehr, für die pädagogische Provinz in ihren Bereichen einzutreten, und das heißt: für Experimente, für das Risiko, das jedem Lernen innewohnt, für die Kritik auch an dem, der das Geld gibt, für die Kritik an der eigenen Organisation. Nur in einem solchen Zusammenhang kann von einer pädagogischen Aufgabe der großen Organisationen gesprochen werden, und nur so behalten sie das moralische Recht, im Gegensatz zu anderen gesellschaftlichen Großverbänden subventioniert zu werden. Daß Erwachsenenverbände für sich um Nachwuchs werben, ist allein noch kein Grund für eine pädagogisch motivierte staatliche Subvention.
146
Die Erziehungsdefizite
Wenn man sich klar macht, daß historisch gesehen die Jugendarbeit neben der Schule die jüngste gesellschaftlich institutionalisierte Erziehungsform außerhalb des Elternhauses ist, dann hat es erst recht einen Sinn zu fragen, welche Defizite denn auftraten, die in den anderen Erziehungsfeldern offenbar nicht beglichen werden konnten und zu deren Deckung Jugendarbeit notwendig wurde. Dabei muß man sich allerdings von der Vorstellung freimachen, als ob die ursprünglich in der Familie zusammengefaßte Einheit der Erziehung sich lediglich arbeitsteilig differenziert habe. Das ist bestenfalls logisch richtig, aber nicht historisch. Diese Vorstellung enthält nämlich die weitere Annahme, daß im Grunde auch heute noch die Familie prinzipiell alle wesentlichen Erziehungsaufgaben leisten könnte, wenn man sie nur dazu in den Stand setzte. Hier wird aber übersehen, daß es sich in Wahrheit darum handelt, daß im Zuge der geschichtlichen Entwicklung ganz neue Erziehungsprobleme aufgetaucht sind, die es früher nicht gab und die daher die Familie auch früher nie hat lösen müssen. Wir haben dieses Problem schon mit unserer These von der Nicht-Identität der heutigen Erziehungsfaktoren berührt.
Wenn wir nun im folgenden solche Defizite anvisieren, dann kann das sehr mißverständlich klingen. Wir sind nämlich genötigt, nun idealtypisch von "der Schule", "dem Elternhaus", "der Jugendarbeit" und "der Massenkommunikation" zu sprechen. Es kann sich dabei in der Tat nur um Akzente oder auch um Trends handeln, die im Einzelfall vielleicht sich gar nicht mit der Wirklichkeit decken. Mit dieser gehörigen Einschränkung darf man wohl sagen, daß folgende Defizite sich in der gegenwärtigen Jugenderziehung gezeigt haben.
Sozial folgenloses Meinen und Verhalten. Wer lernen soll, muß Fehler machen dürfen. Diese Einsicht läßt sich auch umkehren: Wer keine Fehler machen darf, verliert auch
147
die Lust zum Lernen. Es ist einer der wesentlichen Grundgedanken der pädagogischen Provinz, daß sie ein zubereiteter Raum ist, in dem Verhaltensweisen und Meinungen geübt werden dürfen und können. Suchen wir unsere Gesellschaft und auch ihre pädagogischen Felder daraufhin nüchtern ab, so müssen wir feststellen, daß es solche Räume kaum noch gibt. Selbst die öffentliche Schule bietet sie in weit geringerem Maße, als man das vorweg annehmen könnte. Ihre soziologische Stellung als Verteilerin sozialer Chancen, ihr damit verbundener Leistungsdruck schränken die Möglichkeit des Durchprobierens von Meinungen und Gedanken sehr erheblich ein. Ähnliches gilt im Normalfall von jenen Jugendlichen, die schon im Arbeitsleben stehen und sich in der Berufsausbildung befinden. Hier kann man sogar sagen, daß eine das unmittelbare Berufsleben übersteigende Souveränität des Urteilens gar nicht erwartet wird, so daß diese Jugendlichen es von sich aus vernünftigerweise auch gar nicht entwickeln. Da die Jugendarbeit von ihren Bedingungen her wenig unter dem Druck äußerer Ansprüche steht, liegt im Aufgreifen dieses Defizits eine ihrer besonderen Chancen und Verpflichtungen. Daß es sich hier in der Tat um einen Mangel handelt, muß selbst denen einleuchten, die sonst einer Anpassung der Erziehung an die Gesellschaft das Wort reden; denn die Fähigkeit, souverän zu urteilen, dürfte eine der Voraussetzungen dafür sein, daß jemand überhaupt in der Lage ist, sich auf wechselnde Situationen und Ansprüche produktiv einzustellen. Ähnliches gilt für das Experimentieren von Verhaltensweisen. Auch dafür haben normalerweise die Schule und das Elternhaus einen viel zu geringen Spielraum. Die Schule steht dabei vor allem unter dem Druck der bürgerlichen Umgebung. Die Misere der zensierten Schülerzeitungen ist dafür nur ein Beispiel unter vielen.
Auch die Jugendarbeit steht in der Gefahr, den ihr noch möglichen gesellschaftlichen Spielraum aufzugeben. Die Leichtfertigkeit, mit der man etwa politisch unbequemen Jugendorganisationen die Mittel entzieht, wird nur noch
148
durch die Leichtfertigkeit derjenigen übertroffen, die sich dem nicht solidarisch widersetzen. In solchen Maßnahmen ist das Gespür dafür verloren gegangen, daß die Souveränität des selbständigen Urteilens und Denkens auch einer gewissen radikalen Phase bedarf.
Soziale Geborgenheit. Viele Jugendliche finden den Weg zur Jugendarbeit, weil sie dort eine Art "sozialer Heimat" suchen, die ihnen offenbar sonst nur noch in den peergroups außerhalb der Jugendarbeit gewährt wird. Man weiß, daß die Schulklasse heute immer weniger auch den außerschulischen Freundeskreis stellt. Ebensowenig kann die Familie das Bedürfnis nach sozialer Intimität allein erfüllen. Die Begründungen für diesen Wandel sind in der Jugend- und Familienforschung weitgehend erbracht worden. Wir sehen jedenfalls, daß die Jugendlichen ihre persönlichen Probleme lieber mit Gleichaltrigen als mit den ihnen nahestehenden Erwachsenen erörtern.
Der soziale Ort dafür ist unter anderem die Jugendgruppe in der Jugendarbeit. Man kann wohl mit Recht vermuten, daß die Unausrottbarkeit der Jugendgruppe eng mit diesem Bedürfnis zusammenhängt. In der Gruppe der Gleichaltrigen darf man Meinungen und Urteile wagen. Macht man Fehler, so helfen einem die anderen, sie wieder wettzumachen. Das Maß an Emotionalität, das in dem Wort "Geborgenheit" liegt, sollte man sehr ernst nehmen.
Das Bedürfnis, in einer Umgebung von Gleichgesinnten und Freunden aufgehoben zu sein, denen man sich anvertrauen und mit denen man sich aussprechen kann, ist kein spezifisch jugendliches, sondern ein allgemein menschliches. Aber für Jugendliche hat es deshalb eine besondere Bedeutung, weil sie besonders zahlreiche und heftige persönliche Konflikte in der Reifezeit bestehen müssen. Solidarität finden sie naturgemäß bei denen, die die gleichen Sorgen haben. Wir können die Bedeutung solcher Gruppen für die in diesem Alter fälligen Urteile und Entscheidungen gar nicht hoch genug einschätzen - wenn wir die amerikanische Bezugsgruppenforschung hier sinngemäß
149
übertragen (vgl. Albert K. Cohen, Kriminelle Jugend, Hamburg 1961, rde). Gelingt es einem Erwachsenen, unter Verzicht auf fremdbestimmte Autorität in das Vertrauen einer solchen Gruppe einbezogen zu werden, kann er in einem Maße auf Urteile und Entscheidungen einwirken, wie in keiner anderen Erziehungssituation sonst.
Nicht-intime Kommunikation. Die "Erziehung zur Gemeinschaft" gilt in der Jugendarbeit auch heute noch als das wesentliche, wenn nicht gar ausschließliche Ziel der Sozialerziehung. Dies mochte in bestimmten historischen und gesellschaftlichen Situationen sinnvoll und sogar unerläßlich sein. Heute hingegen besteht das Problem der jugendlichen Sozialerziehung nicht mehr darin, gemeinschaftsfähig, sondern gesellschaftsfähig zu machen. Die Skala der für das Zusammenleben der Erwachsenen nötigen Verhaltensweisen reicht heute von den sehr intimen bis zu den sehr distanzierten. Auf die Bedeutung der nichtgemeinschaftlichen Verhaltensformen im Hinblick auf eine recht verstandene Sozialerziehung hat Theodor Wilhelm immer wieder hingewiesen (zum Beispiel in seinem Aufsatz "Zum Begriff Sozialpädagogik" in Zeitschrift für Pädagogik, 1961). Darüber hinaus hat er auch Gründe für die Blindheit der deutschen pädagogischen Tradition im Hinblick auf dieses Problem angeführt ("Sozialisation und soziale Erziehung", in: Gerhard Wurzbacher, Der Mensch als soziales und personales Wesen, Stuttgart 1963). Die intimen und die relativ intimen Sozialformen - die wir hier die gemeinschaftlichen nennen wollen - werden in der Familie, in der Schule, in der Jugendgruppe und im Freundeskreis von selbst gelernt. Was den Jugendlichen immer offensichtlicher fehlt, ist das Lernen distanzierterer Sozialbeziehungen, die eben nur in entsprechenden Sozialsituationen gelernt werden können.
Die überlieferte Pädagogik hat kein angemessenes Modell für eine Sozialerziehung geschaffen, die die breite Skala der erforderlichen Verhaltensweisen berücksichtigt hätte. Das hängt nicht zuletzt mit der Affinität zur pädagogi-
150
schen Provinz zusammen, in der notwendigerweise gemeinschaftliche Sozialformen den Vorrang haben. Genauso aber, wie im Inhaltlichen die Beziehung des "Fundamentalen" und "Elementaren" zur Wirklichkeit immer problematischer wird, genauso wird die Hoffnung, man könne gesellschaftliche Verhaltensweisen auf gemeinschaftliche hin "elementarisieren", immer trügerischer. Das zeigen Ernstsituationen wie der Jugendtourismus, wo sich geradezu ein Zusammenbruch der Kommunikationsfähigkeit anbahnt, wenn die bekannten gemeinschaftlichen Formen nicht mehr zu realisieren sind.
Nun wird hier vielfach eingewendet, die Jugendlichen wollten selbst unter sich sein und gemeinschaftlich miteinander verkehren, so daß es schwer fiele, sie zur Bewältigung nicht-gemeinschaftlicher Situationen zu ermuntern. Das ist keineswegs überraschend: Niemand lernt gerne etwas Neues, solange das Bekannte zur Meisterung einer Situation ausreicht. Wie man Jugendliche dazu gewinnt, ist eine Frage der Methode. Hier, wo es zunächst ums Grundsätzliche geht, sei nur festgehalten: Das entscheidende Defizit der jugendlichen Sozialerziehung liegt nicht dort, wo es heute in der Jugendarbeit fast überall noch vermutet wird, sondern gerade am entgegengesetzten Pol der notwendigen sozialen Verhaltensweisen.
Wenn diese Aufgabe einmal begriffen ist, hat gerade die Jugendarbeit nahezu unbegrenzte methodische Möglichkeiten zu ihrer Lösung. Das Elternhaus leistet sie nur noch in Ausnahmefällen. Im allgemeinen ist der gesellschaftliche Kontakt der Familien heute auf einen engen Kreis von Vertrauten beschränkt. Auch die Schule kann sie immer nur zum Teil, nämlich im Zusammenhang ihrer unterrichtlichen Planung, angehen.
Man hat gerade auch im Zusammenhang der musischen Bewegung versucht, neue Stile des Zusammenlebens von der musisch gestimmten Gemeinschaft her zu entwickeln. Der Hauptfehler lag darin, daß man sich dabei historisch an gemeinschaftliche gesellschaftliche Vorbilder anlehnte. Heute hingegen ist der Stil des Umgangs nur in einer dif-
151
ferenzierten Skala von Verhaltensweisen zu gewinnen: Gerade die distanzierten Formen sind stilbildend.
Das ist besonders bedeutsam für den Umgang der Geschlechter: "Charme" und "Flirt" sind ja gerade distanzierte Formen des Umgangs. Sie sind nicht von selbst da, sondern müssen gelernt werden, und sie werden eben nur in entsprechenden, Distanz erfordernden Situationen gelernt. Gerade das Dilemma unserer sexualpädagogischen Maßnahmen läßt dieses Defizit voll in den Blick treten. Ob man dabei auf die Kraft rationaler - vor allem medizinischer - Aufklärung vertraut, oder auf triebvergessende Aktivitäten baut, fast immer geht man dabei von einem recht platten biologistischen Triebmodell aus. Daß die viel näher liegende Frage der sozialen Anerkennung gegenüber dem anderen Geschlecht auch eine Rolle spielen könne, entgeht einer Jugendarbeit, der schon aufgrund dieses biologistischen
Modells erotisch durchtönte Umgangsstile verdächtig sein müssen und die nicht sehen kann, daß die gemischte Gruppe im Verhältnis zur gleichgeschlechtlichen eine fundamental verschiedene Sozialsituation darstellt, die ganz anderer Strukturen und Ziele bedarf.Das Bedürfnis nach gruppenhafter Intimität muß man auch noch von einem anderen Gesichtspunkt in den Blick nehmen. Es hängt nämlich eng mit der pluralistischen Wertstruktur unserer Gesellschaft zusammen. Der Mythos von der "Gemeinschaft" war in der jüngsten deutschen Geschichte immer eng verbunden mit dem oft geradezu haßerfüllten Widerstand gegen eine Gesellschaft, deren normative Leitbilder nicht mehr eindeutig, sondern mehrdeutig, eben pluralistisch wurden. Lediglich in jener Gruppe der Gleichgesinnten ließ sich die Illusion von der "heilen", und das hieß immer "eindeutigen" Welt noch aufrecht erhalten, die in Wahrheit durch den gesellschaftlichen Prozeß längst untergraben war. Insofern wohnt bis auf den heutigen Tag der Absolutsetzung gemeinschaftlicher Sozialformen ein totalitärer Zug inne, eine Neigung zur Intoleranz und intellektuellen Beschränktheit.
Nun kann es nicht darum gehen, die intimen Sozialformen
152
alternativ gegen die distanzierten auszuspielen, sondern darum, beiden ihr Recht zu geben und zugleich ihre Grenzen aufzuzeigen. Denn so richtig es ist, daß die Pluralität der Weltanschauungen und Werte nun einmal besteht, so richtig ist es andererseits, daß wir - und sei es nur von Fall zu Fall und auf Zeit - Eindeutigkeiten brauchen, um in dieser Welt leben zu können. Dabei legt die Sozialforschung die Vermutung nahe, daß solche Eindeutigkeiten in bestimmten intimen Sozialbezügen kommunikativ hergestellt werden.
"Sinnvolle Aktivität". Man hat immer wieder betont, daß die Jugend heute selbst in den pädagogischen Feldern nur noch einseitig beansprucht werde und sich damit auch einseitig entwickele: Die Schule, insbesondere die höhere, stelle vorwiegend intellektuell-literarische Erwartungen, die Berufsausbildung dagegen diene nur der Ausbildung bestimmter beruflicher Fähigkeiten; die Arbeitswelt lasse vollends die meisten Fähigkeiten und Fertigkeiten verkümmern. Zur jugendlichen Reifung gehöre aber die Entwicklung und Erprobung wenn nicht aller, so doch möglichst aller Begabungen, Fertigkeiten und Fähigkeiten.
Hier hat die Jugendarbeit schon in ihren ersten Anfängen eine ihrer Hauptaufgaben gesehen. Sie ist dabei manchen Irrtümern und Verstiegenheiten erlegen, indem sie eine falsche Anthropologie zugrunde legte oder aber ihre Bemühungen aus dem allgemeinen gesellschaftlichen und kulturellen Zusammenhang herausriß. Davon abgesehen aber bleibt der richtige Anspruch, als Korrektiv gegen die geschilderten Vereinseitigungen der Erziehung aufzutreten. Dieser Anspruch muß jedoch präzisiert werden, um das Leitbild des "aktiven Jugendlichen" nicht zum Fetisch werden zu lassen: Was kann "sinnvolle Aktivität" heißen?Sie ist immer gebunden an eine sinnvolle Situation, die zu meistern ist. Gerade die Jugendarbeit hat die Möglichkeit, die verschiedenartigsten Situationen herbeizuführen, in denen vernünftiges Handeln geübt werden muß, weil
153
es zur Lösung der Situation notwendig ist. Wo die Situation selbst nicht dazu auffordert, Aktivität zu entfalten, oder wo sie so banal ist, daß sich Aktivität nicht lohnt, ist sie sinnlos.
Dabei ist zu bedenken, daß die Erfahrungen, die bei der Lösung solcher Situationen gemacht werden, zunächst einmal nicht übertragbar sind auf den politisch-gesellschaftlichen Bereich. Wer in einer Gruppensituation vernünftige Aktivität und Initiative entwickelt, kann in politisch-gesellschaftlichen Fragen falsch orientiert sein und wird es schon in dem Augenblick, wo er glaubt, seine von der Unmittelbarkeit der Situation her entworfene Aktivität habe Modellcharakter fürs politische Lernen. Eine Aktivität des Tuns ist also nicht eo ipso schon eine pädagogische Aktivität, sondern erst dann, wenn die Aktivität des Denkens hinzukommt, wenn dabei auch gelernt wird, Tätigkeiten und Erfahrungen zu reflektieren und zu objektivieren.
Außerdem muß die zu bewältigende Situation erfolgversprechend sein, sie darf keine grundsätzliche Überforderung enthalten. Dies aber ist gerade vielfach der Fall, wenn man Jugendliche zu Gruppenleitern macht und zudem von ihnen die Durchführung ganzer Bildungsprogramme erwartet. Die Folgen bleiben nicht aus: Der Überforderte greift, um einen letzten Rest von Selbstbewußtsein zu erhalten, zu Klischees, mit denen er sich und die anderen erklärt. Auf diese Weise produziert Jugendarbeit gerade das, was sie ihrer Intention nach beseitigen will: soziale und kulturelle Ressentiments.
Schließlich ist zu bedenken, daß jugendliche Aktivität, wenn sie allzu früh von gesellschaftlichen Organisationen in Anspruch genommen wird, Erfahrung und Reflexion nicht fördert, sondern verhindert. Jener Jugendliche, der von seiner Tätigkeit in einem Verband so in Anspruch genommen wird, daß sie einer zweiten Berufstätigkeit gleichkommt, lernt in Wahrheit gar nichts, sondern vergeudet seine Lernenergie. Frühe und engagierte Mitgliedschaft in gesellschaftlichen Verbänden ist also eher das Gegenteil
154
eines Beweises politischer und gesellschaftlicher Reifung. Lediglich in geschichtlichen Krisensituationen wie nach 1918 und in den ersten Jahren nach 1945 mag es politisch notwendig sein, frühe gesellschaftliche Aktivität einer jugendlichen Elite zu fordern. Die Vielfalt der angebotenen Aktivitätssituationen ist schon eher ein pädagogischer Maßstab als ihr politisch-gesellschaftlicher Effekt. Es kommt darauf an, möglichst vielartige Leistungen auszuprobieren, um möglichst genau die eigenen Interessen und Fähigkeiten zu erkennen. Auch diese Aufgabe kann die Schule als Halbtagsschule nur zum Teil erfüllen. Je früher die Gesellschaft oder einzelne Verbände ein verbindliches Engagement und damit wiederum einseitige Leistungen der Jugendlichen erwarten, um so eher zerstören sie eine Potenz, die ihnen später zur Verfügung stehen könnte.
Auseinandersetzung mit individuellen und kollektiven Konflikten. Die herkömmlichen Erziehungsfelder führen nicht oder nicht genügend in die politische und kulturelle Wirklichkeit ein. Das hängt bei der Schule etwa mit den Bedingungen des Lehrplans und Lehrgangs zusammen. Wo die Begegnung mit der Welt vorwiegend auf dem Wege der Unterrichtung geschieht, gewinnen die Bedingungen des langfristigen und geplanten Unterrichtens notwendig die Oberhand über die jeweiligen individuellen und kollektiven Lebensprobleme. Die Welt muß um der Systematik des Unterrichts willen ebenfalls systematisiert werden. Sie wird in horizontale und vertikale Stufungen aufgeteilt, die dann teilweise den fachwissenschaftlichen Perspektiven entsprechen. Die von den individuellen und kollektiven Lebensproblemen (etwa den politischen) ausgehende Systematisierung der Welt - wenn man davon überhaupt noch sprechen darf - ist ganz anderer Art, kann aber offenbar nicht zur methodischen Grundlage eines langfristig angelegten Unterrichts gemacht werden. Didaktische Übertreibungen dieser Schwierigkeit können sogar dazu führen, daß dem Schüler nur noch eine Art Derivat der Wirklichkeit im Unterricht begegnet, zum
155
Beispiel nicht mehr Literatur, sondern nur noch moralisches "Gedankengut".
Untersuchungen legen die Vermutung nahe, daß Jugendliche heute vor allem durch Fernsehen und Film in die Konflikte von Kultur und Gesellschaft eingeführt werden - auf eine oft nicht unproblematische Weise, die wir hier nicht erörtern können. Film und Fernsehen haben aber in der Jugendarbeit nicht zuletzt deswegen eine so große Bedeutung gewonnen, weil sie an Konflikten orientierte Einstiege sowohl für Lebensfragen wie für politische und kulturelle Diskussionen bieten, wie überhaupt der journalistische Aufbau der Stoffe dem des Unterrichts diametral entgegensteht, wovon die Pädagogik viel zu wenig profitiert hat.
Förderung spezifischer Begabungen und Interessen. Hier handelt es sich um ein Problem, das bisher in der Jugendarbeit so gut wie gar nicht gesehen wurde. Mancher Lehrer weiß darüber zu klagen, daß er in seiner Klasse einen oder gar mehrere hochbegabte Jugendliche hat, die er mit Rücksicht auf den Durchschnitt nicht genug fördern kann. Da ist also ein Lernwille vorhanden, der entsprechend belastet werden will. Handelt es sich um eine musikalische Begabung, so wird sie noch am ehesten am Ort eine Förderung finden können. Aber die normalen Angebote der Volkshochschule oder der Jugendarbeit richten sich auf mittlere Interessen und Begabungen, nicht auf die Spitzen. Gewiß gibt es in der Jugendarbeit einige Fortbildungsstätten für höhere Ansprüche, aber sie bleiben meist dem verschlossen, der keinem Verband angehört, kein Gruppenleiter ist oder werden will, sondern lediglich selbst mehr lernen will. Wir wagen die These: Unser vorgeblich so reich gegliedertes Kultur- und Volksbildungswesen bietet den Hochbegabten keine Chance. Es ist - wenigstens was die Jugendarbeit angeht - in Wahrheit von undifferenzierter Mittelmäßigkeit, gebannt von der Magie der großen Zahl. Daran sind die Finanzierungsweisen der Jugendpläne nicht unschuldig. Wenn Maßnahmen "pro Tag und Teilnehmer" finanziert
156
werden, "rentieren" sich eben nur große Teilnehmerzahlen.
Aber auch das überlieferte Selbstverständnis der Jugendarbeit erweist sich als Hemmnis. Die einzelne Begabung, die Spitzenleistung, haben in ihr niemals einen wirklichen Ort gehabt. Die Vermutung, jemand wolle nur für sich selbst lernen, ohne sich zugleich für eine Gruppe in Dienst nehmen zu lassen, nahm und nimmt oft den Grad charakterlicher Verdächtigung an.
Zeitbedingte Defizite. Die bisher gekennzeichneten Mängel halten wir für prinzipielle, das heißt für solche, die in der Pluralität der Erziehungsfaktoren angelegt sind und nicht durch partielle Reformen des einen oder anderen Faktors beseitigt werden können. Sie ergeben sich sozusagen notwendig aus den gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen von Erziehung. Davon zu unterscheiden sind zeitbedingte Defizite, die durch bestimmte aktuelle Krisen hervorgerufen werden. Dazu gehören etwa jugendliche Arbeitslosigkeit, Flüchtlingsnot, Wohnraumnot und ähnliches. Derartige Aufgaben gehören zu denen, die nur innerhalb kurzer Zeiträume auftauchen. Bisher konnte die Jugendarbeit sie wegen ihrer institutionellen Beweglichkeit aufgreifen. Sie erfüllte damit eine notwendige Funktion, zu der der schwerfällige Apparat des öffentlichen Schulwesens gar nicht in der Lage gewesen wäre. Wird das bei zunehmender Vergesellschaftung der Jugendarbeit so bleiben?
Diese Defizite beschreiben die Aufgaben, die der Jugendarbeit in der gegenwärtigen Situation gestellt sind. Selbstverständlich können sie nicht alle in jeder Veranstaltung aufgegriffen werden. Um sie erfüllen zu können, bedarf es eines reich gegliederten Angebotes, um jedem Jugendlichen die Differenzierung zu gestatten, die er wünscht und benötigt: von der lokalen Jugendgruppe bis zur Tagungsstätte für Spitzenbegabungen, die den Charakter und die Ausstattung einer Jugendakademie erhält. Dafür sind nun die überlieferten Grundformen - Jugendgruppe und Ju-
157
gendverband auf der einen, behördliche Jugendpflege auf der anderen Seite - nicht mehr ausreichend. Dies haben die großen Jugendverbände zum Teil schon erkannt, indem sie unter dem Stichwort der "offenen Arbeit" ihre Partner nicht vorweg als potentielle Mitglieder, sondern zunächst einmal als Kunden ihrer Veranstaltungen sehen. Aber der der deutschen Jugendpflege - und nicht nur ihrer faschistischen Version - von allem Anfang an anhaftende Makel der "Erfassung der großen Zahl", der Fremdbestimmung im Dienste gesellschaftlicher oder behördlich-polizeilicher Interessen, wird nicht so leicht verschwinden. Es wird noch einige Zeit dauern, bis wir ausreichend begriffen haben, daß die Institutionen der Jugendarbeit Dienstfunktion für das jugendliche Lernen haben und nicht umgekehrt.
Methodische Folgerungen
Es würde den hier gesetzten Rahmen sprengen, wollte man all das bisher Gesagte auf seine methodischen Konsequenzen hin untersuchen. Hier geht es primär um Grundsätze, um ein Abtasten des theoretischen Horizontes, weniger um die methodische Übersetzung in die Praxis. Gleichwohl darf von vornherein nicht der Eindruck entstehen, als ob das Verhältnis von Theorie und Methode in dem Sinne einlienig sei, daß diese von jener einfach nur abgeleitet werden könnte. In unserem Verständnis der Theorie ist eine Zielsetzung, die nicht auch methodisch umsetzbar ist, keine theoretisch legitimierte Zielsetzung: Wenn es für ein Ziel prinzipiell keinen Weg gibt, ist auch das Ziel unsinnig. Wir wollen hier nur zwei methodische Überlegungen aufgreifen, die unmittelbar mit den vorher genannten Defiziten zusammenhängen und in der Praxis der Jugendarbeit eine erhebliche Rolle spielen.
Die Bedeutung des Gespräches. Wenn nicht systematische unterrichtliche Zusammenhänge, sondern die den individuellen und kollektiven Lebensproblemen eigentümliche
158
Stoffgliederung vornehmlicher Inhalt der Bildungsarbeit in der Jugendarbeit ist, dann wird daraus sofort die methodische Bedeutung der verschiedenen Gesprächsformen klar. Probleme sind Sach- und Willenszusammenhänge, die zur Entscheidung stehen. Das wesentliche Ziel eines Gespräches ist also die Entscheidung, die immer mehrere Möglichkeiten hat. Der Gesprächsleiter, also in der Regel ein Erwachsener, begibt sich selbst in das Wagnis der Entscheidung, für die er aber keine Gefolgschaft beanspruchen kann. An zwei Extremen kann ein solches Gespräch scheitern: Wenn die wesentlichen sachlichen Implikationen eines Problems nicht genügend erörtert werden, verlegt sich die Entscheidung aufs bloße Meinen; wenn andererseits den sachlichen Zusammenhängen zuviel Raum gewidmet wird, wenn sie gar mit einer unangemessenen Systematik erschlossen werden, wird mit der Notwendigkeit und Möglichkeit der Entscheidung genau das eliminiert, was eigentlich Ursache des Gespräches war. Die Grundsituation des Gespräches ist also, daß sich verschiedene Menschen mit ihren Hoffnungen, Wünschen, Urteilen, Vorurteilen und Interessen auseinandersetzen - nicht um "die Wahrheit" zu finden, sondern um je für sich eine vernünftige, das heißt begründete und somit auch wieder mitteilbare Entscheidung zu treffen. Die Gefahr aller unterrichtlichen Zugänge zur Welt besteht eben immer wieder darin, daß das, was der Sache nach nur Entscheidung zwischen mehreren rational nicht weiter auflösbaren Möglichkeiten sein kann, als eine eindeutige Antwort erscheint, als eine zwingende Schlußfolgerung aus einer systematischen Behandlung der entsprechenden Frage.
Die Rolle der Gruppe. Die sogenannte Gruppenpädagogik - eine eigentümliche Mischung von amerikanischem Pragmatismus und deutscher Gemeinschaftstradition - hat nach dem Kriege auch in der Jugendarbeit eine erhebliche Wirkung gehabt. Soweit sie darauf hingewiesen hat, daß Lernen immer in bestimmten sozialen Zusammenhängen erfolgt und von daher bis in die Inhalte hinein mitbestimmt
159
wird, ist ihre Wirkung fruchtbar gewesen. Sie hat aber für die Praxis der Jugendarbeit mindestens zwei problematische Folgen gehabt. Da die meisten Mitarbeiter der Jugendarbeit fachlich nicht genügend vorgebildet sind, führten die gruppenpädagogischen Regeln vielfach zu einem inhaltsleeren Mechanismus, zum Geschwätz über alles und jedes. Hier wurden die Thesen der Gruppenpädagogik gleichsam zum Alibi dafür, daß es auf die Inhalte letztlich gar nicht ankomme. Andererseits trafen die gruppenpädagogischen Vorstellungen auf die deutsche Überlieferung der stetigen, als feste Gemeinschaft auftretenden Jugendgruppe und wurden zu deren Rechtfertigung.
Da Wolfgang Müller über die hier angebrachten Differenzierungen das Nötige gesagt hat, sei hier nur noch auf die Grenzen der stetigen Gruppe für den Lernprozeß hingewiesen. Sie liegen darin, daß die Kommunikation mit denselben Menschen, die - in einer Gruppe zusammengefaßt - ohnehin weitgehend "von gleichem Schrot und Korn" sind, für sich genommen zu erheblichen geistigen und emotionalen Beschränktheiten führt. Abgesehen davon, daß sich in der Gruppe soziale Rollen ausbilden, die die Kommunikationsfähigkeit vereinseitigen, bildet sich immer auch so etwas wie eine Gruppenmeinung, die oft recht primitiven Gehalts ist und den Mitgliedern durch die Gruppenmoral aufgezwungen wird. Soweit die stetige Gruppe die Funktion der sozialen Geborgenheit übernimmt, erfüllt sie einen guten Sinn. Pädagogisch ertragreich sind aber nach unseren Überlegungen nicht nur stetige, sondern auch wechselnde Kommunikationen mit wechselnden Partnern in wechselnden Sozialsituationen.
Theorie und Praxis
Wenn theoretisches Denken die Praxis verändern will, muß es die Möglichkeiten seiner Verbreitung konstitutiv in sich aufnehmen. Es reicht also nicht aus, bloß eine vielleicht einleuchtende Theorie der Jugendarbeit zu formu-160
lieren, solange es nicht gelingt, sie auch in die Praxis zurückzuübersetzen. Daraus ergeben sich zwei dialektisch aufeinander bezogene Folgerungen: (a) Die Theorie der Jugendarbeit muß für die pädagogisch Handelnden lehrbar gemacht werden. (b) Die Theorie muß von den pädagogisch Handelnden aus den Erfahrungen der Praxis weiterentwickelt werden können. Diese beiden Momente des Verhältnisses von Theorie und Praxis mögen den Schluß der Überlegungen bilden.
Die Notwendigkeit spezifischer Theorien
Unsere bisherigen Überlegungen haben viele verschiedene Teile und Situationen der Jugendarbeit auf den gleichen Nenner gebracht: Jugendverband, lokale Jugendgruppe, Heim der Offenen Tür, Jugendbildungsstätte, Jugendklub, Hobbygruppe - um nur einige zu nennen. Wir brauchen offenbar neben einer allgemeinen Theorie der Jugendarbeit, von der bisher die Rede war, spezifische Theorien ihrer Bereiche und Möglichkeiten.
Es hat in den vergangenen Jahren eine Fülle verschiedener Maßnahmen mit sehr verschiedenen Bezeichnungen gegeben. Prüft man, was im Hinblick auf die Zukunft davon Bestand hat, so stößt man auf vier Grundformen:
(a) Jugendverbandsarbeit,
(b) Jugendfreizeitstättenarbeit,
(c) Jugendbildungsstättenarbeit,
(d) Jugendferienarbeit.Die Frage, wie diese vier Bereiche in je besonderer Weise die von uns genannten Defizite aufgreifen können, müssen wir hier ausklammern. Sie bedürfte besonderer Experimente und Untersuchungen. Wohl aber sollen für diese Bereiche einige Grundsätze entwickelt werden.
Jugendverbandsarbeit. In den ersten Jahren nach dem Kriege hat man geglaubt, daß das vielseitige Angebot verschiedener Jugendverbände dem einzelnen Jugendlichen genügend Spielraum für eine Auswahl in freier Entschei-
161
dung lassen würde. Es schien daher sinnvoll, den Jugendverbänden eine Art Monopol für die freie Jugendarbeit zuzugestehen. Inzwischen hat sich aber gezeigt, daß die Gemeinsamkeiten offensichtlicher sind als die Unterschiede der Zielsetzung. In dem Maße nämlich, in dem die politischen und weltanschaulichen Unterschiede, die bei der Gründung der Jugendverbände sehr bestimmend waren, den Jugendlichen uninteressant wurden, glichen sich die Maßnahmen der Verbände inhaltlich und methodisch weitgehend an. Aus den Erfahrungen der Jugendbewegung übernahm man als Grundform der Verbandsarbeit die stetige, lokale Jugendgruppe, die wöchentlich mindestens einmal ihren Heimabend abhält. Dies schien um so einleuchtender, als diejenigen Jugendlichen, die sich einem demokratischen Jugendverband anschlossen, in den Nachkriegsjahren am ehesten gegen totalitäre Verführungen gesichert schienen. Ziel der Verbände war folgerichtig, möglichst viele Mitglieder zu werben und möglichst viele Gruppenleiter zu finden, die möglichst vielen "Heimabendgruppen" die Existenz ermöglichten. Seitdem auch noch die Finanzierung der Verbände nach der Zahl der Mitglieder erfolgt, hat sich dieses System versteinert. Man kann nicht nachdrücklich genug darauf hinweisen, daß dieses System für die Verbände tödlich zu werden beginnt; denn inzwischen sind folgende Veränderungen eingetreten: (a) Je differenzierter die Freizeitmöglichkeiten für die Jugendlichen geworden sind, um so mehr Jugendliche erleben die stetige Gruppe und die typische Veranstaltungsform des Heimabends als anachronistische Beschränktheit. (b) Jugendliche, die fähig zu Führungsaufgaben wären, resignieren vor der "sinnlosen Aktivität", ihre Zeit und Energie mit der Leitung einer solchen Gruppe zu vergeuden, und ziehen sich zurück; andere stellen sich erst gar nicht zur Verfügung. Damit aber wird das Feld einem problematischen jugendlichen Funktionärstyp überlassen.
Nun tragen die Jugendverbände dieser Entwicklung schon seit einiger Zeit unter dem Stichwort der "offenen Arbeit" Rechnung. Die Mitglieder des Verbandes am Ort ver-
162
stehen sich zunehmend als Veranstalter für alle Jugendlichen, die sie zunächst als ihre Kunden betrachten. Aber eben damit geraten die Verbände in den Teufelskreis des Finanzierungsmodus: Um offene Arbeit zu treiben, muß der Verband finanziell existenzfähig sein; seine Existenz hängt letztlich von der Mitgliederzahl ab; offene Arbeit aber vermindert automatisch die Mitgliederzahl, oder anders: Mitgliederzahl und Erfolg der offenen Arbeit sind nicht mehr direkt proportional - wobei nur am Rande vermerkt sei, daß die Mitgliederzahl nie genau angegeben werden kann, was wiederum zu unaufhörlichen Korruptionsverdächtigungen führt. Unsere
grundsätzlichen Vorschläge für die künftigen Aufgaben der Jugendverbandsarbeit seien in folgenden Thesen zusammengefaßt:1. Die Finanzierung der Jugendverbände darf nicht mehr aufgrund der Mitgliederzahl erfolgen, weil dieser Modus vom Vorrang der stetigen Gruppe ausgeht. Entweder gewährt man den Verbänden einen pauschalen Beitrag für die Organisation und finanziert außerdem ihre Maßnahmen; oder man finanziert ihre Maßnahmen so, daß sie einen angemessenen Teil als Verwaltungsanteil abzweigen können. Die Konsequenzen derartiger Finanzierungsweisen müßten sorgsam bedacht werden, was hier nicht im einzelnen geschehen kann. Dabei ist zu bedenken, daß eine Änderung des Finanzierungsmodus einige Verbände in erhebliche Existenzschwierigkeiten stürzen wird, da ja heute diese Existenz nur zum geringen Teil vom Erfolg ihrer Maßnahmen abhängt. Da aber die gegenwärtige Lage nicht nur zu Lasten der Verbände geht, sondern mindestens ebenso zu Lasten der Finanzierungsrichtlinien, wäre es fair, entsprechende Übergangsregelungen zu finden.
2. Die Verbände, vom Zwang großer Mitgliederzahlen und sinnloser Kleingruppenaktivitäten befreit, werden attraktiv für solche Jugendliche, die für Führungsaufgaben besonders begabt sind. Diesen bieten sie als Mitgliedern Felder "sinnvoller Aktivität", wobei die pädagogischen Einschränkungen sorgsam zu beachten sind. Da die
163
großen Jugendverbände ausnahmslos in die ihnen nahestehenden politischen Verbände hineinragen, werden sie zum Filter des politischen Nachwuchses im weitesten Sinne, dem sie ein Vorfeld ernster und zugleich geschützter Aufgaben bieten (" pädagogische Provinz").
3. Diese Führungskräfte sehen sich - im Gegensatz zur Leitung einer Heimabendgruppe - vielfältigen Anforderungen gegenüber immer anderen Jugendlichen ausgesetzt. Sie müssen Erfolg haben, weil Maßnahmen finanziert werden, und um diesen Erfolg zu erreichen, müssen sie vielfältige Leistungen entwickeln, die der Überwindung aller von uns genannten Defizite gleichkommen. Je uninteressierter die Verbände an neuen Mitgliedern sind, um so interessanter werden sie gerade für die Jugendlichen, denen sie ein vielfältiges und anspruchsvolles Experimentierfeld bieten können.
4. Damit wird eine Klärung der Rolle des Erwachsenen im Jugendverband notwendig. Der Slogan: "Jugend kann nicht durch Jugend geführt werden" ist richtig und falsch. Richtig ist, daß Jugendliche, sofern sie nicht mündig sind, auch nicht rechtsverbindlich gegenüber dem staatlichen Geldgeber handeln können; daß Erwachsene da sein müssen, die im Sinne der pädagogischen Provinz Schutz ausüben, was sie wiederum nur mit der Rückendeckung einer starken Organisation können; und wichtig ist, daß letztlich nur Erwachsene den Jugendlichen helfen können, ihre Erfahrungen zu deuten.
Andererseits ist dieser Slogan nur das Signum für einen Sachverhalt, der die Jugendverbandsarbeit ebenfalls ernstlich bedroht. Je weniger es gelang, begabte Jugendliche zu gewinnen, um so unentbehrlicher wurden die ehrenamtlichen Erwachsenen für die Leitung der Gruppen und für andere Führungsaufgaben. Obwohl man den meisten von ihnen bestätigen muß, daß sie zum Teil unter großen persönlichen Opfern die Jugendarbeit nach dem Kriege überhaupt erst ermöglicht haben, kann kein Zweifel daran bestehen, daß sie heute außer ihrem guten Willen wenig zur Reform der Jugendarbeit beitragen können. Nicht die
164
abstrakte Frage, ob die Erwachsenen notwendig sind für die Jugendarbeit, steht zur Debatte, sondern die konkrete: Was sind das für Erwachsene, die ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätig sind? Stammen sie nicht überwiegend aus kleinbürgerlichen Schichten, die keineswegs repräsentativ für die Erwachsenen sind? Wieviele von ihnen sind in der Lage, die Erfahrungen der Jugendlichen zu deuten, ohne auf kleinbürgerliche Klischees zu verfallen? Ist für viele von ihnen die ehrenamtliche Tätigkeit in der Jugendarbeit nicht ein Feld, das ihnen allein soziales Selbstbewußtsein garantiert? Auch solche Tatbestände deckt unser Slogan.
Wenn die Jugendverbände gut beraten sind, dann müssen sie sehen, daß der Mythos vom Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit meist zu hoch bezahlt wird. Nur pädagogisch und fachlich qualifizierte und entsprechend hoch bezahlte Erwachsene können die künftigen Aufgaben der Jugendverbandsarbeit bewältigen. Damit werden die Ehrenamtlichen keineswegs überflüssig. Statt in Machtpositionen zu stehen, die heute eben nicht mehr neben einem Beruf ausgefüllt werden können, werden sie als freiwillige Helfer und Berater der Jugendarbeit auch in Zukunft unentbehrlich sein. Bis diese notwendige Entwicklung eingeleitet ist, dürfte es in den Verbänden noch erbitterte Auseinandersetzungen geben, deren Ausgang keineswegs sicher ist.
5. Je mehr sich auf diese Weise die Jugendverbandsarbeit zur qualifizierten offenen Arbeit wendet, um so unwichtiger werden die Unterschiede zwischen "Organisierten" und "Nichtorganisierten" - was ohnehin nie eine pädagogisch begründbare Differenz gewesen ist. Die Jugendverbände werden dazu befreit, sich wirklich um die wesentlichen Probleme der gesamten Jugendarbeit zu kümmern, für die sie zum allgemeinen "Ideen- und Mitarbeiterreservoir" werden.
Jugendfreizeitstätten. Die heutigen Jugendfreizeitstätten, auch "Heime der Offenen Tür" genannt, sind durch eine pädagogische und eine politische Tradition belastet. Nach
165
dem Kriege, in den Jahren hoher allgemeiner Jugendgefährdung, dienten sie vor allem dazu, die Jagend "von der Straße zu holen", ihr ein wenn auch bescheidenes Heim zu bieten, wo sie ihre Freizeit verbringen konnte. Dabei verband sich die Finanznot dieser Zeit mit den überlieferten Vorstellungen vom "spartanischen Jugendleben": Die Einrichtung blieb im allgemeinen dürftig. Abgesehen davon, daß es nie gelang, die wirklich gefährdeten Jugendlichen anzusprechen, wurden diese Häuser in dem Augenblick unattraktiv, wo der allgemeine Wohlstand stieg und das kommerzielle Freizeitangebot die Angebote der Heime notwendig ausstechen mußte. Obwohl man in den folgenden Jahren dieser Entwicklung Rechnung zu tragen versuchte, blieben die Heime im Bewußtsein der Öffentlichkeit eine Lösung für "arme" Jugendliche. Hemmender war, daß es nicht gelang, eine Konzeption von Freizeitpädagogik zu entwickeln. Herrschend blieb die Vorstellung, daß die Gesellschaft, vor allem ihr konsumindustrieller Teil, der erklärte Feind der Erziehung sei, dem man mit musischer Bildung und anderen "sinnvollen Freizeitbeschäftigungen" begegnen müsse.
Die lokalen Jugendfreizeitstätten wurden bald zum beliebten Feld kommunaler Jugendpolitik. Gegen den anfangs heftigen Widerstand der Jugendverbände gelang den Kommunen mit der Begründung, die Heime seien vor allem für die "Nichtorganisierten" da, eine jugendpflegerische Aktivität, die ihnen bis dahin verwehrt war. Die Folge war unter anderem, daß der Bau von Freizeitstätten zur Frage des gemeindepolitischen Prestiges wurde: An manchen Orten wurde fast jedes Jahr eine neue Freizeitstätte gebaut. Da vor allem Großstadtgemeinden den freien Trägern meist finanziell überlegen sind, wurden nun zwar oft komfortable Bauten errichtet, die aber nun auf ihre Weise den Mangel an pädagogischer Konzeption verrieten. Entweder lagen sie verkehrsungünstig; oder die Räume waren architektonisch schön, aber pädagogisch zwecklos; oder sie waren für "junge Erwachsene" sinnvoll gebaut, aber nicht für die Kinder, die zu den häufigsten
166
Gästen wurden; oder man traute dem schönen, aber toten Inventar selbst eine erzieherische Wirkung zu und verzichtete auf pädagogische Mitarbeiter - was sowieso billiger war und die staunenden Wähler gar nicht bemerkten. Von wenigen Ausnahmen abgesehen darf gegenwärtig das "Unternehmen Freizeitstätte" als gescheitert gelten. Trotzdem rechnen wir es zu den zukunftsträchtigen, wenn es gelingt, folgende Grundsätze zu beachten:
1. Eine Freizeitstätte dient der Jugend einer bestimmten lokalen Umgebung als Treffpunkt für gesellige Vorhaben und Bildungsvorhaben. Es ist unmöglich, eine Kinder- und Jugendfreizeitstätte im selben Gebäude unterzubringen. Selbst wenn sie von einem verbandlichen Träger bewirtschaftet wird, sollte sie rechtlich wie auch psychologisch offen sein für alle Jugendlichen.
2. Der Haushalt muß so dotiert sein, daß mehrere pädagogisch und fachlich vorgebildete Lehrkräfte haupt- oder wenigstens nebenamtlich angestellt werden können. An der Mitarbeiterfrage wird sich die Existenz dieser Arbeit entscheiden. Jeder Industriebetrieb, der Neuland betritt, wird Bedingungen schaffen, die ihm die besten Kräfte zuführen. Er würde ruiniert, wenn auch er es mit der "Vergelt's-Gott-Methode" versuchte. Man hat immer die Mitarbeiter, die den - nicht nur finanziellen - Bedingungen entsprechen, die man vorgibt. Der Haushalt muß außerdem Mittel für Maßnahmen enthalten, damit Experimente finanziert werden können und damit sich die Arbeit auch am Teilnehmererfolg auszuweisen vermag. Die Trägerschaften müssen so organisiert sein, daß der Leiter vom starren Schema kameralistischen Denkens befreit wird. Hohe Ausgaben für den Bau von Freizeitstätten sind in Zukunft Verschwendung von Steuergeldern, wenn sie nicht von angemessenen Ausgaben für pädagogisches Personal und pädagogische Maßnahmen begleitet werden.
3. Die Inneneinrichtung kann nicht mehr nach den Grundsätzen der "spartanischen Jugendlichkeit" oder des bloß jugendpolitischen Prestiges gestaltet werden. Wenn eine Freizeitstätte auf ihre Weise die Erziehungsdefizite be-
167
seitigen soll, dann muß sie nach dem jeweils fortgeschrittensten Komfort der Erwachsenenwelt und zugleich erziehungswirksam eingerichtet sein. Wenn die Tanzräume und Bars nach den Maßstäben eines guten Restaurants eingerichtet sind, kann sich erst ein diesen Maßstäben angemessener Stil entwickeln. Erst wenn das Tonbandgerät in einer angemessenen technischen Umgehung steht (elementares Tonstudio), wird es ein Lernobjekt. Erst wenn der Spielfilm unter denselben technischen Bedingungen wie im Kino vorgeführt werden kann, kann es eine ästhetisch orientierte Filmpädagogik geben. Die Einsicht, daß es keine kulturelle Erziehung geben kann, die nicht am fortgeschrittensten Teil des zivilisatorischen Standards orientiert ist, wird sich nur mühsam bahnbrechen und dabei auf heftige Widerstände stoßen.
4. Eine große Gefahr für die Freizeitstätten wird weiter darin bestehen, daß sie unter das Diktat der bürgerlichen lokalen Umgebung geraten, deren Klischees sie dann notwendig verfallen. Die Träger sollten unabhängig von lokalen Mächten sein. Gerade kommunale Träger neigen dazu, jedes Risiko zugunsten der Reproduktion des Milieus auszuschalten, weil pädagogische Fehler - tatsächliche oder vermeintliche - allzu leicht zur politischen Waffe werden können.
Jugendbildungsstätten. Jugendbildungsstätten auf überregionaler Ebene hat es bisher in der Form verbandseigener Institute und in der Form der verbandsunabhängigen Jugendhöfe gegeben. Wie Heinz Hermann Schepp nachgewiesen hat, gab es langjährige Auseinandersetzungen darüber, ob die Errichtung verbandsunabhängiger Einrichtungen dieser Art sinnvoll sei. Das Selbstverständnis der Jugendhöfe konzentrierte sich dabei lange Zeit auf das Argument, diese unabhängigen Einrichtungen dienten vor allem der Ausbildung von Jugendleitern der einzelnen Verbände. In dieser Vorstellung verbanden sich politische Erfahrungen der nationalen Zerrissenheit in der Weimarer Republik mit dem überlieferten Autonomieverständnis der
168
Erziehungswissenschaft und dem Gedanken einer "volksunmittelbaren Jugend" (Heinrich Heise). Von Anfang an haben die Jugendverbände mit Recht darauf hingewiesen, daß die Leiterausbildung ihre eigene Sache sei, sobald sie personell und materiell dazu in der Lage seien. Nur wenigen Jugendbildungsstätten gelang es, ein eigenständiges, von den Jugendverbänden unabhängiges pädagogisches Konzept zu finden. Die meisten wurden zu Tagungshotels für Jugend- und Erwachsenen-Verbände. Soweit es sich dabei um verbandliche Unternehmungen handelt, wird ihre Aufgabe weitgehend von den Bedürfnissen und Zielen des jeweiligen Verbandes bestimmt sein. Welche Funktion aber haben in der künftigen Jugendarbeit jene anderen überregionalen Einrichtungen?
1. Sie gehen im Unterschied zu den Jugendfreizeitstätten vor allem von inhaltlichen Bildungszielen aus: politische Bildung, Musik, Kunst, Massenmedien usw. Dabei werden sie sich spezialisieren müssen: Die "All-Round-Bildungsstätte" mit mittlerem Niveau wird nicht konkurrenzfähig bleiben. Die Bildungsstätte arbeitet mit einem hohen sachlichen Niveau, ihre Partner sind vor allem jugendliche Spitzenbegabungen.
2. Sie ist Treffpunkt der Jugendarbeit in einem bestimmten Land oder Landesteil. Sie trägt die Fortbildung der in der Jugendarbeit tätigen Erwachsenen in ausdrücklicher kooperativer Konkurrenz zu den Verbandsinstituten. Eine wirksame Mitarbeiterfortbildung, über die weiter unten noch etwas zu sagen ist, muß nach allen bisherigen Erfahrungen durch sorgfältige Experimente erprobt werden. Dafür muß es Institute geben, deren wissenschaftlich vorgebildete Fachkräfte Anlage und Auswertung solcher Experimente übernehmen können.
3. Die Jugendbildungsstätte greift allgemeine Aufgaben der Jugendarbeit in experimenteller Weise auf. Deren Ergebnisse werden für die übrige Praxis verbreitet und stellen deren jeweils höchsten qualitativen Anspruch dar.
4. Sie braucht für diese Aufgaben einen hochqualifizierten Mitarbeiterstab (mindestens vier bis fünf hauptamtliche
169
Dozenten). Hier wird man noch genauer als bei den Freizeitstätten überlegen müssen, wie man die geeigneten Mitarbeiter gewinnt. Man sollte auch keineswegs vor Abwerbung aus anderen pädagogischen Bereichen zurückschrecken, sie käme letztlich nur der allgemeinen Qualitätsverbesserung zugute. Es gelingt bislang selten, wirklich begabte Mitarbeiter in der Jugendarbeit zu halten. Wer auf Schritt und Tritt die Grenzen der Bedingungen seiner Arbeit spürt, wird sich sehr bald ein neues Feld suchen, das ihm die pädagogische Hochkonjunktur nach Belieben bietet. Auf diese Weise finden dann die unterentwickelten Bedingungen auch mehr und mehr den ihnen angemessenen Mitarbeitertypus.
5. Für ihre allgemeine Ausstattung gilt mindestens das, was schon über die Freizeitstätten gesagt wurde. Darüber hinaus braucht sie in erhöhtem Maße Mittel für Experimente und auch für Veröffentlichungen (Materialien für die Jugendarbeit und für die Fortbildung, Tagungsprotokolle usw.). Außerdem muß der Tagessatz so gestützt sein, daß er für jeden Jugendlichen ohne Hilfe anderer Organisationen erschwinglich ist. Nicht auf allen Ebenen der Praxis kann wissenschaftlich kontrolliert experimentiert werden. Hier läge eine besondere Aufgabe entsprechend dotierter Jugendbildungsstätten.
Wenn hier immer davon die Rede ist, daß die Mittel erhöht werden müssen, wenn die Jugendarbeit in Zukunft noch einen Sinn haben soll, so bedeutet das nicht, daß damit insgesamt die öffentlichen Ausgaben erheblich wachsen müssen, an anderen Stellen kann nämlich auch erheblich gespart werden. Man muß sich nur darüber im klaren sein, daß die Vorstellungen, mit denen heute Einrichtungen der Jugendarbeit dotiert werden, dringend einer "Revision der Vorurteile" bedürfen, wenn es in naher Zukunft noch jugendliche Partner für die Jugendarbeit geben soll.
Ferienpädagogik. Nachdem unter dem Stichwort des "Sozialtourismus" und der "Jugenderholung" in den Zeiten minderen Wohlstandes umfangreiche pädagogische Bemü-
170
hungen gedeihen konnten, sind seit einiger Zeit auch hier die Dinge in Bewegung geraten. Während sich die Kindererholung nach wie vor großer Beliebtheit erfreut, partizipieren immer mehr Jugendliche am Erwachsenentourismus und verzichten auf die entsprechenden pädagogisch kanalisierten Angebote.
Es hat den Anschein, daß dieses Feld für die außerschulische Jugendarbeit zunehmende Bedeutung gewinnen wird. Da die Untersuchungen und pädagogischen Überlegungen noch zu sehr im Fluß sind, können wir hier nicht auf Einzelheiten eingehen. Sicher ist aber schon jetzt, daß die Vorstellungen über "Jugendliche machen Ferien" ebenfalls radikal überprüft werden müssen, wenn die Entwicklung den Maßnahmen der Jugendarbeit nicht davonlaufen soll, wie es in den anderen Bereichen schon längst geschehen ist. Diese wenigen Hinweise sollen nur eine Aufgabe kennzeichnen und folgende Hypothese nahelegen: Die einzelnen Veranstaltungsformen der Jugendarbeit sind nicht einfach gegeneinander austauschbar. Sie haben jeweils spezifische Chancen, die aufgezeigten Defizite aufzugreifen, und sie haben spezifische, schon in ihren Bedingungen festgelegte Grenzen. In diesem Sinne wäre also eine Theorie der jeweiligen Bereiche zu erarbeiten. Das kann letztlich nicht am grünen Tisch geschehen, sondern nur durch die Entwicklung sorgfältig geplanter und ausgewerteter Modelle. Ein angemessener Prozentsatz der in Maßnahmen investierten Mittel muß künftig in Forschungen dieser Art gesteckt werden.
Die Notwendigkeit einer Didaktik der Mitarbeiterbildung
Die Jugendleiter, Jugendpfleger und Dozenten sind letztlich die einzigen, die theoretische Einsichten in die Praxis der Jugendarbeit übermitteln können. Es hat also solange wenig Sinn, Theorien der Jugendarbeit zu formulieren, wie nicht zugleich auch Rechenschaft abgelegt wird über die Erfordernisse einer Bildung und Weiterbildung dieser Akteure.
171
Der allgemeinen Theorie der Jugendarbeit und den besonderen Theorien ihrer einzelnen Bereiche entspricht also eine Didaktik für die Lehrenden. Im Theorie-Praxis-Schema ist Didaktik die Art und Weise der Aneignung von Theorie - und zwar in dem schon beschriebenen dialektischen Sinne: als Verstehen theoretischer Erwägungen einerseits und als Überprüfung und Veränderung solcher Erwägungen andererseits. Oder anders: Didaktik ist jener Akt, durch den die Beziehung zwischen Theorie und Praxis des pädagogischen Handelns jeweils konkret hergestellt wird. Zwischen der Theorie einerseits, die immer mehr ist als die reflektierte Praxis, und der bloßen Praxis in ihrem kritisierten Zustand andererseits schafft der didaktische Akt die jeweilige Synthese.
Werfen wir von hier aus einen Blick in die heute übliche Mitarbeiter-Fortbildung, so wird deren Zufälligkeit und Konzeptlosigkeit deutlich. Sie konzentriert sich im allgemeinen auf drei Themen: politische Bildung, musische Bildung und Gruppenpädagogik. Nicht diese Themen selbst erscheinen problematisch, sondern ihre Beziehungslosigkeit zur Praxis der Jugendarbeit und damit ihre theoretische Blindheit. Selbst eine Fortbildungstagung über Gruppenpädagogik kann an den praktischen Problemen vorbeizielen, wenn sie sich nämlich der eigenen Systematik des Stoffes überläßt. Wiewohl ein Mitarbeiter in der Jugendarbeit um so produktiver ist, je allgemeiner er selbst gebildet ist, so brauchen wir im Sinne einer Didaktik der Fortbildung weniger eine Art Bildungskanon als vielmehr ein Denkmodell, das diesem Mitarbeiter ermöglicht, seine eigene Praxis zu bedenken. Dieses Modell kann nicht das sein, was wir bisher als Entwurf einer Theorie der
Jugendarbeit entwickelt haben. Es würde dann notwendig zu einer nur deduktiven Denkweise führen, zu einem Verfahren der Anwendung eines vorher gewissen theoretischen Zusammenhangs. Didaktische Reflexion in der Praxis selbst kann aber immer nur deduktiv und induktiv sein, das heißt, sie muß auf den theoretischen Zusammenhang zielen, indem sie diesen gegebenenfalls korrigiert.172
Die Aufgabe einer Didaktik der Fortbildung besteht also darin, für die Mitarbeiter ein methodisches Modell, ein Denkmodell zu entwickeln, das sie in den Stand setzt, ihre eigene Arbeit theoretisch zu durchdringen. Ein solches Modell muß so begrenzt sein, daß es praktikabel bleibt, aber zugleich so umfangreich, daß wesentliche Aspekte des objektiven theoretischen Zusammenhangs erfaßt werden können. Mit einem solchen Modell kann und soll der gesamte Zusammenhang, den wir hier Theorie der Jugendarbeit genannt haben, nicht von Fall zu Fall reproduziert werden, aber mit ihm sollten theoretische Aussagen verständlich werden.
Der in der Wirklichkeit der Jugendarbeit allenthalben vorhandene Gegensatz von Theorie und Praxis, der sich oft geradezu zur gegenseitigen Feindschaft von "Theoretikern" und "Praktikern" auswächst, hat einen guten und einen schlechten Grund. Die Aversionen sind begründet, weil die Lehrer und Erzieher auf weite Strecken hin einer Erziehungswissenschaft begegnen, die die praktischen Implikationen ihrer Aussagen nicht interessiert; sie sind unberechtigt, insofern erwartet wird, theoretische Aussagen könnten jemals Rezepte für die Praxis sein, die die schwere Last der Entscheidung zwischen mehreren, im Sinne der Theorie gleich sinnvollen Möglichkeiten abnähmen. Theorie der Jugendarbeit als eine Form des denkenden Zugriffs auf den Gesamtzusammenhang der Erscheinungen ist eben nicht identisch mit dem "Theoretisieren der Praxis", wie wir es hier von den Mitarbeitern der Jugendarbeit als ihre didaktische Aufgabe fordern. Es sind von ihrem Ansatz her zwei verschiedene Leistungen des Denkens. Die Frage ist nur, ob sie aufeinander bezogen werden können, so daß beide voneinander profitieren können.
Dies scheint mir möglich zu sein durch die Entwicklung eines Faktorenmodells, das einerseits aus den Überlegungen zur Theorie der Jugendarbeit erwachsen ist, auf der anderen Seite aber den Mitarbeiter von Fall zu Fall zur konkreten inhaltlichen Ausfüllung und Entscheidung veranlaßt. In diesem Sinne ist jede Maßnahme der
Jugend-173
arbeit offensichtlich durch die Interaktionen mindestens folgender Faktoren bestimmt:
(a) die Intentionen und Erwartungen des Trägers und die kulturpolitischen Möglichkeiten sie durchzusetzen;
(b) die Vorstellungen der "öffentlichen Meinung";
(c) die Vorstellungen und Erwartungen der "nichtöffentlichen Meinung", also des jeweiligen lokalen Milieus;
(d) die Vorstellungen, Erwartungen und Maßnahmen der staatlichen Stellen, die Jugendarbeit finanzieren;
(e) die Vorstellungen und Erwartungen der teilnehmenden Jugendlichen;
(f) die zur Verfügung stehenden technischen, vor allem finanziellen Mittel;
(g) die Vorstellungen und Erwartungen der pädagogischen Mitarbeiter.
Auch dieses Faktorenmodell beschreibt natürlich nichts weiter als eine noch zu lösende Aufgabe. Es eröffnet aber die Möglichkeit, allgemeine Aussagen der Theorie mit den besonderen Umständen der einmaligen Erziehungssituation zu verbinden. Der Schluß vom Allgemeinen aufs Besondere und umgekehrt bleibt - außerhalb der klassischen Naturwissenschaften - allemal ein Akt der Entscheidung, hier der didaktischen Entscheidung.
Folgerung:
Die Notwendigkeit wissenschaftlicher UntersuchungenWenn der geduldige Leser bis hierhin gefolgt ist, wird er vielleicht den Eindruck gewinnen, daß der Bereich der Jugendarbeit schon weitgehend empirisch erforscht sei. Dieser Eindruck wäre falsch. Wir kennen nicht einmal die einfachsten statistischen Unterlagen über den Umfang der Jugendarbeit. Unsere Behauptungen über Sachverhalte der Jugendarbeit stammen fast ausschließlich aus eigenen mehrjährigen Beobachtungen, Erfahrungen und Gesprächen. Sie bedürfen ausnahmslos der Überprüfung durch wissenschaftlich exakte Methoden. Die Tatsache, daß dieser Bereich bisher für die Wissenschaft wie für die finanziellen
174
Förderer der Wissenschaft nicht interessant war, ist aber allein schon ein deutlicher Beweis für unsere These, daß Theoriebildung in der Jugendarbeit bisher nicht gefragt war. Die genaue Erforschung dessen aber, was jährlich mit mindestens 160 Millionen Mark öffentlicher Mittel finanziert wird, ist - vor jedem wissenschaftlichen und pädagogischen Interesse - zu einer Frage der öffentlichen Steuermoral geworden.
Dabei geben die sieben Faktoren, die wir für die Didaktik der Mitarbeiter vorgeschlagen haben, schon ganze Forschungsprogramme ab. Die künftige Forschung wird sich auf folgenden Ebenen bewegen müssen:
1. Auf der Ebene der empirischen Wissenschaften. Hier geht es vor allem um soziologische, psychologische und ideologiekritische Untersuchungen. Wie sieht das organisatorische Geflecht der Jugendarbeit aus? Wie funktioniert die Kommunikation zwischen den organisatorischen Spitzen und den pädagogischen Aktivitäten?
Wie sehen die Programme der Jugendarbeit aus? In welchen Sozialsituationen werden welche Programme verwirklicht? Welcher sozialen Herkunft sind die handelnden Pädagogen? Wie sehen sie sich, ihre Arbeit und ihre eigene "Welt"? Welcher sozialen Herkunft sind die jugendlichen Teilnehmer? Mit welchen Motiven besuchen sie welche Veranstaltungen der Jugendarbeit? Ist es ein bestimmter "Typ«, der solche Veranstaltungen besucht?2. Auf der Ebene der historischen Reflexion. Aus welchen pädagogischen, historischen und gesellschaftlichen Konstellationen stammen heute herrschende Vorstellungen und Organisationsformen der Jugendarbeit? Auf welche konkreten Probleme antworteten sie damals? In welcher Weise haben sich die Probleme gewandelt?
3. Auf der Ebene des pädagogischen Experimentes. Das pädagogische Experiment begegnet bei uns erheblichem Mißtrauen. Es gilt als anrüchig, "mit Menschen zu experimentieren". Aber man darf sich durch den naturwissenschaftlichen Akzent des Wortes "Experiment" nicht überrumpeln lassen. Jeder Lehrer experimentiert
im Unterricht,175
insofern er ausprobiert, wie er einen Stoff am besten beibringt und seine Erfahrung für das nächste Mal verwertet. Beim pädagogischen Experiment ginge es also darum, das, was sowieso geschieht, geplant, beschreibbar und objektivierbar zu tun. Im Grunde ist dies die einzig spezifische Form pädagogischer Empirie.
4. Auf der Ebene der pädagogischen Theoriebildung. Sie wäre die Ebene, die wir in diesem Beitrag versucht haben zu beschreiben. Es dürfte klar geworden sein, daß pädagogische Theoriebildung nur produktiv sein kann, wenn die drei anderen Ebenen ausreichend berücksichtigt werden. Sie ist auf deren Ergebnisse angewiesen, kann sie aber nicht von ihrem eigenen Ansatz aus selbständig ermitteln. Pädagogische Theorie kann also weder das pädagogische Experiment noch die historische Reflexion noch die empirische Untersuchung ersetzen oder auch nur entbehren. Wohl kann sie aber den drei anderen Ebenen Fragestellungen vorlegen, die sie zu klären wünscht.
So sind diese Forschungsebenen einerseits aufeinander angewiesen und bedingen einander. Andererseits müssen sie selbständig mit den jeweils angemessenen Methoden und Verfahren arbeiten. Bleibt diese Selbständigkeit nicht erhalten, werden die Ergebnisse von vornherein ideologisch fixiert, wofür gerade die jüngere Jugendforschung einige interessante Beispiele liefert. Damit zeichnet sich aber eine weitere Konsequenz ab: Produktive Forschung auf diesem Gebiet ist zweifellos nicht nur deshalb auf verstärkte Kooperation angewiesen, weil die Quantität des Materials und der Gesichtspunkte einen Einzelnen hoffnungslos überfordern müßte, sondern auch deshalb, weil ein Einzelner nur unter besonders glücklichen Umständen über die verschiedenartigen Forschungsmethoden verfügen könnte.
176
34. Pädagogisches Plädoyer fürs Fernsehen (1964)
(In: Sonntagsblatt Nr. 27/1964)Immer wenn ich gebeten werde, einen Vortrag über ein aktuelles politisches Thema in der Jugend- oder Erwachsenenbildung zu halten, bekomme ich Hemmungen. Wenn das Thema nicht nur aktuell, sondern auch wesentlich ist, hat es darüber bestimmt schon eine Fernsehsendung gegeben. Was habe ich im Vergleich dazu schon zu bieten? Ich kann nicht die fünf wichtigsten Experten meinen Zuhörern präsentieren, noch den pädagogischen Grundsatz der "AnschauIichkeit" durch Verwendung von authentischem Filmmaterial erfüllen. Statt mit einem kleinen Trickfilm komplizierte Zusammenhänge dynamisch darbieten zu können, bin ich auf die altmodische Schultafel angewiesen und mein von vielen Zufälligkeiten abhängiges Privatarchiv enthält selten das, was ich suche. Eigentlich müßte ich meinen Zuhörern sagen, sie sollten nicht zu meinem Vortrag kommen, sondern lieber regelmäßig politische Fernsehsendungen verfolgen.
Eins allerdings habe ich den Kollegen von Funk und Fernsehen voraus: Ich kann nachprüfen, was die Zuhörer verstanden haben und mit ihnen in eine dialogische Beziehung treten. Aber auch das ist ungenau gesagt; denn selbstverständlich gibt es eine solche Beziehung auch zwischen Hörern und Sendern, nur sind sie hier nicht direkt, sondern vielfach gebrochen und vermittelt. Diese Beziehungen zu ermitteln und darzustellen ist eine Aufgabe der Massenkommunikationsforschung, die zum Beispiel nachgewiesen hat, daß die Auswahl der Sendungen und die Art und Weise ihrer Deutung ganz wesentlich von bestimmten Personen der unmittelbaren Umgebung des Sehers abhängt - etwa von Eltern, Geschwistern, Freunden oder Lehrern. Auf diese Weise verschränken sich Massenkommunikation und unmittelbare Kommunikation miteinander.
Jenes Gefühl der Ohnmacht aber, das den Pädagogen angesichts der großartigen Möglichkeiten des Fernsehens befällt, ist offensichtlich ein wesentlicher Grund dafür, den großen Sendestationen jegliche Attribute von Bildung abzustreiten. Mit dem bösen Wort vom "geheimen Miterzieher" sucht man eine derartige Usurpation zu denunzieren. Vieles kommt dabei zusammen: Der Neid auf die besser ausgerüsteten Kollegen vom Funk, der antizivilisatorische Affront des Gebildeten, die aus der Hauslehrerperspektive stammende Überbetonung des unmittelbaren pädagogischen Umgangs und nicht zuletzt die Reduktion der Erziehungswissenschaft auf eine Wissenschaft vom Schulehalten. Eine der fortschrittlichsten Richtungen unter den gegenwärtigen Pädagogen ist die, die unter dem Stichwort des "Schulfernsehens" wenigstens einen Teil des Sendeprogramms unter das Gesetz der geplanten Unterrichtung und Erziehung stellen will.
Aber diese Versuche scheinen sang- und klanglos in der Versenkung verschwunden zu sein. Zwar kann man durchaus eine Reihe von Sendungen für Schulzwecke herstellen, aber letztlich bleibt das Fernsehen insgesamt gesehen eine eigenständige Institution. Paul Heimann, einer der wenigen Fachpädagogen, die sich sehr unkonventionell mit dem Fernsehen befassen, hat das so ausgedrückt: "Wir werden gut daran tun, uns an den Gedanken zu gewöhnen, daß wir es im gesamten Erziehungsraum von nun an mit zwei konkurrierenden Bildungsmodellen zu tun haben, die nicht nur unterschiedlichen Bildungsideen folgen, sondern auch sich in Gehäusen verschiedener gesellschaftlicher Struktur installiert haben. Auf der einen Seite steht das öffentliche Schulwesen vom Kindergarten bis zur Universität, auf der anderen die großen Sendestationen mit mehr oder weniger Öffentlichkeitscharakter."
Nachdem man lange Zeit Argumente dafür gesucht hat, wie man die Erziehungsfeindlichkeit der Massenmedien im allgemeinen und des Fernsehens im besonderen beweisen könne, ist es an der Zeit, einmal diejenigen Leistungen des Fernsehens zu nennen, die dem Bildungsgang der Person nicht hinderlich, sondern förderlich sind. Dazu folgende Thesen:
1. Das Fernsehen hat der Schule weite Teile der "Weltkunde" aus der Hand genommen. Vergleicht man Fernsehreportagen mit dem weithin noch üblichen "heimatkundlichen Prinzip" des Schulunterrichts, das die Welt vom Nahen zum Fernen aufbaut, so muß man sagen, daß das Wesentliche und Wichtige nicht im Schulunterricht aufgebaut wird, wenn man unter "wesentlich" die objektive Gewichtigkeit von Sachverhalten und Ereignissen versteht. Das gilt besonders für den Bereich der politischen Bildung. Indem das Fernsehen notwendigerweise bei seiner Auswahl diejenigen Inhalte bevorzugt, die für das gesamte Gemeinwesen von Bedeutung sind, setzt es objektive Maßstäbe für das, was politisch wesentlich ist oder nicht. Auf diese Weise leistet das Fernsehen das, was auch den Pädagogen unermüdlich beschäftigt: Die Fülle des Stoffes sinnvoll nach "wichtig" und "unwichtig" zu unterscheiden. Dabei bietet das Fernsehen einen weiteren interessanten Vergleich, es macht nämlich deutlich, wie sehr die Schule doch an eine mittelständische Vorstellung vom Menschen und der Welt gebunden ist, daß vieles, was den Schulpädagogen unabdingbar erscheint, in Wahrheit nur den Vorstellungen einer bestimmten sozialen Gruppe entspringt.
2. Durch die Kombination von Wort und Bild liefert das Fernsehen mehr Informationen pro Zeiteinheit als es jede andere Informationsquelle könnte. Man mache sich einmal die Mühe, daraufhin eine kurze Filmeinblendung in der Tagesschau zu überprüfen. Wenn zum Beispiel irgendwo in Asien ein Putsch ausbricht, so brauchte man viele Worte, um nicht nur die Tatsachen, sondern auch deren Hintergrund zu vermitteln. Eine Filmeinblendung von nur 30 Sekunden, die diese Aufgabe leistet, enthält neben den durch Worte vermittelten Nachrichten zahlreiche Informationen, die auf andere Weise gar nicht zu senden wären: Armut des Landes, Gegebenheiten der Geographie, Auftreten der politischen Führer, Habitus und Lebensstil der Bewohner usw.
Nun macht man gerade dies dem Fernsehen immer wieder zum Vorwurf, daß es eine bloß äußerliche Informiertheit erzeuge, die nicht zum Urteil führe Daran ist richtig, daß wir noch nicht gelernt haben, viele optische Informationen ins verbale Denken zu übersetzen und sie unserer Vorstellungswelt einzugliedern. Wir müssen - nicht nur im ästhetischen Sinne - sehen lernen. Außerdem brauchen wir stärker als in früheren Zeiten "Kategorien" für die Weltdeutung und die Aufnahme neuer Informationen. Zu einem Teil liefert das Fernsehen solche Kategorien schon mit, sie sind die Ordnungsprinzipien, mit denen es seine Stoffe strukturiert.
3. Damit entwickelt das Fernsehen eine eigentümliche Didaktik. Während allgemein in der Schule die Stoffe nach einem langfristigen, über Jahre sieh erstreckenden Plan von Stufe zu Stufe gegliedert sind, herrscht hier das Gliederungsprinzip der aktuellen Bedeutsamkeit kollektiver Konflikte vor. Ausgehend von aktuellen Problemen und Kontroversen entwickelt es dabei eine eigentümliche Form von "kategorialer Bildung", indem es nicht nur Tatsachen berichtet, sondern meist unausgesprochen auch die Gründe angibt, warum es diese Tatsachen für wichtig hält. Damit aber kann es gerade den schulischen Unterricht ungemein bereichern - ist es doch eine Form des modernen Lebens, das damit in die Schule gerät.
4. Darüber hinaus kann der Beitrag des Fernsehen zur Verhaltens- und Stilbildung gar nicht hoch genug angesetzt werden. Ich habe oft bemerkt, daß Lehrlinge und Jungarbeiter Fernsehsendungen mit Interesse sahen, die sie sachlich gar nicht interessierten - Interviews mit Politikern, Gespräche am runden Tisch usw. Für sie war der Kommunikationsvorgang als solcher, unabhängig von den diskutierten Inhalten, von Wichtigkeit: Wie man in einem solchen Falle miteinander redet, wie man peinliche Situationen überbrückt, wie man die Dame in der Runde anredet, wie man mit einem Minister umgeht usw. Für junge Leute, die in ihrem gesellschaftlichen Verhalten noch sehr unsicher sind, sind solche Sendungen um so wichtiger, je weniger wir uns bisher um die Betonung einer nicht-intimen, distanzierten Sozialität in den herkömmlichen pädagogischen Feldern bemüht haben, wie sie gerade in der Welt außerhalb der Schule abverlangt wird.
In diesen vier Punkten leistet das Fernsehen heute einen wesentlichen Anteil an der allgemeinen Bildung, und zwar gerade deshalb, weil es nicht nach den Regeln und Gesetzen der schulischen Bildung und Erziehung verfährt. Es hat damit Aufgaben übernommen, die früher ausschließlich oder doch überwiegend als Aufgaben der Schule angesehen wurden. Die Zeiten aber, wo die Schule als Sozialmodell und als Hüterin der kulturellen Tradition wie als Bildungsanstalt ausreichte, sind endgültig vorbei. Es gibt heut Bildungs- und Erziehungsaufgaben, die entweder garnicht oder nur schlecht bzw. weniger erfolgreich von der Schule geleistet werden können, und anstatt die moderne Bildungsproblematik immer nur in der verkürzten Form von "Schulreform" zu diskutieren, sollten wir erkennen, daß sich Schule und die anderen pädagogisch geplanten Felder nicht in einem luftleeren Raum befinden, daß - auch im positiven Sinne - mannigfache Bildung und Erziehung zwischen den Schulzeiten geschieht. Einen erheblichen Anteil daran hat das Fernsehen. Es wäre besser, wenn wir einmal zusammentrügen, was ohne geplante Pädagogik schon an Erziehung und Bildung geschieht, dann könnten wir genauer auch wieder die Aufgaben der Schule bestimmen, indem wir aus ihr u.a. das entfernen, was an anderen Stellen besser gemacht werden kann. Übrigbleiben dürfte dann das, was schon zu allen Zeiten wesentliche Aufgabe der Schule war: der planmäßige und systematische Unterricht, der dann allerdings in vielen Fächern guten Gewissens Ballast abwerfen könnte.
Ich werde das Gefühl nicht los, daß die meisten jener kulturkritischen Autoren, die im Namen der Aufklärung und Mündigkeit des Menschen gegen das Fernsehen agitieren - vielleicht gegen ihren Willen - auf der falschen Seite stehen. Es kann nämlich keinem Zweifel unterliegen, daß für die große Masse unseres Volkes das Fernsehen eine Bildungsrevolution größten Ausmaßes bedeutet. Wer sich darüber lustig macht, daß Millionen distanzlos sich diesem Medium hingeben, der sollte auch bedenken, was ihnen bisher vorenthalten wurde. Es gibt auch heute noch schulpolitisch unterentwickelte Gebiete in unserem Lande, wo selbst die schlechteste Fernsehsendung noch einen Fortschritt gegenüber dem bedeutet, was die allgemeine Schulbildung dort leistet. Jedenfalls sollten wir nicht zulassen, daß unter scheinhafter Verwendung pädagogischer Argumente für eine politische und gesellschaftliche Position optiert wird, die die provinzielle Beschränktheit der Massen zu ihrer Voraussetzung hat. Selbst der schärfste Kritiker des Fernsehens wird nicht leugnen können, daß die Sendestationen Maßstäbe für "wichtig" und "unwichtig" gesetzt haben: Über zahllose politische, pädagogische und weltanschauliche Provinzeleien kann man nur noch dort diskutieren, wo es noch kein Fernsehen gibt. Es liegt nahe, daß manchen gesellschaftlichen Mächten die Menschenführung dadurch schwerer wird. Das sollte man verstehen; aber man sollte nicht zulassen, daß sie sich weiterhin dabei falscher pädagogischer Argumente bedienen.
URL des Dokuments: : http://www.hermann-giesecke.de/werke3.htm
Inhaltsverzeichnis aller Bände