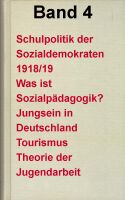 Hermann
Giesecke
Hermann
Giesecke
Gesammelte Schriften
Band 4: 1965
© Hermann Giesecke![]() Inhaltsverzeichnis
aller Bände
Inhaltsverzeichnis
aller Bände
![]()
Zu dieser Edition
Dieser 4. Band meiner gesammelten Schriften enthält Arbeiten aus dem Jahr 1965 . In dieser Zeit war ich (seit 1963) als Wissenschaftlicher Assistent am Institut für Pädagogik der Universität Kiel tätig. Nähere biographische Angaben finden sich in meiner Autobiographie Mein Leben ist lernen, Weinheim: Juventa Verlag 2000.Die Edition bemüht sich um Vollständigkeit. Nicht aufgenommen wurden selbständige Publikationen (Bücher) - in diesem Jahr erschien Didaktik der politischen Bildung, München 1965 - sowie ungedruckte Texte.Die Texte sind nach ihrem Erscheinungsjahr geordnet und von "1" an fortlaufend numeriert.
Die Plazierung der Fußnoten wurde vereinheitlicht; sie befinden sich nun am Ende des jeweiligen Beitrags. Offensichtliche Druckfehler wurden korrigiert. Darüber hinaus wurden die Originale jedoch nicht verändert. Nachträgliche Anmerkungen des Herausgebers sind durch (*) oder durch ein Namenskürzel ("H.G.") gekennzeichnet. Um die Zitierfähigkeit der Texte zu gewährleisten, wurden die ursprünglichen Seitenangaben mit aufgenommen und erscheinen am linken Textrand; sie beenden die jeweilige Textseite des Originals.
Inhalt von Band 4
35. Zur Schulpolitik der Sozialdemokraten in Preussen und im Reich 1918/19 (1965)
36. Der Jugendschutz bei Film und Fernsehen (1965)
37. Jungsein in Deutschland (1965)
38. Wandlungen in der Theorie der Jugendarbeit (1965)
39. Was ist Sozialpädagogik? (1965)
40. Sinn und Standpunkt der Jugendarbeit heute (1965)
41. Carlo Schmidt/Erich Ollenhauer (1965)
42. Tourismus als neues Problem der Erziehungswissenschaft (1965)
43. Gegen eine positivistisch verstandene "Erziehungswirklichkeit" (1965)
35. Zur Schulpolitik der Sozialdemokraten in Preußen und im Reich 1918/19 (1965)
(In: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, Heft 2/1965, S. 162-177)In unseren zeitgeschichtlichen Untersuchungen wird der Kultur- und Bildungspolitik immer noch geringe Bedeutung beigemessen. Dabei haben nicht nur der "Kulturkampf" Bismarcks, sondern vor allem die Probleme, die durch seine Beilegung nicht gelöst oder nicht einmal getroffen waren, die Gründung der Weimarer Demokratie und ihre Stabilisierung erheblich belastet. Der "Kampf um die Schule" wurde nach dem ersten Weltkrieg zu einem kaum lösbaren innenpolitischen Problem, das sich um so mehr mit Emotionen und Ressentiments besetzte, je aussichtsloser die Hoffnung auf eine befriedigende Lösung wurde. Für die Bedeutung des Themas kommt hinzu, daß nicht nur die nationalsozialistische Agitation von solcher Emotionalisierung profitierte, sondern daß auch das rücksichtslose Vorgehen der mitteldeutschen Machthaber in Fragen der "Schulreform" nach 1945 neben ideologischen auch historische und biographische Dimensionen aufweist. Sie haben eine Zeit erlebt, in der Schulpolitik gegen sie und ihre politischen Vorstellungen gemacht wurde. Dies würde vielleicht auch erklären, weshalb sich die Kommunisten am Anfang ihrer "Demokratischen Schulreform" auf eine breitere, keineswegs nur kommunistische Loyalität stützen konnten. Auch die aktuellen Diskussionen um die Schulreform in der Bundesrepublik sind von den historischen "Erinnerungen" der Weimarer Schulkämpfe überschattet - auch wenn diese zur Zeit eher verdrängt als ins kontrollierende Bewußtsein gehoben werden. Es wäre einer sachlichen und konstruktiven Erörterung unserer aktuellen Bildungsprobleme sicher dienlich, wenn dieser Bereich unserer jüngsten Geschichte, mit dem die heutigen Kulturpolitiker fast ausnahmslos biographisch verbunden sind, von der Forschung präziser geklärt würde.
Unsere Darstellung (1) behandelt die schulpolitische Tätigkeit der Sozialdemokratie in Preußen. Da aber der sogenannte "Sperrparagraph" der Weimarer Verfassung für die Schulpolitik der Länder, also auch Preußens, entscheidend wurde, muß sein Zustandekommen ebenfalls dargestellt werden. An dieser Stelle können wir dabei
162
nur auf einige Aktionen des sozialdemokratischen Kultusministeriums in Preußen sowie der sozialdemokratischen Fraktionen in der Landesversammlung und in der Nationalversammlung eingehen. In Wirklichkeit stand damals die Schulpolitik in einem komplizierten Zusammenhang vielfältiger Faktoren. Für die sozialistische Schulpolitik im einzelnen waren neben ihren Gegnern und neben dem theoretischen Programm (2) unter anderem auch der Deutsche Lehrerverein als größte Vereinigung der Volksschullehrer, die sozialistische Lehrerschaft, die sozialistische Jugendbewegung, die außenpolitische Pression, die emotionale revolutionäre Welle, die Parteispaltung, das "Erlebnis des Schützengrabens" und die Finanzmisere von bestimmendem Einfluß. Dieser Faktorenzusammenhang muß im folgenden mitbedacht werden, auch wenn wir auf ihn nicht mehr näher eingehen können.
1. Das Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung unter Haenisch und Hoffmann bis Ende 1918
Nachdem die Berliner Arbeiter- und Soldatenräte auf einer Versammlung im Zirkus Busch am 10. November 1918 beschlossen hatten, alle politischen Positionen paritätisch mit Mitgliedern der SPD und USPD zu besetzen, ernannte ihr Vollzugsrat den Mehrheitssozialisten Konrad Haenisch und den Unabhängigen Adolf Hoffmann zu Leitern des preußischen Kultusministeriums, das am 25. November auf Vorschlag von Hoffmann in "Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung" umbenannt wurde. Die Berufung Hoffmanns, Leiter der freireligiösen Gemeinde von Berlin und wegen seiner Schrift "Die zehn Gebote und die besitzende Klasse" als der "Zehn-Gebote-Hoffmann" bekannt, "rief heftige Proteste von seiten der Geistlichkeit und der akademisch gebildeten Lehrerschaft hervor" (3). Beide waren Mitglieder des preußischen Abgeordnetenhauses, wo schon der Gegensatz zwischen dem heftig im Berliner Dialekt polemisierenden Hoffmann zum gemäßigten, national gesinnten Haenisch offenbar wurde.
In dem Aufruf "An das preußische Volk", in dem die neue Regierung ihr Programm vorlegte, befindet sich auch eine Direktive für die Arbeit des Kultusministeriums:
"Ausbau aller Bildungsinstitute, insbesondere der Volksschule, Schaffung der Einheitsschule, Befreiung der Schule von aller kirchlichen Bevormundung, Trennung von Staat und Kirche (4)."
Um ein Gegengewicht gegen die im Sinne der neuen Regierung unzuverlässige Beamtenschaft zu schaffen, beriefen beide Minister je einen Beirat nach eigener Wahl. Haenischs Entscheidung fiel auf den nationalliberalen Oberlehrer Blankenburg und den Schulreformer Gustav Wyneken, Hoffmann bat den unabhängigen
163
Sozialisten Dr. Baege, den späteren Herausgeber der "Neuen Erziehung", und die Kommunistin Käthe Duncker, die aber nach Rücksprache mit ihrer Partei auf die Berufung verzichtete. Statt ihrer zog Hoffmann Fräulein Winkelmann hinzu. Beide aber unterstützten die radikale Haltung Hoffmanns nicht, wie er gehofft hatte. Die beiden Minister und die Beiräte sollten rechtskräftig beschließen, was "im Namen der Revolution" Gesetzeskraft erhalten sollte (5).
Bereits am 15. November unterzeichnete Hoffmann eine Verordnung über den Geschichtsunterricht, die Reinigung der Schulbibliotheken, die Unterbindung "konterrevolutionärer Propaganda" und die Befreiung Andersdenkender vom Religionsunterricht (6). Am 27. November hob er die geistliche Ortsschulaufsicht in Preußen auf und ersetzte sie durch Kreisschulinspektionen (7). Zwei Tage später, am 29. November, folgte die von Wyneken entworfene (8) und von Haenisch unterzeichnete Verordnung über den Religionsunterricht an der Schule, die zu einer der umstrittensten der folgenden Monate werden sollte. Nach einer weitschweifigen Begründung, die im wesentlichen die sozialdemokratische Darstellung des Verhältnisses von Religion und Schule enthält und die Absicht ausspricht, keinerlei Unterdrückung der religiösen Gefühle, sondern nur Gewissensfreiheit für alle Teile des Volkes in die Wege zu leiten, wird im einzelnen festgelegt:
"1. Das Schulgebet vor und nach dem Unterricht wird, wo es bisher noch üblich war, aufgehoben.
2. Eine Verpflichtung der Schüler seitens der Schule zum Besuch von Gottesdiensten oder anderen religiösen Veranstaltungen ist unzulässig.
3. Religionslehre ist kein Prüfungsfach.
4. Kein Lehrer ist zur Erteilung von Religionsunterricht oder zu irgendwelchen kirchlichen Verrichtungen verpflichtet, auch nicht zur Beaufsichtigung der Kinder im Gottesdienst.
5. Kein Schüler ist zum Besuch des Religionsunterrichtes gezwungen.
6. Es ist unzulässig, im Religionsunterricht der Schule häusliche Schularbeiten, insbesondere das Auswendiglernen von Katechismusstücken, Bibelsprüchen, Geschichten und Kirchenliedern aufzugeben."(9)Diese Verordnung drückt noch nichts spezifisch Sozialistisches aus, vielmehr handelt es sich hierbei um Forderungen aus den Reihen der bürgerlich-demokratisch orientierten Volksschullehrerschaft, die vor dem Kriege schon erhoben worden sind und sich in zahlreichen Verlautbarungen insbesondere des Deutschen Lehrervereins finden (10).
164
Dennoch setzten gegen diese Verordnungen vom 27. und 29. November stürmische Proteste vor allem der Katholischen Kirche und der ihr nahestehenden Kreise ein. Sie bekamen ihre außenpolitische Note dadurch, daß sich die linksrheinischen Loslösungsbestrebungen ihrer bemächtigten und mit der Losung "Euer Glaube ist in Gefahr" die Bevölkerung für ihre Bestrebungen zu gewinnen suchten (11).
Am 20. Dezember erließen die katholischen preußischen Bischöfe einen Hirtenbrief, der sich scharf sowohl gegen die Bestrebungen zur Trennung von Kirche und Staat wie gegen die obigen Verordnungen wandte (12). Haenisch setzte unter dem Druck dieser Proteste die Verordnung vom 29. November am 20. Dezember wieder außer Kraft, mit dem Hinweis, die Regelung dieser strittigen Frage der preußischen Nationalversammlung vorzubehalten (13). Zurückgenommen wurde auch die Verordnung vom 27. November über die Aufhebung der geistlichen Ortsschulaufsicht. Nachdem der preußische Episkopat gegen sie mit der Begründung protestiert hatte, Hoffmann habe sie ohne Zustimmung des preußischen Staatsministeriums publiziert, hob Haenisch sie am 15. 2. 1919 wieder auf (14).
Ende Dezember 1918 trennte sich Haenisch von Wyneken, weil, wie er ein Jahr später sich verteidigte, Wyneken zwar ein hervorragender Pädagoge sei, aber als typischer "Einzelgänger" nicht zu einer Zusammenarbeit mit den übrigen Mitarbeitern des Ministeriums gelangt sei. Die Zusammenarbeit sei vor allem auch daran gescheitert, daß Wyneken mit Hoffmann zusammen die wichtigsten Verordnungen vor Zusammentritt der preußischen Nationalversammlung durchsetzen wollte (15). Anfang Januar 1919 trat Hoffmann zusammen mit den übrigen "Doppel-
165
ministern" der Unabhängigen zurück, nachdem das Zentrum unter Beteiligung der Demokraten am Neujahrstag 1919 Protestdemonstrationen gegen ihn veranstaltet hatte. Mit seinem Rücktritt war die erste Phase des sozialistischen Kultusministeriums in Preußen beendet.
Die Koalition Haenisch-Hoffmann ist keineswegs aus Gründen der verschiedenen Zielsetzung, sondern an unüberbrückbaren taktischen Meinungsverschiedenheiten gescheitert. Hoffmann wollte die schwierige Frage der Trennung von Staat und Kirche und die anstehenden Fragen der Schulreform vor Zusammentritt der Landesversammlung lösen. Für ihn war der Arbeiter- und Soldatenrat die legitime politische Macht, der er sich verantwortlich fühlte. Haenisch glaubte im Gegensatz zu Hoffmann nicht, daß diese schwierigen Fragen mit einem Federstrich zu lösen seien, und gab seine Zustimmung zu den beiden "Novembererlassen" nur widerwillig, um zu verhindern, daß im Streitfalle der linksradikale Vollzugsrat entschied (16).
Es hatte sich in diesen Wochen gezeigt, daß das Zentrum, das sich vorübergehend "Christliche Volkspartei " nannte, der einzige ernsthafte schulpolitische Gegner auf parlamentarischer Ebene sein würde. Nachdrücklich unterstützt wurde es vom katholischen Episkopat, der in dem schon angeführten Hirtenschreiben der sozialistischen und demokratischen Forderung nach weltanschaulicher Gleichberechtigung die Absicht einer Vernichtung von Kirche und Religion unterstellte und von einer Trennung von Staat und Kirche "unermeßliches sittliches Chaos" und das Ende jeder staatlichen Ordnung schlechthin erwartete (17).
Der Versuch, die Herrschaft der Kirchen über die Schulen nach der Revolution handstreichartig zu beseitigen, war also gescheitert und die Lösung dieser Fragen der preußischen Landesversammlung überantwortet.
2. Der Kampf um die Schulaufsichtsgesetze mit dem Zentrum in der Landesversammlung
Die Wahl zur Landesversammlung, die durch Hoffmanns Radikalismus nicht unwesentlich zu Ungunsten der sozialistischen Parteien beeinflußt worden sein
166
dürfte, hatte den Sozialdemokraten 145 und den Demokraten 65 Sitze gebracht, was gegenüber einer Gesamtzahl von 401 die Mehrheit von 210 Abgeordneten bedeutete. Welche Gründe veranlaßten die sozialdemokratische Fraktion dennoch, die Koalition mit dem Zentrum zu suchen (18)? Für die Koalition im Reich war die Begründung einleuchtend, daß für die bevorstehenden außenpolitischen Entscheidungen (Friedensvertrag) eine möglichst breite parlamentarische Basis gefunden werden müsse. In diesem Zusammenhang konnte es zweckmäßig erscheinen, auch im größten Bundesland mit derselben politischen Breite zu arbeiten. Darüber hinaus wollten sich die Sozialdemokraten offensichtlich im Hinblick auf spätere Wahlen die Mitarbeit des Zentrums an einer gemeinsamen Regierungsarbeit sichern, wenn sie ohne allzu schwere Opfer zu erlangen war. Der entscheidende Grund aber für die Hereinnahme des Zentrums lag in den bedrohlichen Separationsbestrebungen in Schlesien und im Rheinland, mit denen sich das Zentrum nie offiziell identifizierte, die es aber immer wieder geschickt ins Spiel brachte, wobei es noch den Sozialdemokraten die Schuld zuzuspielen wußte (19). Der von der Mehrheitsfrage her gesehen unnötige Eintritt des Zentrums in die Regierung Preußens ist eine der folgenschwersten kulturpolitischen Entscheidungen des Jahres 1919 gewesen. Demokraten und Sozialdemokraten hätten ohne das Zentrum mit ihrer Stimmenmehrheit sicherlich in diesem Jahr in der Landesversammlung die wichtigsten Schulreformgesetze durchgebracht. Am 25. März stellte sich die erste parlamentarische Regierung Preußens der Landesversammlung vor. Sie setzte sich aus 5 Sozialdemokraten und je 2 Mitgliedern des Zentrums und der Demokraten zusammen. Haenisch blieb weiterhin im Amt, ihm wurden allerdings vom Zentrum der Prälat Rudolf Wildermann und von den Demokraten Professor Troeltsch als parlamentarische Staatssekretäre an die Seite gestellt. Im Regierungsprogramm nimmt der kulturpolitische Teil einen breiten Raum ein (20). Es handelte sich um eine geschlossene Konzeption der Demokraten und Sozialisten, in die das Zentrum nicht eine einzige seiner Forderungen einbauen konnte. Daß es sich trotzdem in die Regierung begab, zeigt, wie schwach seine Position in Wirklichkeit war. Demokraten und Sozialdemokraten setzten mit diesem Programm zum Generalangriff auf die kirchlichen Positionen in der Schule an. Für das Zentrum ging es dabei nicht nur um eine grundsätzliche Frage seines weltanschaulich unterbauten Programms, für das der Anspruch der Kirche auf die Schule einfach konstitutiv war, sondern auch um eine Frage seiner Existenz als politischer Partei überhaupt; denn abgesehen von dem Festhalten an seinen kulturpolitischen Grundsätzen wies sein Programm gegenüber den anderen Parteien wenig Originalität auf. Die Partei war klug genug, die Wichtigkeit einer Beteiligung von Anfang an, wenn auch zunächst um jeden denkbaren Preis, klar zu erkennen und für die Zukunft auf ihre parlamentarische Taktik zu vertrauen.
167
Von den schulpolitischen Auseinandersetzungen in der Landesversammlung seien im folgenden die Kämpfe um die beiden Gesetze zur Aufhebung der geistlichen Schulaufsicht und zur Änderung der Zusammensetzung der Schuldeputation herausgegriffen, weil das erste den größten kulturpolitischen Triumph der Sozialdemokratie und das zweite ihre endgültige Niederlage kennzeichnet.
Das Schulaufsichtsgesetz vom 11. März 1872 bestimmte:
1. Die Aufsicht über alle öffentlichen und Privatunterrichtserziehungsanstalten obliegt dem Staate. Demgemäß handeln alle mit dieser Aufsicht betreuten Behörden und Beamten im Auftrage des Staates.
2. Die Ernennung der Lokal- und Kreisschulinspektoren gebührt dem Staate allein. Der vom Staat erteilte Auftrag ist jederzeit widerruflich.
Auch nach diesem Gesetz, dessen Annahme das Zentrum mit Leidenschaft bekämpft hatte, lag die Schulaufsicht, vor allem auf dem Lande, weiterhin praktisch in der Hand der Kirchen, aber die Geistlichen waren nun nicht mehr ex lege, sondern nur noch ex conventione Aufsichtsbeamte.
Die Frage der geistlichen Schulaufsicht wurde in der Landesversammlung von einer Seite auf die Tagesordnung gesetzt, von der man es am wenigsten vermutet hätte: von den Deutschnationalen. Am 11. April 1919 verhandelte die Versammlung über ihren Antrag, "die Regierung zu ersuchen, baldigst die geistliche Schulaufsicht in der Volksschule aufzuheben''(21). Die in dieser Partei vor allem beheimateten protestantisch-agrarkonservativen Kreise hatten bisher die Aufsicht der Geistlichen über die Schule in dem Maße als selbstverständlich angesehen, wie der protestantische Geistliche sich selbst als Staatsbeamter fühlte. Das Festhalten beider Kirchen an der Schulaufsicht hatte für jede von ihnen historisch wie dogmatisch völlig verschiedene Gründe. Als die Revolution die Trennung von preußischer Staatsgewalt und Kirche auf die Tagesordnung gesetzt hatte, sahen die Konservativen keine Ursache mehr, an einer Einrichtung festzuhalten, die nach ihrer Ansicht doch nicht mehr zu halten war. So ergriffen sie in dieser Frage die Initiative, um sich dadurch die Volksschullehrerverbände gewogen zu machen. In der ihrem Antrag folgenden Diskussion teilte der Kultusminister mit, daß in seinem Ministerium ein Gesetzentwurf ausgearbeitet werde, der die Ortsschulaufsicht generell aufheben und an ihre Stelle die Kreisschulaufsicht durch Fachleute setzen solle.
Am 23. und 27. Mai fand die erste Lesung dieses Gesetzentwurfes im Plenum der Landesversammlung statt. Er lautete:
"Für den Umfang des Staatsgebietes wird verordnet:
§ 1: Das Amt des Lokalschulinspektors wird aufgegeben. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erlischt die Amtsbefugnis der bisherigen Lokalschulinspektoren.
§ 2: Die Schulaufsichtsbebörden sind befugt, die bisher den Lokalschulinspektoren obliegenden Geschäfte, soweit sie nicht wegfallen können, und die mit dem Amte als Lokalschulinspektor nach gesetzlicher Vorschrift oder durch Verwaltungs-168
anordnung allgemein oder im einzelnen Falle verbundenen Geschäfte anderweitig auf Behörden oder einzelne Fachleute zu übertragen.
§3: Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Oktober 1919 in Kraft"(22).Das Zentrum hatte sich schon in der vorausgehenden Diskussion über den Antrag der Deutschnationalen zur Zustimmung bereit erklärt, wenn der Einfluß der Kirche auf die Schule anderweitig sichergestellt werde. Daran dachten selbstverständlich weder die Sozialisten noch die Demokraten.
Am 27. Mai wurde der Entwurf dem erweiterten Unterrichtsausschuß überwiesen, wo er am 3. und 9. Juli beraten wurde(23). Hier setzte der Sprecher des Zentrums auseinander, wie er sich die Sicherstellung des kirchlichen Einflusses auf die Schule denke. Der Ausschußantrag des Zentrums forderte die Bildung von Schulbeiräten aus Vertretern der Eltern, der Lehrer, der Gemeindebehörden und der Religionsgesellschaften; bis zum Erlaß eines entsprechenden Gesetzes sollten die kirchlichen Behörden das Recht haben, den Kreis- und Bezirksschulbehörden Vertrauensmänner zu benennen, die in allen Fragen der sittlichen und religiösen Erziehung ihrer Angehörigen gehört werden müßten; schließlich sollten die den Religionsunterricht erteilenden Geistlichen als Mitglieder des Lehrkörpers der Schule gelten und als solche Sitz und Stimme in der Systemkonferenz haben. Diesen Antrag lehnte der Ausschuß ab. In der Abstimmung stimmte das Haus - also auch das Zentrum - einstimmig für den § 1 des Gesetzentwurfes, die übrigen Paragraphen wurden mit Mehrheit angenommen. Das Zentrum war klug genug, sich nicht durch Ablehnung der gesamten Vorlage die unnötige Feindschaft der sehr mächtigen und einflußreichen Lehrerverbände zuzuziehen, zumal sie in jedem Falle angenommen worden wäre. Es brachte aber bei der zweiten Lesung seine Ausschußanträge noch einmal vor dem Plenum erfolglos ein, so daß der Entwurf am 18. Juli in dritter Lesung von allen Parteien gegen die Stimmen des Zentrums angenommen wurde. Diese Isolierung des Zentrums stellte den Höhepunkt der sozialistischen Schulpolitik in Preußen dar (24).
Nach Überwindung zahlreicher Schwierigkeiten, die vor allem das Zentrum einer allgemeinen gesetzlichen Regelung in Preußen bereitete, war am 28. Juli 1906 das "Gesetz betreffend die Unterhaltung der öffentlichen Volksschulen" (25) zustande gekommen, das den ständigen Kämpfen der letzten Jahrzehnte zwischen Staat und Kirche um die Volksschule für einige Zeit ein Ende setzte. Dieses Gesetz hatte es in erster Linie mit der Regelung der Volksschullasten zu tun, darüber hinaus aber enthielt es Bestimmungen über die konfessionellen Verhältnisse (§§ 33 bis 42) und die Verwaltung der Volksschulangelegenheiten (§§ 43-57). Der Streit
169
um den konfessionellen Charakter der Volksschule war in diesem Gesetz im wesentlichen zugunsten der Konfessionsschule entschieden worden (§§ 33, Abs. 1), daneben hatte aber auch die Simultanschule die gesetzliche Anerkennung erlangt (§ 36). Da die Volksschule durch dieses Gesetz "kommunalisiert" wurde, spielten seine Bestimmungen über die Schuldeputationen (in Stadtgemeinden) und Schulvorstände (in Landgemeinden) eine große Rolle, da diese Körperschaften weitgehende Kompetenzen hatten (26). Sie setzten sich zusammen aus Mitgliedern des Gemeindevorstandes und der Stadtverordnetenversammlung, Vertretern der Eltern und Lehrer und schließlich dem Ortsgeistlichen, der im Regelfalle zugleich der Vorsitzende des Schulvorstandes war. Der Ortsgeistliche war als Vertreter seiner Kirche von Amts wegen Mitglied dieser Behörde, die übrigen Mitglieder wurden ernannt bzw. gewählt (27). Es ist klar, daß diese Position der Geistlichen der Kirche einen starken Einfluß auf die unmittelbare Schulwirklichkeit ermöglichte, wovon vor allem die Lehrer betroffen wurden.
Noch bevor der Gesetzentwurf, der die geistliche Schulaufsicht beseitigen sollte, alle parlamentarischen Instanzen passiert hatte und endgültig angenommen war, hatte der Kultusminister am 3. Juli 1919 der Landesversammlung den "Entwurf eines Gesetzes betreffend die Abänderung der Zusammensetzung der Schuldeputationen, Schulvorstände und Schulkommissionen" vorgelegt (28). Seine Kernbestimmung war, daß der Geistliche in Zukunft nicht mehr von Amts wegen, sondern ebenfalls nur als gewähltes Mitglied dem Gremium angehören dürfe. "Nachdem die Geistlichen das passive Wahlrecht zu kommunalen Ämtern erlangt haben", so heißt es in der Vorlage, "kann die Vorschrift entbehrt werden, nach der sie von Amts wegen dem Schulvorstande angehören"(29).
Die Tatsache, daß diese Vorlage noch vor der Verabschiedung der oben genannten Gesetzesvorlage über die Schulaufsicht, die den erbitterten Widerstand des Zentrums hervorgerufen hatte, und in den Tagen der Unterzeichnung des Friedensvertrages eingebracht wurde, mag als Beweis dafür gelten, daß Haenisch fest entschlossen war, die starke Position der Sozialdemokratie in der Landesversammlung auszunutzen, um die bedeutsamsten schulpolitischen Forderungen seiner Partei auf gesetzgeberischem Wege durchzusetzen. Die erste Lesung fand am 9. Juli vor dem Plenum statt. Einleitend teilte der Vertreter der Unterrichtsverwaltung mit, daß seinem Chef an der Verabschiedung der Vorlage "außerordentlich viel" liege; die Staatsregierung habe die Absicht, noch eine ganze Reihe anderer Bestimmungen des alten Volksschulunterhaltungsgesetzes abzuändern; die Bestimmungen des vorliegenden
170
Entwurfs erschienen ihr aber so wichtig, daß sie es für notwendig gehalten habe, sie der Landesversammlung vorweg zur Beschlußfassung vorzulegen (30).
Das Zentrum bezog sich auf eine formulierte Erklärung, die seine Fraktion wenige Tage vorher, am 3. Juli, bei der Beratung der Vorlage betreffend die Aufhebung der geistlichen Schulaufsicht abgegeben hatte. In ihr war, wiederum mit dem Hinweis auf die gefährdeten Grenzgebiete, die Erwartung ausgesprochen worden, daß die Sozialdemokratie den schulpolitischen Forderungen des Zentrums entgegenkommen werde. Der Gesetzentwurf werfe einen großen Zündstoff in weiteste Kreise der gläubigen Volksmassen hinein und bedeute zweifellos eine Vergewaltigung der katholischen Minderheit. Da die Deutschnationalen und die Deutsche Volkspartei die Bestimmungen der Vorlage, die sich auf die Mitgliedschaft der Geistlichen bezogen, ablehnten, war die Erklärung der Demokraten, ihre Fraktion behalte sich die Entscheidung über diese Frage vor, um so bedeutsamer. Dennoch mußte die Annahme auch dieses Gesetzes als gesichert erscheinen, als dem Zentrum eine unerwartete Hilfe kam. Am 14. August trat die Reichsverfassung in Kraft. Nun behauptete es, die Bestimmung des Gesetzentwurfs über die Stellung der Geistlichen in der Schuldeputation stehe im Widerspruch zum "Sperrparagraphen" 174 der Reichsverfassung. Das Zentrum forderte ein Rechtsgutachten des Reiches an. Das von den Reichsministern des Innern und der Justiz, Koch und Schiffer, erstattete Gutachten (31) gab dem Zentrum recht. Ein Gegengutachten (32) des preußischen Kultusministeriums fand nicht die Zustimmung der Reichsstellen. Damit war, kaum daß die Reichsverfassung verabschiedet war, zum ersten Mal die hemmende Wirkung des Sperrparagraphen für die Landesgesetzgebung deutlich geworden, der in der Folge, als das erhoffte Reichsgesetz nicht zustande kam, das verfassungsmäßige Instrument wurde, mit dem langsam aber sicher die Schulpolitik wieder in die Hände der bürgerlichen Parteien glitt. Haenisch hat nach der zweiten Lesung seinen Rücktritt erwogen (33).
3. Die Bedeutung des Weimarer Schulkompromisses für die preußische Schulpolitik
Die Novemberrevolution hatte für die Frage der reichsgesetzlichen Regelung des Schulwesens eine neue politische Situation geschaffen. Während vor dem Kriege den Rechtsparteien und dem Zentrum im Zeichen des Dreiklassenwahlrechts in Preußen die Erhaltung der bestehenden Schulverhältnisse so lange gesichert er-
171
scheinen konnte, wie die Schulfrage Sache der Länder blieb, mußte die Sozialdemokratie aus demselben Grunde bestrebt sein, die Entscheidung über Schulfragen dem Reich zuzuweisen, weil dort das gleiche Wahlrecht galt. Die wichtige Schulfrage sollte "aus den Dunkelkammern der einzelstaatlichen Parlamente, besonders aus der preußischen Hochburg des Junker- und Pfaffentums, in das hellere Licht und die freie Atmosphäre des Reichstages" gehoben werden (34). So war die sozialistische Forderung nach reichsgesetzlicher Regelung des Schulwesens sowohl eine prinzipielle - sie folgte aus der Konzeption der Einheitlichkeit - wie eine taktische. Nach der Revolution zeigte sich, daß gerade die Länder sich zu radikalen schulpolitischen Maßnahmen entschlossen, so daß die Konservativen sich vor die Frage gestellt sahen, ob sie den Kampf dagegen in den Ländern oder im Reich aufnehmen sollten, während die Sozialdemokratie ihren alten Wunsch nach reichsgesetzlicher Regelung durchsetzen zu können glaubte.
Wir können hier die hartnäckigen Auseinandersetzungen zwischen den drei Koalitionsparteien im Verfassungsausschuß der Nationalversammlung bis zur ersten Lesung im Plenum übergehen. Die zunächst einheitliche Konzeption der Sozialdemokraten und Demokraten zerbrach, als die Sozialisten die Entfernung des Religionsunterrichts aus der Schule, also die weltliche Schule, forderten, während die Demokraten bei dem ursprünglichen Entwurf blieben, der diese Frage der Gesetzgebung überließ (35). Sie wollten diese Frage überhaupt nicht in der Verfassung verankern. Diesen Zwiespalt griff das Zentrum geschickt auf und kam dadurch Stück für Stück seinem Ziel näher (36). Dennoch war es noch weit davon entfernt, denn in der endgültigen Formulierung des Verfassungsausschusses zur ersten Lesung hieß es: "Ob und inwieweit bei der Gliederung der Volksschule Kinder des gleichen Bekenntnisses auf Antrag der Erziehungsberechtigten vereinigt werden können, bestimmt die Gesetzgebung" (37).
So weit waren die Verhandlungen gediehen, als die Nationalversammlung vor die Aufgabe gestellt wurde, den Versailler Vertrag anzunehmen oder zurückzuweisen. Nachdem sie sich mit Mehrheit für seine Unterzeichnung ausgesprochen hatte, traten die Demokraten aus der Regierung aus. Das Zentrum, das seine Chance sah, war zur weiteren Mitarbeit in der Regierung bereit, wenn eine Einigung mit den Sozialdemokraten hinsichtlich der Schulparagraphen der Verfassung erreicht werde. Unmittelbar nach dem Austritt der Demokraten aus der Regierung erschien beim Reichspräsidenten Ebert eine Zentrumsabordnung, die in diesem Sinne ihre Mitarbeit anbot, worauf Ebert Heinrich Schulz, der dem Verfassungsausschuß nicht angehörte, um die Leitung der Besprechungen auf sozialdemokratischer Seite bat (38). An diesen inoffiziellen Besprechungen vor der zweiten Lesung
172
der Verfassung im Plenum nahmen vom Zentrum Gröber, Hitze, Mausbach und Burlage, von sozialdemokratischer Seite außer Schulz Reichsminister David und die Abgeordneten Pfülf und Katzenstein teil (39). Ihr Ergebnis nach langwierigen Verhandlungen war die gegenseitige grundsätzliche Anerkennung der weltlichen und der konfessionellen Schule unter Verzicht auf die einseitige Durchsetzung des einen oder anderen Schultyps durch die Verfassung. Diesen beiden Schultypen wurde die Simultanschule ebenfalls gleichgestellt. Private Vorschulen wurden als "unzulässig" angesehen, der Kreis der für den Besuch der höheren Schulen staatlicherseits zu fördernden Schüler durch die Änderung des Ausdrucks "Unbemittelter" in "Minderbemittelter" erhöht und die Errichtung privater Volksschulen für weltanschauliche Minderheiten, an denen dem Zentrum wegen der Kloster- und Schwesternschulen lag, gestattet. Außerdem erreichte die Mehrheitssozialdemokratie in der Bestimmung über die Teilnahme am Religionsunterricht die Wiederherstellung der im Verfassungsausschuß durchgefallenen Forderung, daß ihm die positive Erklärung der Eltern vorausgehen müsse (40). Die die Konfessionsschulen betreffende Fassung lautete jetzt (Art. 134, Abs. 2):
"Ob und inwieweit die Volksschulen innerhalb der Gemeinden für alle Bekenntnisse gemeinsam oder nach Bekenntnissen getrennt oder bekenntnisfrei (weltlich) sein sollen, entscheidet der Wille der Erziehungsberechtigten, soweit dies mit einem geordneten Schulbetrieb zu vereinen ist. Das Nähere bestimmt ein baldigst zu erlassendes Reichsgesetz. Bis zum Erlaß dieses Gesetzes bleibt es bei den bestehenden Vorschriften" (41).
Im letzten Satz ist der spätere Artikel 174 der Reichsverfassung schon vorbereitet. Überraschenderweise stimmten nun die beiden Rechtsparteien, die bisher die Schulforderungen des Zentrums unterstützt hatten, zusammen mit den Demokraten und der USPD gegen den Kompromiß. Von den Mehrheitssozialisten stimmte nur ein Teil dafür, "ein anderer verließ fluchtartig den Saal, als die Abstimmung begann" (42). Da die Demokraten in großer Zahl zu ihrem Parteitag abgereist waren, wäre bei vollbesetztem Haus vermutlich eine Ablehnung erfolgt.
Dieser Kompromiß stieß erwartungsgemäß in breiten Teilen der Öffentlichkeit auf heftigsten Widerspruch. Der geschäftsführende Ausschuß des Deutschen Lehrervereins drahtete nach Weimar, daß er "eine verhängnisvolle Preisgabe staatlicher Hoheitsrechte" zur Folge habe und daß es "ein Unrecht an der Jugend des Volkes" sei, "wenn die Volksschule bekenntnismäßig gestaltet wird, während die Mittel-
173
und höheren Schulen von dieser Bindung befreit sind" (43). Der "Verband sozialistischer Lehrer und Lehrerinnen" protestierte ebenso gegen die Aufgabe der weltlichen Schule (44) wie der "Bund entschiedener Schulreformer", in dessen Namen Paul Oestreich von einem "inneren Versailles " sprach. Die Fahne der sozialistischen Schule sei von den Kompromißmachern heruntergeholt worden (45). Der preußische Lehrerverein drohte mit Ablehnung des Religionsunterrichts, "wenn der Kirche künftighin noch irgendwelche Aufsichts- und Leitungsbefugnisse über die Schule im allgemeinen und den Religionsunterricht im besonderen zugestanden werden sollten" (46). Auf Initiative des preußischen Kultusministers richteten die einzelstaatlichen Minister an die Reichsregierung eine Protestnote, in der sie eine kulturelle und finanzielle Bedrohung der Länder konstatierten, die zwischen den Erziehungsberechtigten und der Reichsgesetzgebung ausgeschaltet würden. Die Lehrerorganisationen seien "in ihrer überwiegenden Mehrheit" anderer Meinung als die Verfassungsbestimmungen. "Überdies enthalten die Schulartikel Bestimmungen, die vom verwaltungstechnischen Standpunkte aus in höchstem Maße bedenklich und für den größeren Teil des Reiches undurchführbar sind. Sollten sich aus der neuen Gestaltung der Dinge Schwierigkeiten ergeben, so müssen wir unsererseits alle Verantwortung dafür ablehnen"(47). Folgenden Antrag nahmen die Demokraten auf ihrem gleichzeitig stattfindenden Parteitag fast einstimmig an:
"Das neue Schulkompromiß bedeutet die völlige Preisgabe der nationalen Einheitsschule. Es verschachert unsere Jugend an die politischen Parteien, vergiftet damit das Verhältnis zwischen Elternhaus und Schule und vernichtet jede Möglichkeit zum organischen Ausbau der Schule auf freiheitlich nationaler Grundlage. Der Parteitag fordert von der Fraktion, daß sie aus erzieherischen und allgemein politischen Gründen die Durchführung dieser Vereinbarung mit allen verfassungsmäßig zulässigen Mitteln und in der schärfsten Form verhindert"(48).
Vor allem diese offene Kampfansage der Demokraten und die rein zufällige Mehrheit in der zweiten Lesung haben wohl die beiden Kompromißparteien bewogen, zwischen der zweiten und dritten Lesung im Plenum die Demokraten wieder am Schulkompromiß zu beteiligen, zumal sonst ein Kulturkampf kaum verhindert worden wäre. Außerdem waren die Schulartikel die einzigen, über die mit den Demokraten keine Einigung in der zweiten Lesung erzielt werden konnte. So fanden erneut vertrauliche Besprechungen statt, an denen nun zusätzlich von der DDP die Abgeordneten Weiß, Seyfert, Schiffer und Luppe teilnahmen (49). Der daraufhin in dritter Lesung am 31. Juli angenommene endgültige Wortlaut brachte gegenüber dem Text der zweiten Lesung im Sinne der SPD lediglich eine einzige günstigere Formulierung, die den Begriff des "geordneten Schulbetriebes" etwas
174
präzisieren sollte. Durch den Zusatz "auch im Sinne des Absatzes 1 " sollte durch die Konfessionalisierung des Schulwesens wenigstens nicht der organische Übergang in die höheren Schulen verhindert oder erschwert werden; denn als "geordnet" konnte auch eine einklassige Volksschule gelten. In den Verhandlungen hatte das Zentrum deutlich werden lassen, daß es an eine solche Auslegung dachte (50). Die Bestimmung über die konfessionelle Volksschule lautete jetzt (Art. 143, Abs. 2):
"Innerhalb der Gemeinde sind indes auf Antrag von Erziehungsberechtigten Volksschulen ihres Bekenntnisses oder ihrer Weltanschauung einzurichten, soweit hierdurch ein geordneter Schulbetrieb, auch im Sinne des Absatzes eins, nicht beeinträchtigt wird. Der Wille der Erziehungsberechtigten ist möglichst zu berücksichtigen. Das Nähere bestimmt die Landesgesetzgebung nach den Grundsätzen eines Reichsgesetzes".
Am wichtigsten aber für die praktische Schulpolitik in den Ländern wurde der Artikel 174 der Reichsverfassung:
"Bis zum Erlaß des in Art. 146, Abs. 2 vorgesehenen Reichsgesetzes bleibt es bei der bestehenden Rechtslage. Das Gesetz hat Gebiete des Reiches, in denen eine nach Bekenntnissen nicht getrennte Schule gesetzlich besteht, besonders zu berücksichtigen".
Für Preußen bedeutete diese Bestimmung die Erhaltung der im Schulunterhaltungsgesetz vom Jahre 1906 festgelegten Konfessionsschule.
In Ausübung seiner gesetzgeberischen Kompetenz erließ das Reich durch die Nationalversammlung am 21. April 1920 ein Grundschulgesetz, das die vierjahrige gemeinsame Grundschulzeit obligatorisch festlegte und zudem den ersten vier Jahresklassen ausdrücklich die Aufgabe der Vorbereitung für die höhere Schule stellte.
Die Öffentlichen Vorschulen und Vorschulklassen sollten bis spätestens zum Beginn des Schuljahres 1924/25 aufgelöst sein, die privaten wegen der damit für sie verbundenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten bis spätestens zum Beginn des Schuljahres 1929/1930 (51). Alle weiteren Versuche in den Jahren 1921, 1925 und 1927, zu einer vollständigen Reichsgesetzgebung vor allem zum Artikel 146, Abs. 2 der Reichsverfassung zu gelangen, scheiterten teils aus finanziellen, teils aus innerpolitischen Gründen.Da das Reich bislang keine eigene Schulverwaltung besaß, konnte es wohl Gesetze erlassen, aber nicht auch selbst ausführen. Außerdem hatte die Reichsverfassung nicht festgelegt, wer die Kosten zu tragen haben würde. Schließlich war die Bestimmung der Reichsverfassung in Art. 146 Abs. 2 juristisch nicht eindeutig. Es blieb umstritten, ob die drei Schultypen gleichberechtigt seien, oder ob die Gemeinschaftsschule als Regel, die anderen unter den angegebenen Bedingungen als gestattete Ausnahmen gelten sollten (52). Einzig eindeutig war die Bestimmung des Sperrparagraphen, der es bei den bestehenden rechtlichen Vorschriften zunächst beließ.
175
Damit hatte das Zentrum seine Schulforderungen durchgesetzt, was ihm als Minderheitspartei in den meisten Ländern des Reiches im parlamentarischen Kampf nicht gelungen wäre, zumal es auf die Hilfe der protestantischen Kreise, wie die Auseinandersetzungen in der Landesversammlung gezeigt hatten, nur bedingt rechnen konnte. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kam der Sperrparagraph durch ein geschicktes Zusammenspiel der Zentrumsfraktionen Preußens und des Reiches zustande, war seine unmittelbare Ursache die drohende Annahme des Haenischen Gesetzentwurfes über die Zusammensetzung der Schuldeputationen (53). Wie widersprüchlich einzelne Verfassungsbestimmungen zueinander standen, geht daraus hervor, daß z. B. den Lehrern die Erteilung des Religionsunterrichts freigestellt war (Art. 149 RV). Daraufhin erklärten in einigen Orten die Eltern, sie wollten ihre Kinder auch in anderen Fächern nicht mehr von Lehrern, die von diesem verfassungsmäßigen Recht Gebrauch gemacht hatten, unterrichten lassen. Schulstreiks folgten, deren größter sechs Wochen lang unter Beteiligung von 6000 Kindern in Herne dauerte (54). Den Schulstreiks von rechts folgten solche von links. Das Ministerium konnte derart beanstandete Lehrer nicht an weltliche Schu-
176
len versetzen, weil solche infolge Art. 174 der Reichsverfassung nicht errichtet werden durften. Deshalb forderte Haenisch so unermüdlich wie erfolglos ein "Notgesetz", das wenigstens die Errichtung weltlicher Schulen zuließ (55).
So war nach der revolutionären Methode Hoffmanns auch die parlamentarische gescheitert, der Haenisch den Vorzug gegeben hatte. Die Zeit für eine Schul- und Hochschulreform war überreif, aber es gelang nicht, die politisch wirksamen Bevölkerungsgruppen dafür zu gewinnen. Die entscheidenden Probleme blieben auch im weiteren Verlauf der Republik ungelöst, gerieten sogar zeitweilig überhaupt aus dem Bewußtsein - bis die Nationalsozialisten auf ihre Weise den Knoten zerschlugen. Die gemeinsame kulturpolitische Energie von Sozialdemokraten, Demokraten und Deutschem Lehrerverein war um 1920 schon gebrochen. Was davon übrigblieb und sich um den kulturpolitischen Torso der Republik rankte, waren unter anderem reformpädagogische Theorien, deren unpolitisches Selbstverständnis viel von politischer Resignation an sich hatte.
177
Anmerkungen:
(1) Für diese Darstellung konnte nur gedrucktes Material verwendet werden. Leider sind große Teile der publizistischen Literatur jener Jahre verloren. Ein Aktenstudium an den Beständen des ehemaligen preußischen Kultusministeriums, die sich zum großen Teil in der SBZ befinden, war ebenso unmöglich wie eine Durchsicht des Materials aus dem Parteiarchiv in Amsterdam oder auch Interviews mit noch lebenden Beteiligten. Schließlich gibt auch die sonst so reiche Memoirenliteratur für unseren Gegenstand so gut wie nichts her.
Die Arbeit von Reinhold Fauth: Der Kampf um die Schule in der verfassunggebenden Preußischen Landesversammlung (1919-1921), phil. Diss. (maschinenschr.) Berlin (Humboldtuniversität) 1948, stützt sich lediglich auf die ohnehin leicht zugänglichen Sitzungsberichte der preußischen Landesversammlung.
Lediglich die sowjetzonale Geschichtsschreibung hat sich näher mit dem Gegenstand befaßt. Das meiste ist politische Auftragsfertigung. Wichtig sind die dabei veröffentlichten Quellen.
(2) Vgl. Protokoll über die Verhandlungen des Parteitags der SPD, abgehalten zu Mannheim, vom 23. - 29. Sept. 1906, Berlin 1906; und Heinrich Schulz: Die Schulreform der Sozialdemokratie. Dresden 1911.
(3) Eduard Bernstein: Die deutsche Revolution. Berlin 1921, S. 51.
(4) Zit. nach Johannes Tews: Sozialdemokratie und öffentliches Bildungswesen, Langensalza, 1921, S. 78.
(5) Adolf Hoffmann: Unter den Linden 4, in: Die Revolution. Unabhängiges sozialdemokratisches Jahrbuch zur Politik und proletarischen Kultur des Jahres 1920. Berlin 1920, S. 180 f.
(6) Zentralblatt für die gesamte Unterrichtsverwaltung in Preußen, Jg. 1918, S. 708/709.
(7) Gesetze und Verordnungen der sozialistischen Republik, o. O. o. J., S. 4, zit. nach: G. Hohendorf: Die Schulpolitik der deutschen Arbeiterklasse in der Novemberrevolution 1918, in: Pädagogik 13 (1958), S. 776-806, Berlin (Ost) 1958.
(8) Vgl.: Sitzungsberichte der verfassunggebenden preußischen Landesversammlung, Tagung 1919/1921, VI, Sp. 7249.
(9) Zentralblatt ... 1918, S. 708/709; Hervorhebungen im Text.
(10) Vgl. dazu die Schulforderungen des Deutschen Lehrervereins aus dem Jahre 1919, abgedruckt in: Quellen zur Geschichte der Erziehung, hrsg. von Karl Heinz Günther u. a., Berlin (Ost) 1959, S. 282ff.
Die auf dem Parteitag von 1906 entwickelten Schulforderungen der Sozialdemokratie unterschieden sich wohl hinsichtlich der theoretischen Begründung, kaum aber hinsichtlich der praktischen Folgerungen von denen bürgerlich-demokratischer Gruppen wie des Deutschen Lehrervereins. Die sozialistischen Forderungen nach Weltlichkeit, Unentgeltlichkeit und Einheitlichkeit des Schulwesens stimmten mit den Forderungen des Deutschen Lehrervereins überein. Wie in anderen Bereichen der Innenpolitik, so galt es auch in der Kulturpolitik, längst überfällige Reformen der "bürgerlichen" Revolution nachzuholen, bevor man an die Verwirklichung spezifisch sozialistischer Forderungen denken konnte.
(11) Über die Loslösungsbestrebungen mit dem Ziele der Errichtung einer Rheinischen Republik vgl. auch die Verhandlungen in der Landesversammlung vom 21., 22. und 24. März 1919. Das Zentrum hat in seinen offiziellen Erklärungen vor der Presse und im Parlament stets eine Mitbeteiligung an diesen Bestrebungen geleugnet und entgegengesetzte Behauptungen mit dem Hinweis zu entkräften versucht, bei den Loslösungsbestrebungen hätten konfessionelle Gesichtspunkte keine oder nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Gegengründe führt Fauth, a. a. O., S. 11 Anm. und S. 67 Anm. an.
(12) Der Wortlaut ist abgedruckt bei: J. Hacks: Die preußischen Bischöfe und die Sozialdemokratie. Breslau 1919.
(13) Zentralblatt 1918, S. 722.
(14) Ebenda, S. 362.
(15) Vgl. dazu die Rede Haenischs in der Landesversammlung am 4.12.1919; Sitzungsberichte ... VI, Sp. 7249ff.
(16) Wenige Tage nach der Übernahme des Kultusministeriums hatte Hoffmann dessen Programm in der "Freiheit", dem Blatt der Unabhängigen, veröffentlicht. (Abgedruckt bei J. Tews, a. a. O., S. 79f.) Es stimmte sowohl mit den Grundsätzen des Mannheimer Parteitags wie mit den Forderungen der bürgerlich-demokratischen Schulreformer überein. Auch die Radikalität Hoffmanns, die der Schulpolitik schadete, kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß es sich letztlich um eine demokratische Schulpolitik handelte, nicht um eine sozialistische, wie sie nach dem zweiten Weltkrieg von der SED entwickelt wurde. Demnach kann das Scheitern der Schulpolitik der Sozialdemokratie einem Scheitern der demokratischen Bildungsbestrebungen gleichgesetzt werden.
Um den Austritt Hoffmanns entspann sich zwischen ihm und Haenisch eine Pressepolemik, die aber keine Klärung brachte: Hoffmann in der "Freiheit" und "Republik" am 3.1.1919, Haenisch in der "Deutschen Allgemeinen Zeitung" ebenfalls vom 3. 1. 1919. Hoffmann antwortete noch einmal in der "Republik" vom 7. 1.1919; die Kontroverse ist abgedruckt im Philologenblatt 1919, S. 34ff.
(17) Vgl. den Abdruck bei Hacks: Die preußischen Bischöfe ... S. 11f.
(18) Haenisch selbst hat sich offenbar für diese Koalition besonders eingesetzt. Vgl. "Berliner Tageblatt" vom 16. 7. 1919, zit. Philologenblatt 1919, S. 402.
(19) Siehe Anm. 11.
(20) Sitzungsberichte der ... Landesversammlung, I, Sp. 63f.
(21) Drucksache Nr. 11.
(22) Drucksache Nr. 248.
(23) Drucksache Nr. 618.
(24) Der Schlag wurde vom Zentrum als so schwer empfunden, daß es einen Austritt aus der Koalition erwog. Siehe Rede von Dr. Heß auf dem Parteitag des rheinischen Zentrums in Köln am 16. Sept. 1919. Vgl. Fauth, S. 45, Anm.
(25) Deutsche Schulgesetzgebung. Kleine pädagogische Texte H. 19. Hrsg. von Elisabeth Blochmann u. a., Langensalza-Berlin-Leipzig o. J., S. 137.
(26) Vgl. die §§ 43 und 46; ihr Wirkungskreis erstreckte sich auf die Verwaltung aller Schulangelegenheiten mit Ausnahme der Feststellung des Schulhaushaltes, außerdem waren sie an der Schulaufsicht beteiligt.
(27) Vgl. F. A. Kleinsorg: Das Schulwesen in Preußen. Mönchen-Gladbach 1927, S. 22f. und Egon v. Bremen: Das Schulunterhaltungsgesetz vom 28. Juli 1906. Stuttgart 1908, S. 115 f.
(28) Die Schulkommissionen waren Unterorgane der Schuldeputationen, die von diesen eingesetzt werden konnten, wenn es aus Gründen der Arbeitsentlastung zweckmäßig erschien; vgl. Kleinsorg, a. a. O., S. 23.
(29) Drucksache Nr. 537.
(30) Sitzungsberichte der ... Landesversammlumg III, Sp. 3208.
(31) Drucksache Nr. 2939, Anlage A.
(32) Drucksache Nr. 2939, Anlage B.
(33) Mitgeteilt bei Fauth, a. a. O., S. 79, Anm., der diese Behauptung allerdings nicht belegt. Sie stimmt aber mit einer Mitteilung des "Berliner Tageblatts" vom 16. 7. 1919 überein. Demnach sah Haenisch nach dem Kompromiß der zweiten Lesung "keinerlei Möglichkeit, in Preußen künftig noch eine ersprießliche Schul- und Kirchenpolitik zu treiben". Deshalb habe er den Vorsitzenden der sozialdemokratischen Fraktion der Preußischen Landesversammlung für den Fall des Bestehenbleibens des Kompromisses um Entbindung von seinem Amt gebeten. Mitgeteilt im Philologenblatt 1919, S. 402.
(34) Protokoll ... Parteitag 1906, S. 344.
(35) Der gemeinsame Entwurf der Sozialdemokraten und Demokraten ist abgedruckt bei H. Rosin: Der Schulkompromiß. Berlin 1920, S. 4/5.
(36) Vgl. zu den wechselnden Verhandlungen im Verfassungsausschuß vor allem H. Schulz: Der Leidensweg des Reichsschulgesetzes. Berlin 1926, und H. Rosin, a. a. O.
(37) Rosin, a. a. O., S. 59.
(38) H. Schulz, Der Leidensweg ... S. 42f.
(39) Ebenda, S. 43.
(40) Die Frage war, ob die Eltern sich für den Religionsunterricht erklären mußten oder nur dann, wenn das Kind nicht teilnehmen sollte. Diese Klärung war wichtig, weil sie so oder so den "Normalfall" fixiert hätte.
(41) Rosin, a. a. O., S. 59.
(42) Anton Rheinländer: Zentrum und Schulpolitik seit Weimar. Berlin 1924, S. 13. Nach "Berliner Tageblatt" vom 16. 7. 1919, zit. im Philologenblatt 1919, S. 402, fehlten bei der Abstimmung von den 164 Mitgliedern der sozialdemokratischen Fraktion 104; von den restlichen 60 stimmten 35 für und 25 gegen den Kompromiß. Diese Haltung der Fraktion sei wesentlich auf die ernsten Einwände Haenischs zurückzuführen.
(43) Nach Rosin a. a. O., S. 43.
(44) Die neue Erziehung, 1. Jg. Heft 15/16, Juli/August 1919, S. 521.
(45) Ebenda, S. 497, und S. 503.
(46) Rosin, a. a. O., S. 44.
(47) Ebenda, S. 46.
(48) Ebenda, S. 45
(49) H. Schulz, Der Leidensweg ... S. 56
(50) Rosin, a. a. O., S. 35/36.
(51) Das Gesetz ist im Wortlaut abgedruckt bei H. Schulz: Der Weg ... , S.187-189.
(52) Vgl. Willibald Apelt: Geschichte der Weimarer Verfassung, München 1946, S. 334.
(53) Da die Verhandlungen, die zwischen den beiden großen Parteien zum Weimarer Schulkompromiß führten, geheim und unter Ausschluß der Öffentlichkeit geführt worden sind und die Beteiligten in ihren späteren Verlautbarungen (Schulz, Der Leidensweg ... ; Max Quarck: Schulkämpfe und Schulkompromisse im deutschen Verfassungswerk, Josef Mausbach: Kulturfragen in der deutschen Verfassung, M. Gladbach 1920) über das Zustandekommen dieses Paragraphen nichts erwähnen, können für diese Vermutung nur eine Reihe wichtiger Indizien angeführt werden:
1. Die Taktik, mit einem solchen Sperrparagraphen als Minderheitspartei unangenehme Beschlüsse zu verhindern, läßt sich für das Zentrum schon in den Schulkämpfen vor 1914 nachweisen. Im Jahre 1872 bei der Beratung des Schulaufsichtsgesetzes, im Jahre 1891 bei dem Gosslerschen Volksschulgesetzentwurf und im Jahre 1906 bei dem Gesetzentwurf betreffend die Unterhaltung der öffentlichen Volksschulen hatte das Zentrum, als eine Annahme nicht mehr durch Abstimmung zu verhindern war, Einspruch wegen der Verfassungswidrigkeit der Vorlage erhoben (vgl. v. Bremen, a. a. O., S. 7). Es stützte sich dabei auf den Artikel 26 der Verfassung vom 31. 1. 1850: "Ein besonderes Gesetz regelt das ganze Unterrichtswesen", zu dem als Ergänzung der Artikel 112 gehörte, wonach es bis zum Erlaß des in Art. 26 vorgesehenen Gesetzes hinsichtlich des Schul- und Unterrichtswesens bei den bis dahin geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu verbleiben habe. Aus der Tatsache, daß die Gesetzentwürfe des preußischen Staatsministeriums immer nur Teilregelungen darstellten, pflegte das Zentrum eine Verfassungswidrigkeit herzuleiten. Als es auch im Jahre 1906 bei der Beratung des Volksschulunterhaltungsgesetzes in dieser Weise verfuhr, entschloß sich die Kammer, den Art. 26 so zu ändern, daß weitere Berufungen nicht möglich wären, und den Ergänzungsartikel 112 aufzuheben. (Auf diesen Zusammenhang weist Fauth, a. a. O., S. 57f. hin).
2. Schließlich konnte dieser Sperrparagraph, wenn man auf seinen Nutzen sieht, nur der Kulturpolitik des Zentrums zugute kommen. Da in der Folgezeit ausschließlich die Sozialdemokraten sich für eine Abänderung dieses Artikels einsetzten, kann man also mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, daß es sich hier um eine Initiative des Zentrums gehandelt hat. Dabei bleibt allerdings immer noch ungeklärt, warum sich die Sozialdemokraten und die Demokraten diesem Artikel nicht widersetzt haben.
(54) Konrad Haenisch: Neue Bahnen der Kulturpolitik. Aus der Reformpraxis der deutschen Republik. Stuttgart 1921, S. 74.
(55) Ebenda.
36. Der Jugendschutz bei Film und Fernsehen (1965)
(In: Zeitschrift für Pädagogik. H. 3/1965, S. 299-302)Werner Kalb: Der Jugendschutz bei Film und Fernsehen. Probleme, Geschichte, Praxis. Jugend im Blickpunkt. Hermann Luchterhand Verlag Berlin-Spandau und Neuwied 1962, 367 S., DM 17,50.
Der Jugendschutz gehört zu den am meisten umstrittenen Themen auf der Grenze zwischen Pädagogik und Politik. So sehr Einigkeit darüber besteht, daß mindestens aus Gründen der "Verfrühung" Jugendliche vor bestimmten Erscheinungen der gesellschaftlichen Wirklichkeit geschützt werden sollten, so hart stoßen die Meinungen aufeinander, wenn es um die praktische, vor allem rechtliche Verwirklichung geht. Die Gegner aller gesetzlichen Jugendschutzmaßnahmen wiesen immer wieder darauf hin, daß man diesem Problem nicht rechtlich, sondern allenfalls pädagogisch begegnen könne und daß jede rechtliche Fixierung unabsehbare Möglichkeiten des Mißbrauchs zur Folge haben könne. In der Tat blieben bisher für denjenigen, der sich nicht hauptberuflich mit den Problemen des Jugendschutzes befaßte, die rechtlichen Grundlagen, die pädagogischen Kriterien und die Maßstäbe der Prüfung weitgehend im Dunkeln. Gerade dadurch fand der Verdacht immer neue Nahrung, unter dem Vorwand des Jugendschutzes sollten in Wahrheit ganz bestimmte ideologische Gruppeninteressen unkontrolliert durchgesetzt werden. Es ist nun das Verdienst des Buches von WERNER KALB, die öffentliche Diskussion dieser Probleme ermöglicht zu haben. KALB legt zum erstenmal eine umfassende Darstellung der verfassungsrechtlichen, juristischen und pädagogischen Diskussion vor. Obwohl er sich auf Film und Fernsehen beschränkt, ermöglichen die grundsätzlichen Partien durchaus eine Diskussion der Jugendschutzproblematik im ganzen. Um dem Thema eine überzeugende Grundlage zu geben, hat er ein umfangreiches Material zusammengetragen und die Entscheidungen der FSK (1) zu etwa 100 Spielfilmen ausgewertet.
Der erste Teil befaßt sich mit der verfassungsrechtlichen Einordnung und Abgrenzung des Jugendschutzes. Das Grundgesetz stelle, sagt der Verfasser, kein ausdrückliches Erziehungsziel für die Jugend auf. Deshalb müsse der Jugendschutz auf dem Umweg über das Grundrecht auf Entfaltungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) positiv begründet werden. Das Grundgesetz statuiere ein festgelegtes Persönlichkeitsbild und räume damit notwendigerweise den "Anspruch auf Sicherung der Entfaltung zu diesem Persönlichkeitsbild hin" (S. 16) ein. "Indem der Staat diese Gefährdungen fernhält, wird die Erziehung und Entwicklung der jungen Menschen, die in der Entfaltung ihrer körperlichen, seelischen und geistigen Kräfte liegt, überhaupt erst ermöglicht. Diese Gefährdungen müssen daher von Kindern und Jugendlichen auch gegen den Willen der Eltern ferngehalten werden, da zum Beispiel das Zugänglichmachen eines sie beeinträchtigenden Films eben keine Erziehung in dem von der Verfassung materiell festgelegten Sinn ist, sondern diese Erziehung hierdurch gerade verhindert wird." (S. 25) Der Rezensent nimmt
299
- als Nichtjurist - diese Begründungsweise mit einigem Erstaunen zur Kenntnis. Als politischer Bürger sieht er sich einer Reihe wichtiger politischer Grundsatzfragen gegenüber und als Pädagoge hofft er, daß diese Interpretation allgemeine Anerkennung findet, weil sie dann auch auf anderen Gebieten rechtlich einklagbare Folgen haben müßte: Dann müßte von staatswegen verboten werden, daß Kinder und Jugendliche in Wohnungen unterhalb des Niveaus des "sozialen Wohnungsbaues" leben; daß Jugendliche vor Beendigung ihrer Pubertät mit Erwachsenen zusammen am Arbeitsplatz stehen dürfen (wegen der berühmten "Montagsgespräche"); daß Jugendliche nicht länger mehr in Massenschlafsälen übernachten dürfen (wegen des damit unweigerlich verbundenen "sexuellen Klimas"). Solche Konsequenzen würden auch aus der Definition des Jugendschutzes folgen, die KALB in Auseinandersetzung mit bisherigen Formulierungen vorschlägt: "Jugendschutz ist diejenige Jugendhilfe, die zur Sicherung vor solchen von außen kommenden Einflüssen erforderlich ist, die geeignet sind, die Entfaltung der körperlichen, seelischen und geistigen Anlagen des jungen Menschen zu einer gemeinschaftsgebundenen, selbstverantwortlichen Persönlichkeit zu beeinträchtigen oder zu gefährden. Eine gesunde Erziehung durch die erstverantwortlichen Erziehungsträger wird durch solche vorbeugende Jugendhilfe überhaupt erst ermöglicht" (S. 58).
Eine solche Definition wird sich erst als brauchbar erweisen, wenn mit ihr konkrete Entscheidungen getroffen werden sollen. So wendet sich KALB im zweiten Teil des Buches dem Jugendschutz beim Film zu. Nach einer sehr informativen Einleitung über die geschichtliche Entwicklung und heutige rechtliche Problematik des Themas sowie über die Entstehung und rechtliche Position der FSK behandelt er die Bedeutung der Filmwirkung für die Jugendprüfungen. Dabei stützt er sich vor allem auf die Untersuchungen von STÜCKRATH, SCHOTTMAYER und dem Ehepaar KEILHACKER. So viel wir zweifellos den Forschungen dieser Autoren auf diesem Gebiet verdanken, so sehr stehen sie doch auch in den Traditionen der klassischen Individualpsychologie. Heute wissen wir aber aus der amerikanischen Kommunikationsforschung, daß es ein isoliertes Gegenübertreten von Individuum und Film gar nicht gibt, daß vielmehr die Wirkung des Filmes und auch des Fernsehens entscheidend von Art und Struktur der Bezugsgruppe abhängt, in deren Rahmen solche Informationen gedeutet und überhaupt erst verstanden werden. Außerdem kann das in Deutschland so beliebte psychologische Schichtenmodell, das für bestimmte Aspekte der psychologischen Forschung zweifellos ein brauchbares Interpretationsmodell ist, nicht ohne Bedenken einfach zur psychologischen Begründung von juristischen Maßnahmen herangezogen werden. So müssen denn auch tiefenpsychologische Erklärungen, die auf Grund ihres anderen Interpretationsmodells auch zu sehr anderen Ergebnissen im Hinblick auf die Filmwirkung kommen, beiseite geschoben werden, weil sie die These stören (S. 175). Andere wissenschaftliche Beiträge werden zurückgewiesen, weil sie die "Wertfrage" entweder nicht beachten oder "unrichtig beantworten". Zu den ersteren gehören Autoren wie HEINZ KLUTH und RENE KÖNIG, zu den letzteren FRITZ BAUER und LUDWIG MARCUSE. Wenn solchen Autoren "Mangel an Unterscheidungskraft"
300
(S.180) sowie "Verlust der Möglichkeit, zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können" (S. 181) vorgeworfen wird, so muß das den Leser nachdenklich machen.
Weitere Schwierigkeiten stellen sich ein, wenn als Prüfmaßstab nicht der "Durchschnittsjugendliche", sondern der gefährdete Jugendliche gelten soll (S. 192); oder wenn schon aus praktischen Gründen der Begriff "beeinträchtigen" so eng gefaßt werden muß, daß dadurch weder das Problem der unablässigen Berieselung mit minderwertigen Filmen berührt wird noch auch überprüft werden kann, ob "der Film der Heranbildung einer nüchternen, mit der Lebenswirklichkeit vertrauten Jugend förderlich ist" (S. 203). Was soll aber, so fragt man sich, ein Jugendschutz beim Film, der vom Grundgesetz her als "Ermöglichung von Erziehung" begründet wurde, wenn er gerade diese beiden Probleme nicht lösen kann?
Bei der Behandlung der Spruchpraxis der FSK fällt ein weiteres Problem auf: das ungeklärte Verhältnis der Jugendschutzbestimmungen zur künstlerischen Objektivität. KALB interessiert diese Frage nur insofern, als er das Grundrecht der Kunstfreiheit nicht antasten möchte. Für die Bewertung selbst hat der Kunstcharakter keine zwingende Bedeutung. Nun zeigen aber die (S. 201 ff) diskutierten Beispiele, daß die Spruchentscheidungen um so überzeugender sind, je stärker ihnen künstlerische Argumente zugrunde liegen. Sehr viel weniger überzeugen sie, wenn die Argumente sich an die äußere Story halten, weil man sich dann lediglich auf der Ebene des bloßen Meinens bewegt.
Im dritten und letzten Teil behandelt KALB den Jugendschutz beim Fernsehen. Hier wird nun die eingangs aus dem Grundgesetz analysierte These, der Staat müsse alle jugendgefährdenden Produktionen von den jungen Menschen fernhalten, dahin ausgelegt, daß das Fernsehen grundsätzlich keine jugendgefährdende Sendung bringen dürfe, weil anders der Staat diese Vorschrift nicht garantieren könne (S. 339). Dieser Grundsatz sei keineswegs eine Beeinträchtigung der Kunstfreiheit im Sinne des Art. 5 Abs. 3 GG, denn Filme und Theaterstücke würden ja nicht dadurch der Öffentlichkeit entzogen, daß sie nicht im Fernsehen gezeigt werden dürfen. Auch Fernsehspiele könnten ja als Kinofilm der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden (Beispiel "Lysistrata"). "Um des Schutzes der Jugend willen muß das erwachsene Fernsehpublikum darauf verzichten, daß ihm jugendgefährdende Fernsehspiele im Fernsehen vorgeführt werden" (S. 340). Hier hat man nun vollends den Eindruck, daß für den Verfasser Kunst eine Art "objektives Gedankengut" ist, das unabhängig von dem Medium seiner Verbreitung existiert. Gute Filme aber ändern ihre Qualität auf dem Fernsehschirm meist ebenso folgerichtig wie gute Fernsehspiele auf der Leinwand. Auch Theaterstücke verlieren ihre künstlerische Qualität, wenn sie nicht fernsehgerecht inszeniert werden.
Nach der Lektüre, die so viele wichtige Informationen und zahlreiche praktische Anregungen vermittelt, fragt man sich, warum der Verfasser so hartnäckig auf der ideologischen Geschlossenheit seiner Begründungen besteht. Liegt es daran, daß er zu sehr von der juristischen Ebene her argumentiert? Oder liegt es an dem klassischen Vorurteil der deutschen Bildungsgeschichte, nur das, was bis in die letzten Horizonte hinein eindeutig begründet werde, könne auch ernstgenommen
301
werden? Jedenfalls macht sich der Autor auf diese Weise viele Bürger zu Feinden, die bei den praktischen Fragen des Jugendschutzes durchaus auf seiner Seite stehen könnten. Der Rezensent gesteht, daß er bei fast allen Grundsatzfragen nicht nur anderer Meinung ist, sondern daß er sich geradezu verpflichtet fühlt, gegen diese Meinungen des Verfassers politisch zu kämpfen. Die politischen Axiome, die hier auf dem Spiele stehen, sind wichtig genug! Warum sollte es nicht genügen, beim Jugendschutz von der pädagogischen Kategorie der "Verfrühung" auszugehen? Dann wäre er Teil aller jener pädagogischen Maßnahmen, die dazu dienen, den jungen Menschen langsam und "phasengerecht" in die Wirklichkeit des gesellschaftlichen Lebens einzuführen. Die pädagogische Kategorie der "Verfrühung" qualifiziert nicht nach "gut" oder "böse", "richtig" oder "falsch", "künstlerisch" oder "nicht-künstlerisch", sondern sie fragt nach der "Angemessenheit" eines Inhaltes im Hinblick auf die Verarbeitungsfähigkeit einer Altersstufe. Unter Auswertung der jüngsten Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie und der Jugendkunde ließen sich auch die Prüfmaßstäbe viel präziser fassen, als es dem Autor von seinem Ansatz her gelingen kann. Nur auf diese oder eine ähnliche Weise wird sich der Verdacht zerstreuen lassen, es gehe beim Jugendschutz in Wahrheit darum, daß bestimmte Teilgruppen der Gesellschaft ihre Vorstellung von der Welt zur staatlich autorisierten erheben wollten. Auch beim Fernsehen kann man den Jugendschutz nicht so anwenden, daß alles, was den "gefährdeten Jugendlichen" beeinträchtigen könnte, überhaupt nicht gesendet werden darf. Viel wichtiger und realistischer wäre es, mit Abmachungen wie der "21-Uhr-Grenze'' und besseren Informationen über die Sendungen den Eltern die Entscheidung zu erleichtern. Keineswegs kann man die Eltern pauschal entmündigen. Vor "Verfrühungen" aber kann der junge Mensch nur dann sinnvoll geschützt werden, wenn zugleich auch in der positiven Erziehung die Welt - und gerade auch ihre Schattenseiten - "vorweggenommen" wird. Es sollte in diesem Zusammenhang nachdenklich stimmen, daß es trotz aller Filmpädagogik und trotz aller Jugendschutzmaßnahmen noch keine überzeugende, pädagogisch brauchbare Filmästhetik gibt. Bedeutet das nicht, daß die Pädagogik sich zu sehr an die Moralität der Story und zu wenig an die künstlerische Struktur dieses Mediums hält?
In unserer pluralistischen Gesellschaft kann man gemeinsame pädagogische Maßnahmen nur dann verwirklichen, wenn man die letzten Begründungshorizonte ausklammert. KALB hat mit seinem Buch zuviel gewollt. Er hat aber durch die imponierenden informativen Partien seines Werkes der wissenschaftlichen Diskussion der Jugendschutzproblematik einen neuen Ansatz gegeben, der gerade auch von der Erziehungswissenschaft dankbar aufgegriffen werden sollte.
302
Anmerkungen:
(1) Die "Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft" ( = FSK) prüft alle in der Bundesrepublik zur Vorführung vorgesehenen Spielfilme unter anderem darauf, ob und für welche Altersklassen sie "jugendgeeignet" sind. Die Prüfungsgremien sind paritätisch aus Vertretern der Filmwirtschaft und der öffentlichen Hand besetzt.

37. Jungsein in Deutschland (1965)
(In: Sonntagsblatt Nr. 19-25/1965)
(Diese Zeitungsserie stützte sich auf den in 18 Bänden vom Deutschen Jugendinstitut herausgegebenen "Überblick zur wissenschaftlichen Jugendkunde" (München 1965), den die Bundesregierung für ihren ersten, 1965 vorgelegten "Jugendbericht" in Auftrag gegeben hatte. Die Serie erschien auch in leicht veränderter Fassung als Buch: H. Giesecke: Jungsein in Deutschland, München 1965. H. G.)
1. Gelernte Konsumenten?
Herr M. ist Abteilungsleiter in einem mittelgroßen Betrieb geworden und glaubt sich nun endlich einen eigenen Mittelklassewagen leisten zu können. Nun ist er zwar ein hervorragender Kaufmann, kann zudem Goethe von Schiller und zur Not auch Hans Schäfer von Uwe Seeler unterscheiden, aber trotz Fahrschule keinen Viertakter von einem Zweitakter. Da er nicht gern seine Unwissenheit offen zugibt, fragt er nicht einen seiner Kollegen, sondern abends seinen 17jahrigen Sohn Hans um seine Meinung.
Der hält ihm ein kurzes Stegreif-Referat über die preislichen und technischen Vorteile und Nachteile von sechs verschiedenen Mittelklassewagen und macht ihm schließlich einen überlegten Kaufvorschlag. Herr M., der von den vielen technischen Ausdrücken wenig verstanden hat, beschließt, den Wagen keinesfalls ohne seinen Sohn zu kaufen.
Diese Geschichte ist typisch. Im Konsumbereich scheint sich das Verhältnis der Generationen umgekehrt zu haben: Die Jüngeren lernen nicht mehr von den Älteren, sondern die Älteren von den Jüngeren. Das kann auch die Ehefrau unseres Herrn M. bestätigen. Sie hat am selben Tag sich unter dem kritischen Blick ihrer 16jährigen Gisela ein neues Frühjahrskostüm gekauft. Sie ist in modischen Fragen sehr unsicher und nimmt grundsätzlich ihre Tochter zum Einkauf mit.
Bestätigt wird die Erfahrung der Familie M. aber auch durch alle Untersuchungen, die die Wirtschaft über das Konsum- und Kaufverhalten von Teenagern und Twens hat anstellen lassen. Im allgemeinen sind junge Leute viel kritischere Kunden als ältere, sie sind weitaus besser informiert über das Produkt, das sie kaufen und lassen sich auch viel weniger durch Reklame etwas weismachen. Daher enden alle diese Untersuchungen mit dem Appell an die Geschäftsleute, jugendliche Kunden im eigenen Interesse wie erwachsene Käufer zu behandeln.
Aber an diesem Bild ist einiges falsch. Kaufsicher sind die jungen Männer im allgemeinen nämlich nur bei technischen und Mädchen nur bei modischen Artikeln. Wären sie wirklich "aufgeklärte" und "gelernte" Käufer, so müßten sie sich doch wohl im ganzen breiten Angebot zu Hause fühlen. Immer noch scheuen aber zum Beispiel viele junge Leute davor zurück, ein Buchgeschäft zu betreten. Sie kaufen ihren Lesestoff an Kiosken, weil man dort mit dem Finger zeigen kann, was man wünscht, und unangenehmen Fragen aus dem Weg geht.Was man also verbraucht und wie man es verbraucht, hängt weniger davon ab, daß man Jugendlicher ist, als vielmehr davon, welchem sozialen Milieu und welchem Bildungsstand man angehört. Jugendliche wünschen sich fast immer das, was auch andere Angehörige ihrer sozialen Schicht besitzen. Nach einer österreichischen Untersuchung würden 29 Prozent der Lehrlinge, aber nur 9 Prozent der Oberschüler 1000 geschenkte Schillinge für Kleidungsstücke ausgeben. Weitere 29 Prozent der Lehrlinge, aber nur 10 Prozent der Schüler würden sich dafür ein Moped kaufen. Das Moped verleiht offenbar nur in bestimmten Schichten der Jugend soziales Ansehen.
Übrigens ist unsere Frau M. keineswegs so modern wie ihr neues Kostüm. Als ihre Gisela aus der Volksschule entlassen wurde, gab es Streit zwischen den Eltern. Frau M. meinte, Gisela solle nun gleich als Anlernling in ein Büro gehen, Geld verdienen und sich eine Aussteuer sparen. Gisela wiederum hielt eine Aussteuer für "schrecklich altmodisch" und wollte lieber eine Fotoausrüstung haben. Papa M. sprach ein Machtwort, genehmigte das Fotohobby und ordnete außerdem den Besuch einer Handelsschule an "damit du noch etwas länger über deinen künftigen Beruf nachdenken kannst".Frau M. aber scheint in dieser Frage viele Eltern hinter sich zu haben. Denn junge Mädchen passen sich dem immer noch herrschenden Vorurteil an, daß sie sich vor allem auf den Mann und die Ehe vorbereiten müßten. Ihre Besitzinteressen sind deshalb viel enger als die der Jungen. Jungen besitzen zum Beispiel in weit höherem Maße Fahrräder, Fotoapparate, Skier und Radios. Dafür geben die Mädchen sehr viel mehr für Kleidung und Kosmetik aus.
Zu dieser Vorstellung von der "Rolle der Frau" paßt auch, daß der weitaus größte Teil der jungen Männer wünscht, daß ihre künftige Frau nicht berufstätig sein soll. Für "unbedingt falsch" halten 22 Prozent der jungen Männer und sogar 30 Prozent der Mädchen die Meinung, eine gute Berufsausbildung der Frau sei wichtiger als eine Aussteuer. Für "unbedingt richtig" halten dies nur 14 Prozent der Männer und 11 Prozent der Frauen. Diese Einstellungen sind um so bedenklicher, als nach der Heirat die Konsumansprüche keineswegs gesenkt werden, so daß junge Ehen oft von Anfang an unter diesem unaufgeklärten Widerspruch leiden.
Das Bild vom ungehemmten jugendlichen Konsumenten ist vor allem eine Erfindung der Wirtschaftswerbung. Aber ihr Slogan "Jugend hat ihren eigenen Stil" trifft nur einen Teil der Wirklichkeit. Jugendliche fühlen sich selbst nie als eine Gruppe, und schon gar nicht im Hinblick auf den gemeinsamen Konsum. Dafür sind die Interessen der einzelnen Jahrgänge viel zu verschieden. Herrschen etwa bei der Kleidung der Jüngeren noch bunte Farben, enge Hosen und sonstiges auffälliges modisches Beiwerk vor, so bevorzugen die älteren Jugendlichen deutlich einen unauffälligeren sportlichen oder damenhaft modischen Stil, in dem man "erwachsen" wirkt. In ähnlicher Weise nimmt die Vorliebe für bestimmte Schlager und wilde Rhythmen ab.
Zwar konnten 1960 rund 4,5 Millionen Teenager etwa 4 Milliarden Mark ausgeben. Wieviel davon bleibt aber wirklich übrig. wenn häusliche Abgaben und sonstige lebensnotwendigen Ausgaben bestritten sind? Man errechnete 1960 für die 14jährigen 17 Mark, die 15jährigen 31 Mark, die 16jährigen 50 Mark, die 17jährigen 70 Mark, die 18jährigen 102 Mark und die l9jährigen 141 Mark, die sie monatlich "zur freien Verfügung" hatten. Damit ist gewiß kein Schlaraffenleben zu bestreiten.
Besteht also im allgemeinen kein Grund, wegen des jugendlichen Konsums in Panikstimmung zu geraten, so bleiben doch vor allem zwei bedenkliche Tatsachen übrig. Einmal ist der Alkohol- und Tabakverbrauch gefährlich hoch. 53 Prozent der Jungen und 13 Prozent der Mädchen von 14 bis 19 Jahren rauchen regelmäßig. Bei den Twens rauchen 60 Prozent der Männer 11 Zigaretten und 20 Prozent der Frauen 6 Zigaretten im Tagesdurchschnitt. Weiterhin muß nachdenklich stimmen, daß 17 Prozent der Jungen und 20 Prozent der Mädchen zwischen 14 und 19 Jahren keine Bücher besitzen. Das ändert sich auch im Twen-Alter nicht. Hier sind es 36 Prozent der Volksschulabgänger ohne Lehrzeit, 16 Prozent der Volksschulabgänger mit Lehrzeit, 5 Prozent der Mittelschüler und 1 Prozent der Oberschüler bzw. Studenten, die kein einziges Buch ihr eigen nennen.
Aber solche Zahlen und Statistiken allein verraten uns noch nichts von den Gründen und Zusammenhängen. Man muß sich vielmehr fragen, was Freizeit und Konsum für die pädagogischen und psychologischen Probleme des Jugendalters bedeuten. Da die zur Verfügung stehenden Geldsummen viel zu gering sind, als daß man damit an der ganzen Breite der Möglichkeiten teilnehmen könnte, kaufen junge Leute das für ihr Geld, was ihnen noch am ehesten nach außen soziale Anerkennung verschafft. Das sind eben vor allem die Dinge, die sich "vorzeigen" lassen.
Nach dem alten Sprichwort "Kleider machen Leute" hat die Teenagermode nicht nur das Geld aus den Nietenhosen gelockt, sondern damit zugleich auch Unsicherheit beseitigt, indem sie nicht nur einen jugendlichen "Massengeschmack" entwickelte, sondern auch den Geschmack der jugendlichen Massen insgesamt bedeutend anhob: Nie zuvor hatten soviel junge Leute einen so hohen Geschmack in Fragen der Kleidung und des öffentlichen Auftretens überhaupt.
Das Freizeitleben ist für junge Leute deshalb so wichtig, weil es der einzige Lebensbereich ist, in dem sie voll ernst genommen werden und anerkannt sind. Ein 16jähriger Lehrling sprach sicher vielen aus dem Herzen, als er neulich in einer Diskussion sagte: "Im Betrieb gelten wir nur als 'halbe Figuren'; zu Hause müssen wir, wenn es darauf ankommt, den Mund halten; aber wenn wir ein Geschäft betreten und für unser Geld etwas kaufen, dann werden wir mit 'Herr' und 'Fräulein' angeredet, und dann benehmen wir uns auch danach."Deshalb reagieren die meisten Jugendlichen auch so überaus empfindlich auf pädagogische Gestaltungsansprüche in ihrer Freizeit. Sie wollen zwar lernen und ausprobieren, was sie alles können, aber sie wollen das nicht in der Weise der Schule oder des Lehrbetriebs tun. Denn die tatsächlich verfügbare freie Zeit ist gering genug. Etwa drei bis vier Stunden bleiben täglich übrig, wenn man Schlafzeit, Arbeitszeit und Wegezeiten von und zur Arbeitsstätte abzieht. Dabei sind häusliche Verpflichtungen und andere Bindungen noch gar nicht berücksichtigt. Für die Landjugend und die Mädchen ist die effektive Freizeit noch weitaus geringer. So ist es kein Wunder, daß in einer Untersuchung 34 Prozent der 15jährigen über zu wenig freie Zeit klagte. Aufs ganze Jahr gesehen und unter Einschluß der Urlaubszeit und Feiertage kommt man im Höchstfalle auf etwa 35 bis 37 Prozent Freizeit an der gesamten Wachzeit.
Kann man also heute schon von einer "Konsum-Gesellschaft" oder gar von einer jugendlichen "Freizeitkultur" sprechen? Viele Soziologen meinen, die Industrie wurde bestimmen, was die Menschen in ihrer freien Zeit tun, und nennen das "Fremd-Bestimmnung". Aber junge Leute empfinden zu Recht gerade die Freizeit als den Lebensbereich, wo "Fremde" am wenigsten "bestimmen" können, was sie tun sollen. Das Gegenteil ist eher richtig: Gerade zwischen 15 und 18 Jahren hat man soviel Sorgen mit seiner Berufs- und Schulausbildung, daß für eine Besinnung über richtiges und falsches Freizeitverhalten überhaupt kein Raum mehr bleiben kann.
Gerade in dem Alter, wo man die meiste Ruhe und Muße zur Selbstfindung nötig hätte, wird man mit einem Bündel von "Pflichten" zugedeckt. Während die Erwachsenen die 40-Stunden-Woche anstreben, müssen viele Oberschüler bis zu 55 und 60 Stunden "arbeiten". Später, wenn Schule und Berufsausbildung abgeschlossen sind und man mehr freie Zeit hat, rächt es sich, daß man vorher nicht gelernt hat, etwas daraus zu machen.
Daher überrascht es nicht, wenn "entspannende" Tätigkeiten wie Lesen, Sport, Wandern, Handarbeiten, Basteln und geselliges Zusammensein mit Freunden vorherrschen, und daß Tanzmusik, bunte Abende, Operetten und Sportberichte die beliebtesten Funk- und Fernsehsendungen sind. Leichte Musik bedeutet dabei für die einen eine Art Flucht vor den eigenen Problemen - ähnlich wie klassische Musik für Leute mit höheren Ansprüchen; die Ausgeglichenen, die sich nicht mit schwerwiegenden Problemen herumschlagen, lieben sie umgekehrt als Mittel des Kontaktes mit der menschlichen Umwelt. Man sieht also, wie wenig man aus der Tatsache, daß viele Menschen leichte Musik mögen, wirklich schließen kann.
Aber das jugendliche Freizeitverhalten wird nicht nur von den beruflichen und schulischen Leistungsanforderungen beherrscht, sondern auch von dem Zwang, sich aus der Familie zu lösen. Dies erklärt die relative Bedeutungslosigkeit des Fernsehens im Vergleich zum Kino. Überhaupt verbringt man seine Freizeit in diesem Alter am liebsten außerhalb der Familie. Auf dem Weg von der "Elternfamilie" hin zur eigenen Familie und zum eigenen Beruf gehen Jugendliche vielfältige Bindungen mit Gleichaltrigen ein. Dort, wo jeder die gleichen persönlichen Probleme hat, findet man auch Solidarität für die Lösung der eigenen.
Wir wissen noch viel zu wenig über den Einfluß, den solche jugendlichen Gruppierungen auf die privaten Lebensentscheidungen und Urteile haben. Aber wir müssen vermuten, daß dieser Einfluß sehr groß ist. Zwar sind nur etwa 25 bis 30 Prozent aller Jugendlichen in den bekannten Jugendorganisationen erfaßt, aber fast jeder gehört zu einer oder gar mehreren "unorganisierten" Gruppen.
Eine solche Gruppe 15jähriger Jungen wollte unlängst ein Tonband über das Thema "Jugend heute" herstellen. Das Drehbuch sah vor, in einer Mädchenklasse Interviews zu machen. Alles war vorbereitet, alle Beteiligten - einschließlich der Lehrerin - waren gespannt auf dieses Experiment. Da wollen die "Reporter" auf einmal nicht mehr und erfinden alle möglichen Ausreden, weshalb sie "keine Lust mehr haben". Da die Lehrerin etwas von Jugendpsychologie versteht, besorgt sie eine Jungenklasse für das Interview, und siehe da: Alle Unlust ist ebenso plötzlich wieder verflogen.
Die Jungen fühlten sich bei ihrer Aufgabe sehr unsicher. Das durften die Erwachsenen und die anderen Jungen ruhig merken, aber auf keinen Fall die gleichaltrigen Mädchen. Denn soziale Anerkennung durch das andere Geschlecht zu erringen, ist eines der kompliziertesten Bedürfnisse dieses Alters. Eigentlich sollte man annehmen, daß es in der "Massengesellschaft" kein Umstand mehr sei, genügend Partner kennenzulernen. Aber das allen Freizeitpädagogen bekannte übermächtige Interesse dieser Jahrgänge an gemischt-geschlechtlicher Geselligkeit spricht dagegen.
Man hat die Beliebtheit bestimmter moderner Tänze wie des Twistes dadurch zu erklären versucht, daß sie eben dieses jugendliche Bedürfnis befriedigen. Der Twist sei ein Tanz, bei dem es im Grunde den festen Partner gar nicht mehr gebe und der deshalb ohne "Tanzstunden-Komplikationen" mühelos den Kontakt zum anderen Geschlecht herstelle und auch wieder löse. Dem widerspricht nur scheinbar die Tatsache, daß der "feste Freund" und die "feste Freundin" zur beliebtesten Gesellungsform geworden sind. Bei einer EMNID-Erhebung im Jahre 1964 gaben 13 Prozent der Jungen zwischen 15 und 18 Jahren und 31 Prozent der jungen Männer von 18 bis 21 Jahren an, eine "feste Freundin" zu haben. Bei den Mädchen liegen die Angaben noch höher, nämlich bei 24 bzw. 44 Prozent. Aber die Partner wechseln zwischen 15 und 18 Jahren häufig: Man kann der Anerkennung um so sicherer sein, je öfter sie bezeugt wird.
Wenn man also das äußerlich feststellbare Freizeitverhalten junger Leute daraufhin ordnet, welche Probleme sie mit ihrem Verhalten lösen wollen, dann zeigen die Tatsachen erst ihr richtiges Gesicht. So hat man in der bisherigen Freizeitforschung leider selten gefragt. Statt dessen trugen die Erwachsenen auf dem Rücken der Jugendlichen ihre ideologischen Auseinandersetzungen aus. Die einen wollten unkomplizierte Kunden, die anderen ihre vorgefaßten pädagogischen Meinungen bestätigt sehen.Allgemein gilt, daß eine junge Generation sich nur in dem Rahmen bewegen kann, den ihr die Erwachsenengesellschaft zur Verfügung stellt. "Freie Zeit", die nicht mehr nur dazu dient, sich für die neue Arbeitsleistung wieder fit zu machen - wie das noch in Worten wie "Erholung" und "Entspannung" zum Ausdruck kommt - sondern ihren eigenen Sinn und ihre eigenen Formen hat, ist eine verhältnismäßig junge Errungenschaft der menschlichen Geschichte.
Vorläufig erlauben wir praktisch nur den Oberschülern, sich Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen, die im Freizeitleben von Nutzen sind. Da helfen für die anderen auch keine "Handwerkeleien" und "musischen Fächer" gegen die "Entseelung" der modernen Industriearbeit. Worauf es ankäme, wäre, im Jugendalter möglichst viele Interessen möglichst intensiv zu erwecken. Was man aber nicht im Prinzip bis zum 20. Lebensjahr gelernt hat, lernt man überhaupt nicht mehr. Später kann man allenfalls noch zulernen und umlernen.
Daran gemessen haben junge Leute heute zu viel Geld für das, was sie sich tatsächlich dafür kaufen, aber zu wenig dafür, was sie sich kaufen könnten und sollten. Nur wer reich ist, kann üben, im Reichtum zu leben. Und sie müßten viel mehr Freizeit haben, um sie auch als "freie" Zeit erfahren zu können. Wem das Freizeitleben junger Leute zu "primitiv" ist, der mag bedenken: Solange unsere Volksschulabgänger nicht mehr Worte lernen, als in Illustrierten stehen, ist der "Schund" für sie die "Blechtrommel" der Zukurzgekommenen. Solange sie im Literaturunterricht mit idyllischen Lesestücken beschieden werden müssen, ist schon das Verständnis eines mittleren deutschen Problemfilms eine beachtliche Leistung.
Für diese Folge wurden benutzt:
Band 1: Gerhard Wurzbacher: Gesellungsformen der Jugend.
Band 2: Martin Keilhacker/Erich Wasem: Jugend im Kraftfeld der Massenmedien.
Band 11: Willy Strzelewicz: Jugend in ihrer freien Zeit.
Band 12: Dorothea Luise Scharmann: Konsumverhalten von Jugendlichen.
(Sämtlich im Juventa-Verlag, München.)2. Zwei Prozent für Diktatur
Wie kam es zum Zweiten Weltkrieg? "1933 kam Hitler an die Macht. Er hatte alle Juden vernichten lassen. Für alle Arbeitslosen beschaffte er Arbeit. Hitler wollte den Krieg haben. Hitler schloß Friedensverträge mit Polen, Rußland. Hitler ist ein großer Idiot gewesen." - Diese Stelle aus einem Aufsatz eines 16jährigen Berufsschülers erscheint uns vielleicht auf den ersten Blick naiv, aber "im ganzen richtig". Aber dann kommen die Zweifel. Was hat die (spätere) Judenvernichtung mit der Vorgeschichte des Krieges zu tun? Wieso wollte Hitler den Krieg, wenn er "Friedensverträge" abschloß? War er ein "Idiot", weil er Arbeit beschaffte, "Friedensverträge" schloß oder den Krieg wollte?
Selbst wenn man berücksichtigt, daß Berufsschüler im allgemeinen erhebliche Schwierigkeiten mit dem schriftlichen Ausdruck haben und meist viel genauer denken als ihre Gedanken aufschreiben können, bleibt das Bild von der jüngsten Geschichte, das sich hier auftut, erschütternd dürftig. Und das gilt keineswegs nur für diesen einzelnen Schüler. Während man nämlich in der Jugendforschung sonst erhebliche soziale und Bildungsunterschiede findet, scheinen für das Verhältnis zur jüngsten Geschichte zwei Merkmale durchgehend von den Hilfsarbeitern bis zu den Studenten zu gelten: Das Geschichtsbild unserer Jugend ist "personalistisch" und "zusammenhanglos".
In einer Berliner Untersuchung stellten sich 90 Prozent der Berufsschüler und 92 Prozent der Oberschüler die jüngste Geschichte so vor, daß Hitler zur alles beherrschenden, übermächtigen Figur wird. Man muß eigentlich nur wissen, daß er ein "böser" Mann war, und einige Tatsachen kennen, mit denen man das möglichst eindringlich beweisen kann. Die Tatsachen selbst, die konkreten Zusammenhänge, sind dann nicht mehr wichtig. Sie sind gegen beliebige andere austauschbar. Ein Primaner sieht das so: "Man redet zwar viel von historischen Begebenheiten, die den Zweiten Weltkrieg veranlaßt haben, aber meiner Meinung nach ist das alles Geschwätz. Die Ursache des Zweiten Weltkrieges ist einzig und allein in Hitler zu suchen. Gäbe es keinen Hitler, so wäre es wohl kaum zu einem Krieg gekommen. Die meisten dieser Begebenheiten sind von ihm selbst herbeigeführt worden; wenn nicht, so waren sie ihm aber bestimmt willkommen. Also ist alles, was unmittelbar zum Zweiten Weltkrieg führte, von ihm selbst (wenn auch indirekt) ausgegangen. Es wäre zwecklos, jetzt noch alle Daten, die ich aus dem Unterricht behalten habe, aufzuzählen, denn sie zeigen ja doch alle auf das oben gesagte hin." Keine neue Information wird diesem Primaner neue Einsichten bringen, er wird sie von vornherein so verstehen, daß sie sein festgelegtes Urteil nicht angreifen.
Nun ist für das naive, ungeschulte Bewußtsein nichts einleuchtender, als sich die geschichtliche und politische Welt als eine Vielzahl konkreter Beziehungen zwischen konkreten Menschen vorzustellen: Hätte Hitler nicht die Juden gehaßt, wäre er nicht mit Mussolini befreundet gewesen, hatte er ein besseres Verhältnis zu Stalin gehabt ... und alles wäre anders gekommen. Politik und Geschichte sind hier wie eine Art Arena zur Zeit der Heldensagen, wo die großen Männer die Dinge bestimmen und "das Volk" zum "passiven Material" für ihre Taten wird. Natürlich ist das eher ein Problem der Erwachsenen als der Jugendlichen. Wie weit diese Haltung verbreitet ist, kann man daran sehen, daß die moderne Wahlpropaganda sich schon ganz darauf eingestellt hat: sie serviert Politiker, wie junge Männer ihre Mädchen den Eltern präsentieren.
Die Konzentration der zeitgeschichtlichen Vorstellungen auf die Person Hitlers führt dazu, daß ein Sechstel der Volksschüler und ein Drittel der Oberschüler selbst die prominentesten Naziführer nicht kennt und die anderen nur selten deren Funktion angeben können; aber rund neun Zehntel der Oberprimaner und Sekundaner wissen, daß Hitler kinderreiche Familien gefördert hat. Nun könnte man meinen, die "personalistischen" Vorstellungen von der jüngsten Geschichte hätten ihren Grund vor allem in der Tatsache, daß die meisten Jugendlichen in einem Alter aus der allgemeinbildenden Schule entlassen werden, wo sie abstrakte und unpersönliche Zusammenhänge noch nicht begreifen können. Aber dann bliebe unverständlich, daß sie sich auch bei den Primanern finden. Der Grund liegt wohl eher darin, daß sie sich mit den "inoffiziellen" Meinungen der Erwachsenen decken, und daß in den meisten Fällen der Geschichtsunterricht selbst an ihrer Verbreitung mitwirkt.
Ohne Zweifel sind im allgemeinen die geschichtlichen und politischen Kenntnisse junger Leute größer als die ihrer Väter. Lehrer wissen davon zu berichten, daß ihre Schüler oft ein unglaublich detailliertes Tatsachenwissen vorweisen können. Aber viele Tatsachenkenntnisse ergeben noch keine Vorstellung. Die Untersuchungen über das Geschichtsbewußtsein junger Leute zeigen übereinstimmend, daß Tatsachen nicht in einem Zusammenhang gesehen, sondern nur in eine Reihenfolge gebracht werden: "und dann, und dann, und dann ... " Auf diese Weise bleibt natürlich ein Phänomen wie die Machtergreifung Hitlers unverständlich. In der schon genannten Berliner Untersuchung kannten nur 13 Prozent der Jugendlichen das Datum der Machtergreifung genau und fast zwei Fünftel wußten nichts von einer nationalsozialistischen Massenbewegung vor 1933.
Das Geschichtsbild ist zwar nur ein Teil des ganzen politischen Weltbildes. Aber man darf vermuten, daß die Vorstellungen von der politischen Gegenwart nicht zutreffender sind. Leider wissen wir darüber viel weniger als über das Geschichtsverständnis. Lange Zeit beherrschten hier die Umfrageforschungen das Feld. Deren Fragen gaben manchmal eher Auskunft über politische Fehlurteile der Frager als der antwortenden Jugendlichen.
Wenn man zum Beispiel fragt: "Glauben Sie, daß die Meinung des einzelnen in unserem Staat eine Wirkung hat?" und daran das Vertrauen in die politische Demokratie prüfen will, so wird man an eine Honoratiorendemokratie des 19. Jahrhunderts erinnert. Bedenkt man ferner, daß junge Leute ganz andere Sorgen haben, als ausgerechnet über eine solche Frage nachzudenken, so kann man auch den Antworten darauf nicht sehr vertrauen. Ebensowenig kann man von einfachen Informationsfragen ("Wie wird der Bundestag gewählt?") auf das politische Bewußtsein schließen. Lange Zeit hat man aus den Ergebnissen solcher Untersuchungen dann den Schluß gezogen, die gegenwärtige Jugend sei politisch desinteressiert. Zusammen mit der These vom "jugendlichen Konsumenten" ergab das ein wenig imponierendes Bild.
Das liegt unter anderem auch daran, daß man bisher zu sehr jugendliche Meinungen im Hinblick auf die Staatsform, die politischen Parteien und die großen weltpolitischen Fragen erforscht hat und kaum in bezug auf sozial-, wirtschafts- und bildungspolitische Fragen, wo gerade für junge Leute sich die persönlichen Probleme viel stärker mit den allgemeinen verbinden.
Vor allem haben ja auch die Erwachsenen formales, abfragbares Wissen keineswegs jederzeit bereit, sondern es wird`"beschafft", wenn es "gebraucht" wird. Deshalb ist es ein großer Unterschied, ob man junge Leute nach etwas fragt, was gar nicht aktuell ist, oder ob sie zu Themen gehört werden, die gerade in der öffentlichen Diskussion sind.
Im ersten Falle wird man große Lücken entdecken, im zweiten eine erstaunliche Informiertheit und Treffsicherheit im Urteil. Die wirklich wichtigen Probleme, die jeweils auch in der Erwachsenenwelt umstritten sind und "Ernstcharakter" haben, fördern eine beachtliche politische Anteilnahme zutage. Während man im allgemeinen etwa die Hälfte der Jugendlichen für politisch interessiert halten kann, steigt dieser Anteil gegenüber solchen Konflikten erheblich an und sinkt dann wieder auf das "normale" Maß zurück
Diese Erkenntnis stammt weniger aus den großen Jugenduntersuchungen - die ihre Fragen schlecht auf noch nicht bekannte Aktualitäten vorplanen können und meistens auch gar nicht wollen - als vielmehr aus den Erfahrungen des politischen Unterrichts. So hat man in einer Jugendbildungsstätte wiederholt die jugendlichen Kursteilnehmer gebeten, zu einem gerade umstrittenen politischen Thema ein kurzes Tonband-Feature herzustellen, das möglichst alle wichtigen Aspekte des Problems berücksichtigen soll. Diese spontanen und unvorbereiteten Produktionen, für die nur ein Tag Zeit war und an denen jeweils etwa 8 bis 10 Lehrlinge beteiligt waren, enthielten tatsächlich immer alle wesentlichen Gesichtspunkte, so daß sie sogar brauchbare Lehrmittel abgaben.
Dieses Beispiel zeigt, was auch die amerikanische Kommunikationsforschung bestätigt: daß nämlich offensichtlich die politischen Urteile und Meinungen letztlich gar nicht durch die Wirkungen der Massenmedien, sondern durch soziale Prozesse in kleinen Gruppen zustande kommen. Aber gerade an solche Prozesse kommt man mit den meisten Forschungsmethoden nicht heran, die sich ja an einzelne wenden. Sie verstehen das Individuum als Träger bestimmter Meinungen, Einstellungen, Urteile und Verhaltensweisen und gehen damit von einer "Persönlichkeitsvorstellung" aus, wie sie im 19. Jahrhundert herrschte und vor allem durch "den Gebildeten" repräsentiert war. Wir müssen heute aber annehmen, daß insbesondere politische Meinungen und Urteile nicht ein für allemal und abfragbar "da" sind, sondern immer selbst schon soziale Aktionen darstellen.
Das, was uns also an der politischen Einstellung der Jugend vor allem interessiert, nämlich die Richtigkeit und Beständigkeit ihres politischen Weltbildes, wissen wir nicht und können wir wohl auch mit den heutigen Forschungsmethoden kaum ermitteln. Zwar bekennt sich die überwiegende Mehrheit in Befragungen zur demokratischen Staatsform, aber diese Antworten werden in "normalen", durch Wohlstand und Konjunktur bestimmten Situationen abgegeben, und wir wissen nicht, ob sie in Krisenzeiten durchhalten werden.
Das Vertrauen in die Stabilität unserer Staatsform ist weitaus größer als bei den Erwachsenen; denn rechts- und linksradikale Bedrohungen werden recht gering eingeschätzt. So hielt die überwiegende Mehrheit der jungen Leute das KP-Verbot von Anfang an für falsch, teils aus einem rigorosen Verständnis von Demokratie (man solle keine Meinung unterdrücken), teils aus praktischen Gründen (es sei besser, wenn die Kommunisten öffentlich auftreten könnten).
Behält man diese Schwierigkeiten der Forschung im Bewußtsein, so kann man die wichtigsten Ergebnisse etwa so zusammenfassen: Etwa die Hälfte der Jugend ist in irgendeiner Form politisch interessiert. Dabei gibt es erhebliche gruppenspezifische Unterschiede. Die Zahl der Uninteressierten ist bei den Mädchen, den Jüngeren und den Jugendlichen mit Volks- und Berufsschulbildung größer. Das Interesse steigt mit der Größe des Wohnortes. Etwa 1 bis 4 Prozent treten für ein diktatorisches bzw. totalitäres Regime ein - fast immer für ein faschistisches, selten für ein kommunistisches; für ein autoritäres bzw. elitäres Regiment entscheiden sich etwa 20 Prozent, für die in der Bundesrepublik erlebte demokratische Regierungsform etwa 60 Prozent. Der Rest kann hier nicht weiter eingeordnet werden.Im Hinblick auf die Art und Weise der politischen Anteilnahme - womit also keineswegs nur die "Demokraten" gemeint sind - hat Walter Jaide 12 Prozent Engagierte, 34 Prozent Interessierte, 46 Prozent Indifferente, 5 bis 7 Prozent Skeptische und 1 bis 3 Prozent Destruktive unterschieden. Jürgen Habermas hat in einer Frankfurter Studentenuntersuchung 9 Prozent engagierte und 29 Prozent reflektierte Staatsbürger ermittelt. Den Rest möchte er wegen des bei ihnen feststellbaren unsicheren oder falschen Gesellschaftsbildes nicht als "demokratisch" bezeichnen.
Habermas hat mit seinen Mitarbeitern bisher als einziger versucht, in einer Untersuchung näher zu bestimmen, was ein "demokratisches" politisches Bewußtsein ist - nämlich ein solches, das sich auf eine entsprechende Vorstellung von der gegenwärtigen Gesellschaft gründet. Deshalb ist die Zahl der Demokraten in seiner Untersuchung auch verhältnismäßig gering. Aber dieser Versuch ist nicht ohne Widerspruch geblieben. Vor allem müßte sich eben erweisen, ob ein "richtiges" Bewußtsein im Ernstfalle auch ein "praktisches" Bewußtsein sein wird, das sich für die Erhaltung der demokratischen Freiheiten auch wirklich einsetzt.
Besonders auffallend ist, daß die wirklich bösartigen Vorurteile gegen andere Völker, Rassen und Minderheiten erheblich abgenommen haben. Zwar hatten in einer Untersuchung im Jahre 1957 nur 24 Prozent der 16- bis 24jährigen keine Bedenken dagegen, daß Juden hohe Positionen in unserem Staat einnehmen; 12 Prozent hatten keine Meinung dazu und 25 Prozent meldeten einige, 29 Prozent erhebliche Bedenken dagegen an. Daraus kann man aber wenig schließen. Hätte man eine ähnliche Frage im Hinblick auf Katholiken, Protestanten oder Angehörige einer bestimmten politischen Partei gestellt, hätte es vermutlich ebenfalls eine bestimmte Anzahl "Nein-Sager" gegeben, ohne daß das ein Beweis für Vorurteile sein müßte.
Andererseits heißt das aber auch nicht, daß die Gefahr affektiver - also bösartiger, durch bessere Information nicht zu ändernder - Vorurteile überhaupt beseitigt sei. Auch in früheren Jahrzehnten hat es in Zeiten wachsenden Wohlstandes und relativer sozialer Sicherheit kaum einen offenen Antisemitismus gegeben. Er brach immer dann aus, wenn ganze Schichten in soziale Existenzangst gerieten.
Vielleicht ist es wenig sinnvoll, darüber zu spekulieren, was die jetzige junge Generation in Zeiten politischer, wirtschaftlicher und sozialer Krisen tun werde. Wichtiger wäre die Einsicht, daß Politik dafür sorgen muß, daß solche Krisen nicht eintreten. Anscheinend ist die verhältnismäßig große Zufriedenheit der Jugend mit der westdeutschen Demokratie weniger den großangelegten und mit erheblichen öffentlichen Finanzen unterstützten politischen Erziehungsbemühungen zu verdanken, als vielmehr der wirtschaftlichen Prosperität und der ruhigen sozialen Entwicklung der letzten zehn Jahre.
Viele Skeptiker meinen, es sei zuwenig, wenn die Demokratie nur auf einem "guten Leben" gegründet sei. Aber gibt es etwas Einleuchtenderes, als daß Menschen sich zu einer politischen und gesellschaftlichen Verfassung bekennen, in der es ihnen im ganz äußerlichen Sinne "gut geht"? Ich wüßte nicht, was sie sonst für Motive haben sollten.
Davon abgesehen aber muß man für die Zukunft die Forderung vieler Soziologen ernst nehmen, in unseren Schulen und Bildungsstätten endlich ein zutreffendes und der Wirklichkeit angemessenes politisch-gesellschaftliches Weltbild zu lehren, das auf ein Gesamtverständnis der Verhältnisse zielt. Das bleibt das einzige, was die Erziehung zur Stabilität der Demokratie tun kann, stellt aber ungemein hohe rationale Anforderungen an das Jugendalter, und es gibt bisher keinen einleuchtenden Vorschlag für die pädagogische Verwirklichung dieser Forderung. Solange es bei uns nicht die 10-Jahres-Schule gibt, wird das schon an der mangelnden intellektuellen Reife scheitern. So lange werden wir also 80 Prozent der jungen Generation mit einem völlig unzureichenden politischen Weltbild in das politische Leben entlassen müssen.
Für diese Folge wurden benutzt:
Band 7: Ludwig v. Friedeburg/Peter Hübner: Das Geschichtsbild der Jugend.
Band 8: Walter Jaide: Die jungen Staatsbürger.
3. Nachsichtig mit den Eltern
Auf einer Fachtagung wird debattiert, was man tun könne, um das Massenreisen von Jugendlichen ins Ausland unter Kontrolle zu bekommen. Da erhebt sich ein angesehener Beamter einer Jugendbehörde und sagt "Schuld an diesen Erscheinungen sind die Eltern, die ihre Kinder einfach verreisen lassen, ohne sich weiter darum zu kümmern. Anstatt ihre Kinder mit in den eigenen Urlaub zu nehmen und ihnen zu zeigen, wie man richtigen Urlaub macht, suchen sie nur ihr eigenes Vergnügen. Das ist wieder ein Beweis dafür, wie sehr die Illustrierten und die Massenmedien die Erziehungsaufgabe der Familie unterhöhlen und wieviel Eltern dagegen schon gar keinen Widerstand mehr leisten!"
So etwa kann man heute über jedes Jugendproblem reden und dabei des allgemeinen Beifalls sicher sein. Denn im Hinblick auf die Erziehungsleistung der Familie halten sich bei uns zwei Vorurteile um so hartnäckiger, je unrichtiger sie werden. Einmal macht man immer zuerst die Eltern verantwortlich, wenn irgendwo etwas mit den Kindern nicht stimmt. Zum anderen meint man, die "eigentliche" und "echte" Erziehung geschehe immer noch in der Familie, und Staat, Schule und Jugendgruppe hätten allenfalls ergänzende Aufgaben. Nur die wenigsten machen sich klar, daß sie mit einer solchen Einstellung im Grunde nur der längst vergangenen autoritären und patriarchalischen Familie nachtrauern.
Die bundesdeutsche "Idealfamilie" in der Großstadt sieht etwa so aus: Sie hat zwei, höchstens drei Kinder. Die Mutter übt wenigstens halbtags weiter ihren Beruf aus, sobald die Kinder älter werden und ihrer nicht mehr so bedürfen. Sie tut es weniger des Geldes wegen, als deshalb, weil sie weiter "am Leben teilnehmen möchte". Die beiden Kinder haben nicht nur Verständnis für ihre berufstätige Mutter, sie freuen sich auch auf jede Abendmahlzeit - die einzige am Tag, wo alle beisammen sind - weil da jeder von den Erlebnissen des Tages berichtet und über alles diskutiert wird. Auch die Kinder dürfen ausführlich erzählen und werden - wenn nötig - nachsichtig korrigiert, wenn sie falsche Meinungen und Urteile von sich geben. Anschließend werden die alltäglichen Probleme - die "Fünf" in Englisch oder die zu hohe Reparaturrechnung - besprochen und entschieden, wobei die Eheleute sich als gleichrangig betrachten und Einstimmigkeit erreichen wollen, während gute und vernünftige Vorschläge der Kinder lobend berücksichtigt werden.
Geht es einmal um ernste Erziehungsfragen, so ist die Lebenserfahrung der Eltern, die "mit beiden Beinen im Leben stehen", überzeugender als ihr Machtwort. Den Feierabend verbringen die Eltern mit ihren Kindern gemeinsam, oder sie überlassen sie ihren eigenen Interessen. Dann wird nur die Ausgehzeit vereinbart.So etwa sieht das aus, was man die "partnerschaftliche" Familie nennt und was die üblichen amerikanischen Familienfilme unentwegt ausstrahlen - sehr im Unterschied zu den deutschen, wo statt dessen kleinbürgerliche Betulichkeit Trumpf ist. Gewiß ist eine solche Familie noch kein Allheilmittel gegen alle Erziehungsprobleme. Aber sie wird am ehesten ihre Möglichkeiten nutzen und sie doch nicht überschätzen. Aber wieviele solcher Familien, in denen die Autorität des Vaters in dem Maße zurückgegangen ist wie die der Mutter anstieg, gibt es bei uns? Die Jugenduntersuchungen scheinen zu beweisen, daß ihre Zahl`recht groß ist. Im Jahre 1955 gaben bei einer EMNID-Erhebung 59 Prozent der befragten Jugendlichen an, ihre Sorgen und Nöte mit den Eltern durchsprechen zu können; davon nannten 35 Prozent die Mutter als Vertrauensperson. 80 Prozent aller Jugendlichen wollten ihre Kinder genau oder ungefähr so erziehen, wie sie selbst erzogen wurden. Wirklich ernsthafte Konflikte entstehen vor allem dann, wenn es um den Kontakt zum anderen Geschlecht geht - wohl deshalb, weil sich die meisten Eltern hier am wenigsten sicher fühlen.
Im allgemeinen aber erfreut sich die Familie bei den Jugendlichen eines recht hohen Ansehens. Ihr Einfluß auf die Urteils- und Meinungsbildung der Söhne und Töchter ist erheblich höher, als man allgemein annimmt. Die Einstellungen der Eltern zur Arbeit, zum Staat und zum Leben überhaupt sind gerade dadurch, daß sie nicht mehr aufgezwungen werden können, eher wirksamer geworden als früher. Das hat man bisher deshalb immer ein wenig übersehen, weil man immer jugendliche Stellungnahmen und nicht auch zugleich die ihrer Eltern untersucht hat. Immer noch ist es weniger die persönliche Leistung der Kinder, als vielmehr die soziale Stellung der Eltern, die auch den Kindern die spätere soziale Position zuweist.
Offensichtlich "gilt" in Arbeiterfamilien immer noch die Meinung, daß auch begabte Kinder nicht weiterführende Schulen besuchen sollen. Der sehr geringe Anteil von 5 Prozent Arbeiterkindern an der studierenden Jugend hat darin wohl vor allem seine Ursache. Hier wird auch entschieden, daß Mädchen frühzeitig Geld für die Aussteuer verdienen und nicht einen Beruf gründlich lernen sollen; daß sehr viele Mädchen daran gehindert werden, Pflege- und Erziehungsberufe zu ergreifen, auch wenn sie es lebhaft wünschen. Ist die Spannung zwischen den Generationen vielleicht deshalb so gering, weil sich erst später herausstellt, wie falsch Einflüsse des Elternhauses waren?
Die hohe Familienzufriedenheit der Jugend bedeutet nämlich noch keineswegs, daß die Eltern auch das Richtige tun. Oft versagen die Familien in pädagogischer Hinsicht gerade deshalb, weil sie ihre Erziehungsmöglichkeit weit überschätzen. Die stärkste Anhänglichkeit an die eigene Familie hat man in jenen sozialen Schichten gefunden, aus denen die Mehrzahl der ungelernten jungen Arbeiterinnen stammen, die gleich nach der Schulentlassung in die Industrie gehen. Darüber heißt es in einer Untersuchung des Soziologen Gerhard Wurzbacher: "Im Elternhaus finden sie gegenüber dem sozialen Ausgeliefertsein im Betrieb und der sozialen Isolierung in einer weiteren Umwelt mindestens vergleichsweise die verläßlichste Geborgenheit ... Häufig sind sie nie länger von der Familie fort gewesen. Diejenigen, die aus irgendeinem Grunde in die Fremde mußten, versuchen meistens mit allen Kräften, wieder nach Hause zu kommen, ganz gleich, welche Verhältnisse sie dort erwarten".
Das ist auf den ersten Blick sicher ein Lob für die soziale Leistungsfähigkeit dieser Familien. Aber waren es nicht dieselben Familien, die eine Berufsausbildung der Mädchen verhinderten und mit kurzsichtigen Sorgevorstellungen zum frühen Geldverdienen anregten? Ist es heute wirklich noch ein Kompliment für eine Familie, wenn sie die Heranwachsenden nicht lehrt, es in der Fremde auszuhalten und dort verläßliche menschliche Bindungen einzugehen? Offensichtlich ist eine zu ausgeprägte Familienanhänglichkeit auch ein Beweis für den Mangel an sozialer Reife.
Die Gründe dafür liegen wohl vor allem in der gerade in diesen Schichten noch weit verbreiteten sozialen und wirtschaftlichen Unsicherheit. Innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft verfügt der deutsche Arbeitnehmerhaushalt mit Kindern über das geringste Nettoeinkommen. Setzt man den Lebensstandard einer kinderlosen Familie mit 100 Prozent an, dann verringert er sich mit einem Kind schon auf 69,3 Prozent, mit zwei Kindern auf 37,2 Prozent. Schon bei zwei Kindern ist also für den verdienenen Familienvater die Mark nur noch 55 Pfennig wert.
Da im allgemeinen niedrige Einkommensgruppen größere Kinderzahlen aufweisen, wundert es nicht, daß zum Beispiel bei städtischen Arbeitern in Stuttgart mehr als die Hälfte der Familien mit vier und mehr Kindern ein Einkommen unterhalb des Fürsorgerichtsatzes hat. In der gesamten Bundesrepublik gehört jedes 170. kinderlose Ehepaar, jede 85. Ein-Kind-Familie und jede 5. Familie mit fünf oder mehr Kindern zu den einkommensschwachen Familien mit weniger als 427, - DM Einkommen. Da auch diese Mehrkinder-Familien im allgemeinen sich am Lebensstandard der Ein-Kind-Familie orientieren und ihr Einkommen deshalb vor allem in den "demonstrativen Konsum" (Kleidung, Fernsehen, Autos usw.) stecken, wird vor allem beim Essen und der Ausbildung der Kinder, hier vor allem der Mädchen, gespart. Welche Benachteiligungen damit für die Entwicklung der Kinder verbunden sind, zeigt am eindrucksvollsten die schon genannte Studie über die jungen Arbeiterinnen.
Im Vergleich dazu hat man die Berufstätigkeit von Müttern immer erheblich überschätzt. Zwar waren 1957 ein Drittel aller Mütter erwerbstätig. Aber nicht einmal die Hälfte von ihnen arbeitet außer Haus. Von allen Müttern mit Kindern unter 18 Jahren ist heute etwa jede siebte außer Haus berufstätig. 19,5 Prozent der Kinder unter sechs Jahren haben berufstätige Mütter. Da aber in den meisten Fällen noch Großmütter oder andere Verwandte für die Betreuung der Kinder zur Verfügung stehen, ist das vielberufene, sich selbst überlassene "Schlüsselkind" keine sehr verbreitete Erscheinung.
Schlüsselkinder gibt es fast gar nicht im Vorschulalter. Erst bei den über zehn Jahre alten Kindern werden sie häufiger. 29 Prozent der über zehnjährigen Kinder von abhängig erwerbstätigen Müttern sind sich außerhalb der Schulzeit selbst überlassen, die Hälfte davon mehr als vier Stunden täglich. Daß für das Kindesalter die Bedeutung der Familie gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann und daß deshalb bei Kindern in den ersten Lebensjahren die Erwerbstätigkeit der Mutter in jedem Fall bedenklich ist, ist nicht mehr umstritten. Wie die Folgen für spätere Altersstufen aussehen, ist noch zu wenig untersucht. Sicher ist, daß ein gewisses Maß an früher Selbständigkeit auch positive Folgen für die soziale Reifung der Kinder hat und die Mutter durch ihre Berufserfahrung auch eine größere Autorität gerade für die kritischen Jahre der Pubertät gewinnt. Sie versteht dann einfach mehr von den Problemen ihrer Kinder.
Von unserem "Idealbild" einer modernen Familie müssen wir weitere Abstriche machen, wenn wir an die Landbevölkerung denken. Hier sind die "Abweichungen" weniger sozial und wirtschaftlich, als vielmehr traditionell bedingt. Die Väter verfügen allein über die wirtschaftlichen Grundlagen der Familie und können deshalb auch ihre älteren Kinder noch sehr bevormunden. Da sie wesentlich länger leben als früher, übergeben sie die Höfe auch viel später an die Nachkommen, so daß 30jährige Söhne mit eigenen Familien oft noch in wirtschaftlicher und damit auch menschlicher Abhängigkeit von ihren Eltern leben. Hinzu kommt die ungenügende Sorge für die Berufsausbildung vor allem der nichterbenden Kinder. 24 Prozent dieser Kinder sagen aus, daß ihre Eltern noch nie mit ihnen über ihre berufliche Zukunft gesprochen haben.
Schließlich darf nicht vergessen werden, daß sehr viele Jugendliche gar nicht in vollständigen Familien leben. Im Jahre 1955 waren das 32 Prozent aller Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren. Ist Vater oder Mutter gestorben, stellen sich meist recht erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten ein. So schreibt ein 14jähriger: "Mein Vater ist kürzlich verunglückt, was uns ein großer Verlust, vor allem durch sein Einkommen einbringt".
Im Falle der unehelichen Geburt oder der Scheidung der Eltern sind die Folgen weitaus schwerwiegender. Von den heutigen Jugendlichen ist eine unverhältnismäßig hohe Zahl unehelich geboren. Jeder 20. der heute 18jährigen ist ein Besatzungskind. Zwar geht der Anteil der unehelichen Geburten von 16,3 Prozent im Jahre 1946 bis 5,2 Prozent im Jahre 1963 deutlich zurück. Geblieben ist aber immer noch die soziale Geringschätzung der unehelichen Mutter und ihres Kindes, woraus gerade im Jugendalter erhebliche Konflikte entstehen, die oft zu Leistungsrückgang und seelischen Störungen führen. Meist beantwortet die Mutter die Frage nach dem Vater jahrelang unrichtig und verzichtet auf Freunde und Bekannte, um ihr aus dem Weg zu gehen.
Das Kind erfährt dann die Wahrheit in dem Augenblick, wo es ihr am wenigsten gewachsen ist: Zu Beginn der Reifezeit. Nun geht es den anderen aus dem Weg, wie es die Mutter auch getan hat. Das weit verbreitete Vorurteil, uneheliche Geburt trage gleichsam schon den Keim der Asozialität in sich, ist gänzlich abwegig. Tatsächlich wächst nur jedes zehnte dieser Kinder ohne Familie auf, fast jedes zweite lebt mit der Mutter bei deren Eltern, allerdings oft unter erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Etwa die Hälfte solcher unvollständigen Familien mit unehelichen Kindern und Jugendlichen gilt als sozial bedürftig.
Ähnlich schwer haben es die Kinder aus geschiedenen Ehen. 1956 waren es 3 Prozent aller Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren. Dabei ist weniger der Akt der Scheidung selbst, als vielmehr die ihm vorausgehende meist jahrelange Belastung der familiären Beziehungen von Bedeutung. Die bedenklichsten Störungen treten bei solchen Kindern meist in der sexuellen Entwicklung und im späteren Eheleben auf, wo das "schlimme Vorbild" noch oft über Jahre die eigenen Familienbeziehungen belastet. So kann es uns nicht wundern, wenn in einer Baseler Untersuchung die meisten Kinder aus solchen Ehen in späteren Jahren die Scheidung der Eltern als eine günstige Wendung ihres Schicksals ansahen.
Bei uns ist das sogenannte "Elternrecht" die rechtliche und moralische Grundlage aller Erziehung - ein beliebtes Thema für Sonntagsredner. Die Familie ist bei uns ein Tabu, vor dem sich nicht nur die verbeugen, die ihr wirklich helfen wollen, sondern auch die, die sie haftbar machen wollen für etwas, was an ganz anderen Stellen versäumt wurde. Das zu Beginn berichtete Beispiel aus dem Tourismus ist dafür charakteristisch: Es ist eben nicht unter allen Umständen vernünftig, wenn Eltern mit ihren heranwachsenden Kindern verreisen, weil das auf die Dauer die Unselbständigkeit der Jugendlichen nur über Gebühr verlängert. Was man heute für das Leben im Tourismus lernen muß, kann man zu allerletzt in der eigenen Familie lernen: Selbständigkeit in einer Freiheit, die nur wenig kontrolliert wird; Kenntnis fremder Kulturen und Lebensformen; Umgang mit gänzlich fremden Menschen.
Was wissen eigentlich Eltern von den Problemen ihrer Söhne und Töchter? Darüber haben wir leider nur lokal begrenzte Antworten, meistens aus dem Umkreis bestimmter Schulen. Aber diese Antworten sind so erschütternd, daß man sie gar nicht übertreiben kann. Mit Ausnahme der Sexualsphäre scheint es heute nirgends mehr soviel Aberglauben zu geben, wie auf dem Feld der Kinder- und Jugenderziehung. Liebe und Sorge können ganz falsche Wege gehen, wenn sie sich nicht mit der Kenntnis der Bedürfnisse und Probleme des Jugendalters verbinden. Gewiß gibt es schon viele Erziehungsberatungsstellen in unserem Land. Aber wer gibt schon gerne zu, daß er seine Kinder nicht allein erziehen kann? Außerdem werden die meisten erst dann hellhörig, wenn die Tochter verführt oder das erste Auto durch den Sohn geknackt ist - also viel zu spät. Eine Gesellschaft, die dem "Elternrecht" - glücklicherweise! - soviel Bedeutung beimißt wie die unsere, hat auch die Pflicht, ihr Wissen über Erziehung an die Eltern heranzubringen. Das hat sie vielleicht gerade deshalb bisher versäumt, weil sie die Familie auf den Altar der Tabus gehoben hat.
Für diese Folge wurden benutzt:
Band 2: Andreas Flitner Günther Bittner: Die Jugend und die überlieferten Erziehungsmächte.
Band 3: Günther Lüschen/Rene König: Jugend in der Familie. (Beide im Juventa-Verlag, München.)4. Raubbau mit der Gesundheit
Je größere Erfolge die moderne Medizin erzielt, um so kränker werden wir. Dieser paradoxe Eindruck drängt sich auf, wenn man sieht, daß im Kindes- und Jugendalter die tödlichen Krankheiten erheblich abgenommen haben, aber immer mehr Menschen schon in jungen Jahren von chronischen Krankheiten befallen werden. Wir werden im Durchschnitt 30 Jahre älter als unsere Urgroßeltern, die Säuglingssterblichkeit - früher die "natürliche" Weise der Geburtenkontrolle - fiel von 25 Prozent auf unter 4 Prozent zurück. Die großen, vor allem junge Menschen angreifenden Seuchen wie Tuberkulose und Kinderlähmung werden immer weiter zurückgedrängt, aber von unseren Schulanfängern hat etwa jedes 8. Kind einen schlechten, jedes 2. einen mittleren und nur jedes 3. Kind einen guten gesundheitlichen Allgemeinzustand.
Vielleicht gelingt der Bundeswehr, was der Kinder- und Jugendmedizin bisher nicht gelungen ist: den Gesundheitszustand der jungen Generation nachdrücklich ins sozialpolitische Gespräch zu bringen. Schon einmal hatte das Militär Gelegenheit, Maßnahmen der Jugendgesundheit in größerem Stile durchzusetzen, als es nämlich im vorigen Jahrhundert wesentlich zum Verbot der Kinderarbeit beitrug, weil mit den durch hemmungslose Fabrikarbeit ausgelaugten Rekruten im Ernstfall das Vaterland nicht zu verteidigen war.In einem Bericht des rheinischen Regierungspräsidenten aus dem Jahre 1825 an den preußischen Kultusminister heißt es: "Die Zahl der in den Textilfabriken unseres Bezirks beschäftigten jugendlichen Arbeiter beläuft sich auf 3300. Es werden Kinder vom 6. Jahr an beschäftigt, im Kreise Geldern sogar schon vom 4. Jahr ab. Die Arbeitszeit beträgt bis zu 10 Stunden täglich. Nachtarbeit ist sehr häufig. Ständig nachts beschäftigt werden 125 Kinder. Durch bleiche Gesichter, matte, entzündete Augen, aufgeschwollene Leiber, aufgedunsene Backen ... ekelerregende Hautausschläge und asthmatische Anfälle unterscheiden sich diese unglücklichen Geschöpfe, die früh dem Familienleben entfremdet wurden und ihre Jugendzeit in Kummer und Elend verbringen, gesundheitlich von anderen Kindern."
Das gehört gottlob der Geschichte an. Und trotzdem nennen Mediziner wie der Heidelberger Professor Alexander Mitscherlich unsere Gesellschaft eine "kinderfeindliche". Sie können dabei auf einleuchtende Tatsachen hinweisen: Es gibt in den Bauordnungen der Gemeinden Bestimmungen darüber, auf wieviel Wohnungen eine Garage kommt, aber von Kinderspielplätzen ist nicht die Rede. In der Wohnung stört das Spielen den Vater, den Untermieter oder den Wohnungsnachbarn; im Treppenhaus erlaubt es die Hausordnung nicht; auf der Straße verbietet's die Polizei oder die Gefährdung durch den Verkehr, das "Betreten der Grünflächen in den Anlagen ist verboten".
Meine Nachbarin läßt ihre 4jährige Tochter Ella zweimal täglich zwei Stunden auf den Bürgersteig zum Rollerfahren. Die "Piste" ist genau begrenzt: von der Haustür zur rechten Straßenkreuzung und zurück, auf keinen Fall auch zur linken Kreuzung, weil da wöchentlich mindestens einmal die Autos ineinander fahren und auf den Bürgersteig geraten. Will Ella auf die andere Seite, um mit anderen Kindern zu spielen, muß sie die Mutti zu Hilfe rufen. Nach zwei Stunden ist sie vor Aufregung immer "fix und fertig", wie die Nachbarin sagt. Wie wird Ella die Erfahrung verarbeiten, daß ein Spiel wie Rollerfahren lebensgefährlich ist?Nach dem Krieg besuchte ich mit mehreren Freunden aus unserem Dorf eine Oberschule in der Kreisstadt. Der Schulweg dauerte zweieinhalb Stunden hin und zurück, mußte zu Fuß zurückgelegt werden und führte über Waldwege an endlosen Kirschenplantagen vorbei. Waren die Kirschen reif, dauerte es vielleicht doppelt so lang. Wir verstanden nicht so recht, warum uns die Erwachsenen wegen des langen Weges bedauerten. In München dauert heute der Anmarsch- und Abmarsch zur Schule im Durchschnitt "nur" 60 Minuten, in Dortmund 55 Minuten. Außer den Ärzten scheint das niemand zu bedauern, obwohl diese Stunde vielleicht ebensoviel Konzentration und Nerven kostet wie die fünf Schulstunden zusammen.
Es kann wirklich niemanden erstaunen, wenn bei 60 Prozent der Schulanfänger in Hamburg Verhaltensstörungen festgestellt wurden und ganz allgemein nervöse Krankheiten schon im Kindesalter immer mehr zunehmen. Mit der rigorosen Beschneidung des kindlichen Lebensraumes hängt wohl auch die große Zahl der haltungsschwachen und muskelarmen Kinder zusammen: In den Jahren 1956/57 waren das bei Nürnberger Schulkindern 20 Prozent der Schulanfänger, 22 Prozent der Viertklassler sowie 23 Prozent der Entlaßschüler.
Aus einer statistischen Auswertung der schulärztlichen Jahresberichte für die Jahre 1951 bis 1956 in sieben Bundesländern ergab sich, daß mindestens 15 Prozent der Schulpflichtigen der Einschuljahre 1954 bis 1956 noch nicht schulreif waren. In derselben Zeit wiesen 59 Prozent der Berufs- und Fachschüler chronisch-krankhafte Störungen auf. Von 2,2 Millionen erwerbstätigen Jugendlichen hatten rund 150 000 ( = 7 Prozent) einen schlechten Allgemeinzustand. Wenn sich daran nichts geändert hat, dann verlassen also jährlich etwa 50 000 erwerbstätige Jugendliche die Berufsschule mit schlechtem Gesundheitszustand.Nun ist das, was ein "guter allgemeiner Gesundheitszustand" ist, medizinisch schwer zu bestimmen, weil es dafür nur unzulängliche allgemeine Maßstäbe gibt und man eigentlich den Jugendlichen jahrelang medizinisch beobachten müßte, um zu einem solchen Urteil gelangen zu können. Die eben genannten Zahlen stammen fast ausschließlich aus Reihenuntersuchungen und sagen eigentlich nur, daß die untersuchenden Ärzte mit dem Gesundheitszustand der Kinder und Jugendlichen nicht zufrieden waren - aber sie müssen es ja schließlich wissen.
Die "Kinderausbeutung" des kapitalistischen 19. Jahrhunderts gehört der Vergangenheit an. Geblieben ist aber eine recht robuste Rücksichtslosigkeit der Gesellschaft im Hinblick auf ihre Leistungserwartungen an Kinder und Jugendliche. Das jedenfalls behaupten die Münchener Mediziner Hellbrügge, Rutenfranz und Graf in ihrem Buch "Gesundheit und Leistungsfähigkeit im Kindheits- und Jugendalter". Unsere Kinder und Jugendlichen werden nach der Meinung dieser Autoren in der Schule wie in der Berufsausbildung und im Erwerbsleben medizinisch überfordert.
Zwar gibt es seit 1960 ein verhältnismäßig fortschrittliches Jugendarbeitsschutzgesetz, aber es gilt nicht für die Schule. In München verbringen 10- bis 11jährige 7 Stunden und 47 Minuten und 16jährige 8 Stunden 35 Minuten pro Tag mit Schulweg, Unterricht und Hausaufgaben. Demnach werden die 11jährigen Kinder nur um etwa 45 Minuten weniger beansprucht als die 18jährigen. Medizinisch gesehen sollte dieser Unterschied aber mindestens zweieinhalb Stunden pro Tag betragen. Im gegenwärtigen Schulwesen werden Kinder und Jugendliche etwa im gleichen Maße beansprucht, wodurch insbesondere die Kinder überfordert werden.Auch in den Volksschulen wird zwischen den zeitlichen Anforderungen an die 6- und 10jährigen zu wenig unterschieden. Die 6- und 7jährigen Volksschüler haben pro Woche etwa 3 bis 4 Stunden weniger zu tun als die 13- bis 14jährigen. Wenn in München ein Kind von der Volksschule in die Oberschule wechselt, dann gehört es vielleicht nach einem halben Jahr zu den 14,5 Prozent derer, die Nachhilfeunterricht haben müssen oder zu den 25 Prozent, die ständig die Hilfe ihrer Eltern bei den Hausaufgaben brauchen.
Besonders gesundheitsschädlich ist der Nachmittagsunterricht, wie er aus Schulraummangel vor allem noch in Baden-Württemberg und Bayern die Regel ist. Er findet zwischen 13 und 15 bzw. 15 und 16 Uhr statt, zu einer Zeit, wo das Kind ein ausgesprochenes "Leistungstief" aufweist und infolgedessen sehr viel mehr Leistungsreserven als vormittags mobilisieren muß. Theodor Hellbrügge und seine Mitarbeiter treten deshalb in dem genannten Buch auch unumwunden für ein Verbot des Nachmittagsunterrichts in den ersten Volksschulklassen ein.
In den Oberschulen ist die Stoffülle immer mehr angewachsen. In den jahrelangen zähen Auseinandersetzungen um die Schulreform zwischen den Interessen des zahlenden Staates, der prestigebewußten Lehrerverbände und der Wirtschaft gab es bisher mit Sicherheit einen Verlierer: Die Kinder und Jugendlichen. Wenn sie das "Soll' - zum Beispiel der Oberschule - nicht schaffen, werden sie mit größter Wahrscheinlichkeit keinen Beruf ergreifen können, der das Abitur voraussetzt. Der Einsatz ist also hoch und wird mit allen Mitteln angestrebt - unter anderem mit erhöhtem Verbrauch aufputschender Medikamente, der gerade in der Oberschuljugend beängstigend gestiegen ist. Vielleicht liegt hierin auch die Erklärung dafür, daß in den Teenager-Jahren der Tabakkonsum so hoch und der Alkoholkonsum - daran gemessen - relativ gering ist. Warum hat eigentlich noch niemand neben dem "Jugendarbeitsschutzgesetz" auch ein "Jugendschulschutzgesetz" gefordert?
Den berufstätigen Kollegen der Oberschüler geht es nicht besser. Sie arbeiten oft mehr als 10 Stunden am Tag, wenn sie nicht das Glück haben, in der Großindustrie beschäftigt zu sein, die die Begrenzungen des Jugendarbeitsschutzes noch am ehesten einhält. Wie lange man arbeitet, hängt nicht davon ab, wie alt man ist, sondern davon, welcher Berufsgruppe man angehört. So arbeiteten in Dortmund im Jahre 1958 16jährige erwerbstätige Jugendliche bei der Bundespost sieben Stunden, in der Industrie acht Stunden elf Minuten, im Großhandel neun Stunden vierzehn Minuten, im Handwerk neun Stunden vierundzwanzig Minuten und im Gaststättengewerbe zehn Stunden einundfünfzig Minuten im Tagesdurchschnitt. Dabei sind die Wege von und zur Arbeitsstätte nicht einmal berücksichtigt.
Besonders problematisch ist die Beschäftigung verwandter Kinder und Jugendlicher in der Landwirtschaft. Diese sind gegen Überforderungen im allgemeinen wehrloser als die anderen, denn auch Eltern haben oft keineswegs das "richtige Gefühl" dafür, was man den Kindern zumuten kann.
Das neue "Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend" vom 1. Oktober 1960 hat viele Mängel des alten, aus dem Jahre 1938 stammenden Gesetzes beseitigt. Seine Bestimmungen gelten zum ersten Mal für alle erwerbstätigen Jugendlichen. Für die 14- bis 16jährigen wurde die Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden, für die über 16Jährigen auf höchstens 44 Stunden festgesetzt. Viele Mediziner meinen allerdings, daß man für Jugendliche bis 16 Jahre überhaupt keine Erwerbsarbeit zulassen sollte. Bei der Festsetzung der täglichen Arbeitszeit wurde allerdings auf das Alter keine Rücksicht genommen. Jugendliche, gleich welchen Alters, dürfen ebenso wie Erwachsene bis zu acht Stunden täglich arbeiten, in der Landwirtschaft sogar während der Sommermonate neun Stunden.
Das neue Gesetz verbietet auch jede Akkord- und Fließarbeit mit vorgeschriebenem Arbeitstempo für Kinder und Jugendliche, allerdings kann die Aufsichtsbehörde Ausnahmen für Jugendliche über 16 Jahre bewilligen, "wenn die Art der Arbeit und das Arbeitstempo eine Beeinträchtigung der Gesundheit oder der körperlichen oder geistigen Entwicklung der Jugendlichen nicht befürchten lassen".
Aber die Eigenarten der kindlichen Entwicklung bringen es mit sich, daß man erst lange nach Abschluß der Wachstumsvorgänge erkennen kann, ob eine Arbeit oder ein Arbeitstempo im Jugendalter schädlich war. Jugendliche verfügen im Unterschied zu allen anderen Altersstufen über erhebliche, vor allem körperliche Leistungsreserven, so daß sich ein Raubbau an den Reserven oft erst nach Jahren bemerkbar macht. Junge Menschen sind meist von sich aus zu erhöhter Arbeitsleistung in der Umgebung von Erwachsenen bereit, weil ihnen das Anerkennung einbringt. Wer will schon mit 17 Jahren als Schwächling gelten?
Die neuen Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes werden aber offenbar nur sehr unvollkommen eingehalten. Die Frauenjugend der Christlichen Arbeiterjugend (CAJ) befragte im Frühjahr 1963 2000 Jugendliche aus allen Industriezweigen und Berufen und stellte unter anderem fest: nur 47,8 Prozent der 14- bis 15jährigen Mädchen halten die gesetzlich vorgeschriebene Wochenarbeitszeit von 40 Stunden ein. Von den gleichaltrigen Verkäuferinnen arbeiten 24,9 Prozent bis zu 45 Stunden, 17,8 Prozent bis zu 48 Stunden und 25,3 Prozent mehr als 43 Stunden wöchentlich. Bei den 16- bis 17jährigen Mädchen wird die gesetzlich vorgeschriebene Wochenarbeitszeit von 44 Stunden nur von 57,6 Prozent der befragten Mädchen eingehalten. 21,4 Prozent arbeiten 48 Stunden und mehr. In vielen Fällen machen Jugendliche wegen des zusätzlichen Verdienstes gern Überstunden.
Die Vorwürfe vieler Ärzte richten sich nicht dagegen, daß man junge Menschen zur höchstmöglichen Leistung anhält. Im Gegenteil: nur indem sie angemessene Leistungen erfüllen, können sie körperlich, geistig und seelisch wachsen. Aber die Leistungserwartungen in Schule und Beruf sind von Erwachsenen festgesetzt und berücksichtigen nicht, daß die Leistungsfähigkeit sich von Jahr zu Jahr ändert. Junge Männer sind erst nach ihrem 18. Lebensjahr körperlich in dem Sinne erwachsen, daß dann wichtige innere Organe voll entwickelt sind. Bei Mädchen liegt der Abschluß der organischen Entwicklung zwischen dem 16. und 18. Lebensjahr.
Viele Fachleute warnen davor, die jugendlichen Leistungsreserven zu früh anzugreifen, und führen dabei die steigende Durchschnittsinvalidität ins Feld. Im Jahre 1956 waren die Männer im Durchschnitt mit 59 Jahren und die Frauen mit 57 Jahren invalid. Wenn dieser Zusammenhang - der natürlich kaum mathematisch beweisbar ist - wirklich zutrifft, dann geht es gar nicht nur um die Rücksicht auf die Entwicklungsschwierigkeiten des Jugendalters, sondern auch um einen möglichst ökonomischen und rentablen Einsatz der gesellschaftlichen Arbeitsreserven überhaupt.
Ist die Diskussion bis hierher gediehen, wird meist der Sport ins Feld geführt. Gewiß ist es zu wenig, wenn nur zehn bis zwanzig Prozent aller Jugendlichen genügend Sport treiben. Gewiß ist Mangel an Bewegung die Ursache für viele Erkrankungen nicht nur des Jugendalters und führt zu den kleinen, leistungsunfähigen "Büro-Herzen". Gewiß ist es schlimm, wenn für die 18500 vollklassigen allgemeinbildenden Schulen etwa 1100 Turnhallen fehlen. Aber auch der Sport ist keine Wunderdroge, schon deshalb nicht, weil viele Jugendliche gar nicht genug Zeit haben, um Sport treiben zu können. Was sind das für Zeiten, in denen man schon in der Jugend nicht nur zu seinem bloßen Vergnügen Sport treiben darf, sondern zur Erhaltung seiner Gesundheit treiben muß!
Die entscheidende Frage ist vielmehr, ob unsere Gesellschaft zu erkennen bereit ist, daß "Erwachsen-Werden" im biologischen Sinne heute so kompliziert geworden und mit soviel neuen Belastungen behaftet ist, daß die junge Generation dafür einen viel größeren Spielraum braucht als früher. Weniger die Teilnahme an dem größer gewordenen Freizeitangebot, als vielmehr der unerhörte soziale Druck, der heute schon vom Kindesalter an auf Schul- und Berufsausbildung lastet, greift viel zu früh die gesundheitliche Substanz an.Da nützt auch kein Lamentieren über die "böse Industriegesellschaft". Denn die meisten dieser Probleme kann man lösen: man kann Siedlungen so bauen, daß auch die Kinder in ihnen ihren Lebensraum haben; man kann Schulbusse einsetzen; man kann das Berufseintrittsalter heraufsetzen. Das kostet "nur" Verstand, langfristige Planung und - Geld. Wenn unsere Gesellschaft sich dazu nicht entschließt, dann muß man ihr wenigstens ihre guten Ausreden nehmen.
Für diese Folge wurden benutzt:
Bd. 13: Harald Mellerowicz: Das körperliche Leistungsvermögen der heutigen Jugend.
Bd. 16: Widukind Lenz/Hellmut Kellner: Die körperliche Akzeleration.
(Beide im Juventa Verlag München)5. Schule und Beruf als Job?
Jährlich entlassen unsere Volksschulen etwa 450 000 Schüler, die meist anschließend einen Beruf ergreifen. Wie haben sie diesen Beruf gewählt und gefunden? Die allgemeine Vorstellung, die sich noch in vielen pädagogischen Büchern findet, ist etwa die: sie haben im Verlaufe ihrer "Allgemeinbildung" in der Volksschule entdeckt, wozu sie besonders begabt sind, und was sie besonders interessiert. Nun fühlen sie sich "berufen", auf diesem ihrem Gebiet etwas Besonderes zu leisten, und sie entscheiden sich für den Beruf, der ihrer Begabung und ihren Interessen am nächsten kommt. Da der einmal gewählte Beruf ihrer innersten Neigung entspricht, werden sie ihn auch als "Dauerberuf" Zeit ihres Lebens ausüben.
Wie dagegen die Wirklichkeit aussieht, könnte man viel eher mit dem bekannten Blinde-Kuh-Spiel beschreiben: Man schreibe jeden der 18 000 Berufe auf einen Zettel, verbinde dem 14jährigen die Augen und lasse ihn einen Zettel ziehen. Seitdem das Kind nicht mehr den Arbeitsplatz des Vaters aus eigener Anschauung kennt - was allenfalls noch im handwerklichen oder landwirtschaftlichen Familienbetrieb möglich ist - bleiben die Bedingungen des Berufslebens wie auch die Aufgaben einzelner Berufe den Kindern und Jugendlichen weitgehend unbekannt. Was sie wissen, sind "distanzierte Kindheitserfahrungen" - wie Heinrich Ebel von der Dortmunder Sozialforschungsstelle das nennt: Sie wissen vor allem das, was sie als Kinder selbst beobachten konnten.
Diese Tatsache wird nun seit einiger Zeit in der Öffentlichkeit erheblich dramatisiert. Man übersieht dabei, daß auch Abiturienten, die in einen Beruf gehen, kaum realistische Vorstellungen von der Arbeitswelt haben, und daß auch Philologen, die mit dem Examen einer Universität in der Tasche "in den Schulalltag gehen", sich nicht träumen lassen, was sie dort erwartet. Es ist bekannt, daß manche Studienfächer an der Universität - wie das Jurastudium - viele Studenten anziehen, die nicht wissen, was sie werden wollen, wohl aber wissen, daß der Studienabschluß ihres Faches ihnen viele, recht verschiedene Berufstätigkeiten öffnet. Aber erstens sind der Abiturient und der Philologe älter und reifer und deshalb anpassungsfähiger an eine neue soziale Umgebung, und zweitens wissen sie mehr von der Welt, um sich die unbekannte Wirklichkeit des Arbeitsplatzes auch besser vorstellen zu können.
Offenbar können wir heute eine uns fremde soziale Umgebung wie die des Betriebes nur dadurch "erfahren", daß wir sie uns geistig vorzustellen vermögen. Das Problem der Berufswahl der 14jährigen liegt also nicht darin, daß sie unzureichende Berufsvorstellungen haben - die hat jeder vorher - sondern darin, daß sie zu jung und geistig zu unreif sind, um sich im Betrieb selbst eine solche Vorstellung verschaffen zu können. Daß der Übergang von der behüteten Familienwelt in die ganz anders geartete Arbeitswelt so früh und so plötzlich erfolgt - darüber klagen sie vor allem.
Hoffnungslos rückständig!
Nicht so sehr Gymnasium und Universität - wie die gegenwärtige öffentliche Diskussion glauben machen will - sondern vielmehr unser Berufsausbildungssystem ist von hoffnungsloser Rückständigkeit. Vieles kommt dabei zusammen: Eine theologische Überlieferung vom Beruf als ein von Gott verliehenes Amt; eine darauf zugeschnittene Vorstellung von "Begabung" ("Wem Gott ein Amt gibt, gibt er auch Verstand"); eine durch die deutsche Romantik herübergerettete, aus der mittelalterlichen Zunfterfahrung stammende Vision von der "Lehre", die ganz auf das persönliche "Meister-Lehrling-Verhältnis" gegründet ist.
Die junge Generation ist weitgehend frei von solchen Überlieferungen. Sie verlangt vor allem ein hohes Niveau der Ausbildung und erwartet vom Ausbilder, daß er ein guter Fachmann ist, der seine Kenntnisse geschickt weitergeben kann. Die Berufswahl erfolgt tatsächlich nämlich keineswegs im Verfahren des Blinde-Kuh-Spiels; denn die meisten Jugendlichen entscheiden sich merkwürdigerweise für die in der Produktion und Verwaltung zukunftsträchtigen Berufe Man kann fast die Regel aufstellen: Die Berufswahl wird um so vernünftiger, je geringer die Macht des heimischen Milieus ist; denn falsche Berufsentscheidungen, die wenige Jahre später schon wieder korrigiert werden müssen - der oft zitierte Bäckergeselle, der mit 18 Jahren als Angelernter in eine Maschinenfabrik geht - sind vor allem ein Problem des Landes und der kleinen, industriearmen Städte.
Zwar gibt es bei uns etwa 18 000 Berufs- und Tätigkeitsbezeichnungen, ihnen standen aber 1959 nur 438 Lehr- und 146 Anlernberufe gegenüber, die die Wirtschaft offenbar für ausreichend zur Vorbereitung auf alle anderen Tätigkeiten hält. Diese Zahl verringert sich noch dadurch, daß etwa 100 Berufe lediglich Doppelbenennungen sind. Noch überschaubarer werden die Verhältnisse, wenn man weiß. daß in den zwölf bekanntesten Ausbildungsberufen bereits 60 Prozent aller industriellen Lehrlinge ausgebildet werden. In weiteren 50 Berufen sind noch einmal 29 Prozent der Lehrlinge erfaßt, so daß tatsächlich etwa 90 Prozent aller Lehrlinge in nur 62 Berufen ausgebildet werden.
Andererseits gibt es 100 Ausbildungsberufe, die 1959 nur mit insgesamt 450 Lehrlingen besetzt waren. Berücksichtigt man weiter, daß in vielen der verbleibenden Ausbildungsberufe weitgehend dasselbe gelehrt und gelernt wird, so könnte man die berufliche Grundausbildung auf ganz wenige Säulen konzentrieren, die dann schnelles Anlernen in zahlreiche Berufstätigkeiten ermöglichen würden.
Berufswechsel wird normal
Dies zeigt, daß unsere gegenwärtige Berufsausbildung in zweierlei Hinsicht unnötig unrentabel ist. Einerseits entspricht die Zersplitterung in viele Ausbildungsberufe keineswegs den Bedürfnissen der Wirtschaft, sie macht vielmehr die meisten Ausbildungsstätten unrentabel und setzt die vorhandenen Ausbilder und Lehrer nicht zweckmäßig ein. Zweitens bahnt sich zum erstenmal in der Geschichte der Industriegesellschaft eine Interessengleichheit zwischen Wirtschaft, Pädagogik und den Bedürfnissen der Jugendlichen an; denn auch die Wirtschaft kann nicht länger daran interessiert sein, daß Jugendliche schon mit 14 Jahren in die betriebliche Ausbildung gelangen, was heute noch bei einem Viertel aller 14jährigen der Fall ist. Auch das ist unrentabel geworden, weil die Ausbildung durch die Rücksichtnahme auf das Alter ungebührlich verlängert wird. Eine zehnjährige allgemeinbildende Schule muß heute im Interesse der Wirtschaft liegen - falls die vermehrte Schulzeit auch zur Vorbereitung auf die Arbeits- und Wirtschaftswelt genutzt wird.
Das wird auch durch einen Blick auf andere hochindustrialisierte Länder bestätigt. In den USA besuchen 70 Prozent aller 17jährigen noch eine Vollzeitschule, in Belgien 34 Prozent, in Frankreich 28 Prozent und in der Bundesrepublik nur 16 Prozent. Der schon zitierte Heinrich Ebel hat außerdem in einer Untersuchung nachgewiesen, daß heute ein Großteil der Industrie dem Jugendlichen unter 18 Jahren verschlossen ist. Entweder verbietet das neue Jugendarbeitsschutzgesetz die Arbeit an den Stätten der Produktion, oder aber die Maschinen und Ausrüstungen sind so wertvoll, daß den Betrieben das Risiko zu groß ist, sie von Jugendlichen bedienen zu lassen. Gerade in der am weitesten entwickelten Industrie finden wir also schon eine Aufteilung in "Jugendberufe" und "Erwachsenenberufe", mit anderen Worten: Der Berufswechsel wird zunehmend unvermeidbar, er wird "institutionalisiert". Damit gehört der "Dauerberuf", den man sein Leben lang ausübt, immer mehr der Vergangenheit an, Berufswechsel - auch innerhalb großer Betriebe - wird immer "normaler".Der richtige Einstieg
Nun müssen wir die boshafte Geschichte vom Blinde-Kuh-Spiel endgültig korrigieren. Sie beruhte auf einer falschen Voraussetzung. Berufswahl ist nämlich für uns alle keine einmalige Entscheidung mehr, sondern ein langer Prozeß der Berufsfindung. Worauf es ankommt, ist, daß man einen guten "Einstieg" findet und die Möglichkeit hat, weiterzulernen, wenn man will. Eine solche Möglichkeit hat aber nur derjenige, der genügend informiert ist, der zum Beispiel einen so guten sozial- und wirtschaftskundlichen Unterricht genossen hat, daß er sich den ganzen Zusammenhang der Berufs- und Wirtschaftswelt vorzustellen vermag. Eine gute Einführung in die Arbeitswelt kann heute paradoxerweise nur noch in der Schule stattfinden.
Zweifellos kann man die Einstellung der jungen Generation zur Arbeit sehr viel eher durch "Job" als durch "Beruf" kennzeichnen, weil dem deutschen Wort so viel falsch gewordener Hintersinn anhaftet.
"Job" kennzeichnet eine Einstellung mit einem sehr konkreten Ethos: man unterwirft sich den Gesetzen der rationalen Technik im Betrieb und der Solidarität mit denen, mit denen man unmittelbar umgehen muß, aber dieses Ethos gewinnt keine Totalität über das ganze Leben mehr: es gilt nicht mehr nach Feierabend. Die Lernfreudigkeit und Arbeitswilligkeit der jungen Generation in diesem eingeschränkten Sinne wird allgemein gelobt. Das gilt selbst für viele Jugendliche, die in ihrer Freizeit recht schwierig zu nehmen sind. Diese Tendenz - der Arbeit das Ihre zu geben, nicht mehr und nicht weniger - muß man pädagogisch unterstützen, weil sonst die Erfahrungen und Erfordernisse der Arbeit für allgemeingültig angesehen werden. Aber der Betrieb ist weder ein Modell für den Staat noch für die Familie - er hat eben ganz andere Gesetze.
Aber widerspricht dieser angeblichen Lernfreudigkeit nicht, daß Jugendliche aus den unteren Schichten trotz vorhandener Fähigkeit nur sehr zögernd weiterbildende Schulen besuchen? Warum folgen sie nicht dem Appell, die Zahl der Studenten und Abiturienten zu vermehren? Dafür gibt es viele Gründe. Einer der wirksamsten, der am wenigsten genannt wird, ist, daß unser höheres Schulwesen Fähigkeiten und Begabungen - nämlich literarisch-philologischer Art - herausfiltert, die den sozialen Erfahrungen dieser Schichten nicht entsprechen. Solange wir keinen gleichberechtigten Bildungsweg über die Berufsausbildung und die höheren Fachschulen zur Universität einrichten, werden diese Appelle noch lange ungehört verhallen. Während wir nach mehr Abiturienten rufen, muß man sich an vielen Orten wegen Überfüllung drei bis vier Jahre vorher anmelden, wenn man eine Ingenieurschule besuchen will.Die Rolle der "Bezugsgruppe"
Hier liegt das entscheidende Mißverhältnis unseres Bildungswesens: Für das, wofür die meisten Jugendlichen fähig, begabt und lernwillig sind, haben wir keine Schulen. Man darf nicht vergessen, daß 80 Prozent (1958) unserer Abiturienten an die Universität gehen, daß also unsere Gymnasien in erheblichem Maße "Vorschulen der Universität" sind, was sie in den unteren Schichten sicher nicht attraktiver macht. Wer aus einer typischen Arbeiterumgebung auf eine Oberschule geht, verläßt damit seine "Bezugsgruppe", unter anderem seine Freunde. Diesen harten Schritt würde er vermeiden, wenn er eine Ingenieurschule oder eine andere Fachschule besuchen würde.
Welche Schule man besucht, wird also nicht von "der Gesellschaft", sondern von unmittelbaren Milieu her entschieden - weshalb finanzielle Förderung allein auch gar nichts nutzt. Die geringste statistische Chance, eine höhere Bildung und Ausbildung zu erreichen, hat ein katholisches Mädchen aus einer Arbeiterfamilie, das in Bayern auf dem Lande wohnt. Noch zur Jugendzeit der Eltern war unser Schulwesen ja ein ,.Klassenschulwesen": die Gymnasien für die Oberschicht, die Mittelschule für den Mittelstand, die Volksschule für die übrigen. Ich kenne selbst einen Fall, wo noch vor wenigen Jahren ein hochbegabtes Mädchen die Oberschule wieder verließ, weil es den Konflikt mit der Familie nicht mehr ertrug: die Oberschule zwang sie, anders als die Familie zu sprechen, andere Bücher zu lesen, sich für andere Filme und überhaupt für andere Freizeitbeschäftigungen zu interessieren und isolierte sie auf diese Weise immer mehr von ihrer Familie. Sicher wird dieser Konflikt selten so dramatisch, aber er ist fast immer da.Bildungswert? Nicht gefragt
Wenn heute die Oberschicht nur ein Dreißigstel aller Schüler, aber fast die Hälfte aller Gymnasiasten stellt, so hat das kaum etwas mit "Begabung" zu tun, sondern vor allem damit, daß für diese Kinder das Gymnasium schon im Vorschulalter beginnt - wie zu Hause gesprochen wird, wofür man sich interessiert, was man liest usw. Wenn man schon bei dem mystischen Wort "Begabung" bleiben will, so kann man allenfalls sagen, daß sie bei diesen Kindern schon vom ersten Lebensjahr an, bei den Kindern der Unterschicht aber erst vom 10. Lebensjahr an geweckt und gefördert wird. So wundert es nicht, wenn Schüler des altsprachlichen Gymnasiums Väter mit dem höchsten Bildungsniveau haben: 59,5 Prozent von ihnen haben Abitur, 50,2 Prozent eine abgeschlossene Hochschulausbildung.
Die oft gehörte Behauptung, bei aller Lernwilligkeit habe die Lernleistung der jungen Generation im Vergleich zu früher abgenommen, läßt sich ebenso schwer beweisen wie widerlegen. Immerhin könnte man ihr entgegenhalten, daß im Jahre 1908 im damaligen Deutschen Reich nur 40 Prozent aller Volksschüler das Schulziel erreichten, 1938 schon 70 Prozent und 1962 in der Bundesrepublik 83 Prozent. Einleuchtender ist schon die Beobachtung vieler Lehrer, daß sich die Interessen und Fähigkeiten deutlich verlagert haben. Oberschüler besuchen das Gymnasium weniger deshalb, weil sie dort in die Werte der Kultur und die Traditionen der Väter eingeführt werden, sondern weil sie sich auf diese Weise eine "privilegierte Berufsausbildung" verschaffen, die sie berechtigt, mindestens in die "Unteroffiziers-Positionen" unserer Gesellschaft einzurücken. Gelernt wird, was in einem unmittelbaren Sinne "gebraucht" wird, und gebraucht wird, was zensiert wird.
Auch aus den Erfahrungen der Universität läßt sich sagen, daß die überwiegende Zahl der Studenten gar nicht mehr versteht, was ihre Professoren meinen, wenn sie vom "Bildungswert" ihres Faches sprechen: daß man sich mit dem Gelernten selbständig geistig auseinandersetzen, nach seinem Wert und Sinn fragen soll. Die Aufforderung, über einen behandelten Stoff zu diskutieren, begegnet meist verständnislosen Blicken. aber jede Randbemerkung des Lehrenden wird aufgeschrieben, als ob gerade sie bei der kommenden Prüfung den Ausschlag geben könnte. Auch diese Einstellung ist meistens recht nützlich, denn immer seltener wird in einer Prüfung mehr als abfragbares und eindeutiges Wissen verlangt.
Was heißt "lebensnah"?
Ganz ohne Zweifel hat die Job-Gesinnung längst auch die höheren Formen der Ausbildung erreicht. Das führt einerseits zu einer wohltuenden Versachlichung des Lernens. Andererseits aber entsteht auf diese Weise eine ständig steigende Zahl von hochqualifizierten Lebensuntüchtigen; denn die Konzentration auf das beruflich und ökonomisch Verwertbare unterschlägt eben einfach einen großen Teil der Lebenswirklichkeit. So findet man immer mehr einen Gebildeten-Typ, dessen berufliches Können zwar dem Jahr 1984 entspricht, dessen Familienvorstellungen aber im 19. Jahrhundert stecken geblieben sind, und dessen Urteil über moderne Freizeiterrungenschaften, wie das Fernsehen, geradezu an Verfolgungswahn grenzt - eine merkwürdige Ungereimtheit, die die alten Erfinder des inzwischen so geschwundenen "Bildungsbegriffes" gerade vermeiden wollten.
Diejenigen, die heute für eine "lebensnahe" und "praktische" Schule und Universität eintreten, werden bei dem größten Teil der gegenwärtigen Jugendgeneration ungeteilten Beifall finden. Aber was ist denn nun eigentlich "lebensnah" und "praktisch"? Ist es unpraktisch, wenn man seinen Eheproblemen denkend auf den Grund gehen kann? Wenn man im Zeitalter des Fernsehens etwas von den Formen der Literatur versteht? Ist es nicht "lebensnah", wenn man lernt, sinnvoll Zeit zu vertrödeln? Oder wenn man weiß, daß es eine immer mehr anschwellende Forderung nach politischer und gesellschaftlicher Gleichberechtigung war, die zum Grundgesetz geführt hat? Ist es unpraktisch, einen religiösen Text wie die Bergpredigt zu verstehen? Für wen wäre es unpraktisch, wenn die meisten Menschen außer den vielen schlechten auch die wenigen guten Filme verstehen könnten?
Eine junge Generation, die unter dem Druck schulischer und beruflicher Leistungsforderungen steht, hat das Recht, solche Dinge für überflüssig zu erklären. Aber eine Erwachsenengeneration handelt betrügerisch, wenn sie den Umfang der tatsächlichen Lebensaufgaben auf die zweckmäßige Bedienung von Maschinen zusammenschrumpfen läßt.
Für diese Folge wurden benutzt:
Bd. 2: Andreas Flitner/Günther Bittner: Die Jugend und die überlieferten Erziehungsmächte.
Bd. 14: Carl-Ludwig Furck: Das Leistungsbild der Jugend in Schule und Beruf (Beide im Juventa-Verlag, München)6. Kann man nicht schneller reif werden?
Helga ist gerade aus der Schule entlassen worden und seit einigen Tagen Lehrling in einem großen Friseurgeschäft. Die neue Arbeit und die neue Umgebung sind noch recht ungewohnt. Vor allem fühlt sie sich "zurückgeblieben" im Vergleich zu den nur um ein Jahr älteren Mädchen des 2. Lehrjahres, denn die sind geschminkt, tragen moderne Frisuren und sehen wie junge Damen aus. Helga dagegen hat bisher nichts von Lippenstiften gehalten und ihre Haare ohne besondere Raffinesse einfach nach hinten gekämmt.
Aber die Kolleginnen nennen das spöttisch eine "Kinderfrisur". Allmählich beginnt Helga zu begreifen, daß ihre Frisur wohl nicht nur ihre Privatsache ist, wie sie bisher immer glaubte, sondern daß sie ihr Ansehen im Kollegenkreis nachhaltig bestimmt. Der Sticheleien ihrer Kolleginnen müde, holt sie ihr bestes Kostüm aus dem Kleiderschrank, läßt sich die langen Haare abschneiden und nach dem Vorbild einer bekannten Schauspielerin neu frisieren.Aber jetzt stellen sich neue Schwierigkeiten ein: Da Kostüm und Frisur ausgezeichnet zueinander und zu ihrer guten Figur passen, drehen sich auf der Straße die Männer bewundernd nach ihr um. Einige Vorwitzige pfeifen ihr sogar über die Straße zu. (Wie muß man auf sowas reagieren?) Es wäre "stillos", wenn sie in der neuen Aufmachung weiterhin mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren würde. Abends trifft sie sich zum gewohnten Kinogang mit ihren "Spielkameraden", aber die wissen nicht recht, was sie mit ihr anfangen sollen. Gehört Helga noch zu ihnen?
Dies ist die Story des ausgezeichneten Kurzfilms "Gesicht von der Stange?", der in der freien Jugendarbeit als Diskussionsfilm sehr beliebt ist. Psychologen haben uns gesagt, daß das alte Märchen "Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen" ein Symbol für die Probleme des Erwachsenwerdens sei. In diesem Sinne wäre unser kleiner Film ein modernes Märchen. Er zeigt, wie problematisch Erwachsenwerden ist - was die Erwachsenen viel zu schnell wieder vergessen.
Spinnen wir das Los der "kleinen" Helga noch ein wenig weiter aus! Zu Hause bleibt sie noch lange Zeit das "Kind". Es gibt Streit wegen der neuen Aufmachung und wegen des zunehmenden Gebrauchs kosmetischer Artikel. "Bestimmte Themen" werden in ihrer Gegenwart nicht behandelt. Das tun die Kolleginnen im Geschäft dafür um so ausgiebiger und um so mehr, je "naiver" Helga (noch) sich aufs Zuhören beschränken muß. Nach spätestens einem Jahr wird sie weitgehend selbständig arbeiten - wie ein Erwachsener - aber trotzdem immer noch "Lehrling" sein. Daß sie schon jetzt wie eine junge Dame aussieht, freut zwar nicht die Eltern, aber den Chef, denn Mitarbeiterinnen mit "Sex" heben in jedem Falle das Geschäft.
Bald wird sie einen gleichaltrigen jungen Mann kennenlernen und sich verlieben. Für ihn ist sie eine "Frau" - in vollem Sinne des Wortes. Zwischen 16 und 17 Jahren muß Helga zugleich sein, was man eigentlich gar nicht zugleich sein kann: Kind, Lehrling, erwachsene Berufstätige und Frau. Einen solchen "Rollenpluralismus" verlangt die Umwelt einfach von ihr. Und wenn sie ein kluges Mädchen ist, das sich und die Welt ein wenig beobachtet, dann wird sie sich bald das fragen, was die Psychologen die Ich-Identität nennen. Wo bin ich denn nun eigentlich ich selbst?Dieser Rollenpluralität, mit der sich junge Leute heute buchstäblich über Nacht auseinandersetzen müssen, entspricht die Pluralität der Leit- und Vorbilder. Man hat mit Genugtuung vermerkt, daß die Jugendlichen auf die Frage nach ihrem Vorbild meist nicht Filmschauspieler nannten - wie man erwartet hatte - sondern Menschen wie Albert Schweitzer. Aber für welche Rollen, die Helga zu "spielen" hat, sollte ein solcher Mann ihr denn wohl Vorbild sein? Kann überhaupt noch ein Mensch Vorbild sein für alle Rollen? Müßte man nicht gleichsam für jede Rolle ein Vorbild haben? Ist es vielleicht so, daß die Jugendlichen in solchen Leitbild-Untersuchungen auf Fragen antworten, die sie gar nicht mehr verstehen, und daß die Wissenschaftler diese Antworten in die Sprache ihrer Generation übersetzen, so daß man sich hier gewissermaßen doppelt mißversteht? Vielleicht gehört es überhaupt der Vergangenheit an, daß man im Jugendalter sein Leben nach Vor- und Leitbildern einrichtet - einer Vergangenheit, wo es diese Rollenpluralität noch nicht gab oder wo man sich noch einbilden konnte, daß es sie nicht gab?
Durch diese "Durststrecke" mit Erfolg hindurchzukommen, nennen wir "Reifung". "Reif", d. h. "erwachsen" ist, wer in der Pluralität der Rollen leben kann und trotzdem seine Ich-Identität nicht verliert. Aber es kommt noch eine Schwierigkeit hinzu: Jeder wird gleichsam nach seinem eigenen Tempo reif.
Franz und Peter sitzen in der 8. Klasse der Volksschule nebeneinander und sind 14 Jahre alt. Franz ist 172 cm groß und hat damit die "Normallänge" eines 17jährigen, Peter ist dagegen nur 136 cm groß und sieht aus wie ein "normaler" Zehnjähriger. Keiner von beiden ist deshalb etwa krank, sondern jeder ist auf seine Weise durchaus "normal" entwickelt. Diese Erscheinung, die man seit etwa Mitte des vorigen Jahrhunderts beobachtet, nennt man "Akzeleration", Entwicklungsbeschleunigung. Unsere Kinder und Jugendlichen in allen industriellen Ländern wachsen nicht nur schneller als früher, sie werden auch größer als früher. 1957 waren bei der Musterung in der Bundesrepublik 66 Prozent der Jugendlichen größer als 170 cm, 1934 nur 46 Prozent und zu Beginn des Jahrhunderts nur 28 Prozent. Selbst die Neugeborenen sind heute etwa 1,5 bis 2 cm größer als noch vor 20 Jahren.
Lange Zeit hat man an den Gründen für diese Erscheinung herumgerätselt und ist sich auch heute noch nicht ganz einig darüber. Berufspessimisten sprechen gerne von einer "Degenerationserscheinung". Das Gegenteil ist wohl einleuchtender: Die Akzeleration scheint eng mit der Höherentwicklung des Lebensstandards, vor allem mit der Verbesserung der materiellen Lebensbedingungen (Ernährung) zusammenzuhängen, vermutlich aber auch mit den schon früher einsetzenden Umweltreizen. Als Beweis dafür kann dienen, daß keineswegs alle Kinder unseres Volkes in gleicher Weise akzeleriert sind: Oberschüler sind im Durchschnitt größer als Volksschüler, dieser Entwicklungsvorsprung beträgt gegenwärtig etwa ein Jahr und scheint ständig abzunehmen. Außerdem gibt es regionale Unterschiede. Die Akzeleration nimmt in der Reihenfolge Großstadt - Mittelstadt - Kleinstadt - Land ab. Im allgemeinen läuft die beschleunigte Entwicklung durchaus "harmonisch" ab, weil alle Organe in gleicher Weise davon betroffen sind. So setzt auch die geschlechtliche Reifung etwa ein bis zwei Jahre früher ein als noch vor 50 Jahren.
Lange Zeit hat man geglaubt, daß im Zuge der Akzeleration nur die körperliche Entwicklung schneller erfolge, die geistig-seelische Entwicklung dagegen sehr viel langsamer. Daraus hat man dann manche Verhaltensweisen des Jugendalters bis hin zur Jugendkriminalität zu erklären versucht. Diese Erklärung war nicht zuletzt deshalb so beliebt, weil man damit alle wichtigen Jugendprobleme auf die "Natur" abschieben konnte und an den gesellschaftlichen Verhältnissen glaubte nicht viel ändern zu müssen. Führende Psychologen wie Professor Udo Undeutsch in Köln sind dagegen heute der Meinung, daß auch die körperlich-geistige Entwicklung meistens harmonisch abläuft. Schulreifetests und ähnliche Untersuchungen haben gezeigt, daß körperliche "Schnellentwickler" meist auch geistige Schnellentwickler sind.
Peter und Franz, unsere beiden Achtklässler, unterscheiden sich also nicht dadurch, daß der große Franz das Gemüt des kleinen Peter hätte, sondern dadurch, daß der große Franz körperlich und geistig schon etwas leisten kann, was der kleine Peter noch nicht vermag. Daran stören sich aber weder die Schule noch der Betrieb, in den sie eintreten werden. Sie verlangen von beiden dasselbe. Das kann nun heißen, daß sich der Große langweilt, oder daß er Kleine überfordert wird. Es wäre gar nicht so abwegig, für die Jahre der Pubertät die Schule nicht mehr nach Jahresklassen zu ordnen, sondern Klassen für die Großen und für die Kleinen einzurichten - was natürlich technisch kaum durchführbar ist.
Wenn vom "Reifealter" die Rede ist, denken wir zunächst an die sexuelle Problematik des Jugendalters. Dann wird meist "die gute alte Zeit" beschworen, wo es noch sittsame Mädchen und scharmante Kavaliere gegeben habe. Aber immerhin gehört die sexuelle Verlogenheit der Jahrhundertwende offensichtlich der Vergangenheit an und immerhin ist heute das Mädchen aus den untersten Schichten nicht mehr bloß das Sexualobjekt der "jungen Herren".
Die Sexualfrage im Jugendalter ist heute mehr denn je eine soziale in dem Sinne, daß die geschlechtliche Reifung früher einsetzt, die Ausbildungswege sich aber immer mehr verlängern, so daß eigentlich auch die Heirat immer weiter hinausgeschoben werden müßte. Die junge Generation scheint dieses Problem immer mehr im Sinne eines Kompromisses zu lösen.
Einerseits bekennt sie sich immer offener zum vorehelichen Geschlechtsverkehr, den bei einer EMNID-Befragung 1964 nur 12 Prozent der 18- bis 21jährigen "streng ablehnten". 17 Prozent hielten diese Einstellung für "richtig", 28 Prozent für "nur gut mit künftigem Ehepartner" und 21 Prozent für "meistens abzulehnen". 22 Prozent gaben keine Stellungnahme ab. Nun darf man den Antworten auf solch intime Fragen nicht ganz vertrauen. Viele werden sich genieren, viele auch "angeben", ohne ihre Meinung auch wirklich zu praktizieren Trotzdem darf man damit rechnen, daß der voreheliche Verkehr unter der heutigen Jugend mehr und mehr der Normalfall zu werden scheint.So sehr dieser Wandel den christlichen Traditionen widerspricht, so wenig darf man ihn einfach als "Entsittlichung" abtun. Denn diese Haltung verbindet sich durchaus mit recht familien-positiven Einstellungen. Wie schon die eben genannten Ergebnisse der EMNID-Befragung andeuten, bildet sich unter der jungen Generation immer mehr der "Moral-Kodex" heraus, Verkehr nur mit dem Partner zu haben, den man auch später zu heiraten entschlossen ist. Damit stimmt auch überein, daß das durchschnittliche Heiratsalter immer niedriger wird.
Bekanntlich ist die Scheidungsquote in den Frühehen recht hoch, was wohl nicht nur an der mangelnden Reife der Partner, sondern vor allem daran liegt. daß die Umgebung so lange meint, das könne nicht gut gehen, bis es auch die Ehepartner selber glauben: "Außenseiter" scheitern immer leichter. Man muß sich aber darüber klar sein. daß materielle, soziale und - im weitesten Sinne - pädagogische Hilfe und Beratung für die Jungehen die wichtigste Möglichkeit der Gesellschaft ist, die positiven Tendenzen des neuen jugendlichen Sexualstils zu unterstützen und zu fördern.Am härtesten ist wegen des immer länger werdenden Studiums die studierende Jugend betroffen. Die Nichtbewältigung der Sexualproblematik scheint sich hier immer stärker auch auf die Studienleistungen auszuwirken. Wenn unsere Gesellschaft den studentischen Paaren nicht wenigstens einen Teil der Furcht vor der frühen Eheschließung und vor allem vor dem Kinde nimmt, dann darf sie sich nicht empören, wenn die jungen Leute auf eine Weise zur Selbsthilfe schreiten, die sie nicht billigt.
Diejenigen, die die "Durststrecke" der Reifung nicht schaffen, nennen wir meist "Kriminelle". Das ist allerdings schon eine grobe Vereinfachung. Denn die Zahl derer, die an den Problemen des Jugendalters scheitern und lebenslange Schwierigkeiten davontragen, ist weitaus größer und statistisch nicht zu erfassen. Das ist grundsätzlich nicht verwunderlich, wenn man sich die Belastungen dieser Altersstufe vergegenwärtigt. "Kriminalität" ist also nur die letzte Stufe des Nicht-fertig-Werdens mit sich und der Welt.
Ganz allgemein ist die Jugendkriminalität zwischen 1950 und 1960 erheblich angewachsen. 1950 wurden 21174 Jugendliche (14 bis 18 Jahre) und 39320 Heranwachsende (18 bis 21 Jahre) verurteilt, 1960 waren es schon 37 089 Jugendliche und 86471 Heranwachsende, wobei allerdings die recht hohen Verkehrsdelikte berücksichtigt werden müssen (für 1960 rund 7000 bei den Jugendlichen und fast 38000 bei den Heranwachsenden). Zugenommen hat vor allem die Vermögenskriminalität. Interessant ist der Vergleich zu den erwachsenen Tätern. Rechnet man den Vermögensdelikten Betrug, Untreue, Erpressung, Begünstigung und Hehlerei hinzu, dann wurden 1960 von 100 000 Volljährigen deswegen 279, von der gleichen Zahl Heranwachsender 897 und von den Jugendlichen 763 verurteilt.
Bei Raub und Erpressung weichen die sogenannten "Kriminalitätszahlen" ( = bezogen auf jeweils 100 000 Strafmündige der betreffenden Altersgruppe) noch weiter voneinander ab: Erwachsene 2,6, Heranwachsende 21,1 und Jugendliche 11,8 Während Mord und Totschlag sowie schwere und gefährliche Körperverletzung nicht zugenommen haben, sind die Sittlichkeitsvergehen wiederum deutlich gestiegen.
Unser Jugendstrafrecht ist auf dem Grundsatz aufgebaut, daß es weniger um Strafe als um die Chance zur Besserung gehen müsse. Aber die wissenschaftlichen Forschungen darüber, warum ein Jugendlicher straffällig wird, und wie man ihn resozialisieren könne, stecken noch in den Anfängen, und was man weiß, findet nur mühsam Eingang in die Praxis der Verwaltung und der Fürsorge. Solche Forschungen sind langwierig und kostspielig, weil man jugendliche Straftäter über Jahre beobachten müßte, um zu verläßlichen Urteilen zu kommen. Aber zwei Erkenntnisse dürfen als gewiß gelten:
Erstens ist die Besserung um so aussichtsreicher, je mehr gut ausgebildete Pädagogen zur Verfügung stehen. Selbst in fortschrittlichen Bundesländern kommt aber auf 40 bis 50 solcher Jugendlicher nur ein Bewährungshelfer, während normalerweise ein Jugendlicher zwei Eltern hat.
Zweitens wäre eine Aufteilung der Kriminellen und Verwahrlosten nach Art und Schwere der Verfehlung nötig. Solange Neurotiker, Homosexuelle und Autodiebe zusammen betreut werden müssen, weil es an geeigneten Einrichtungen fehlt, wird man nicht auf große Erziehungserfolge hoffen dürfen. Die öffentliche Einstellung gegenüber diesen Jugendlichen scheint weniger pädagogischer als hygienischer Art zu sein: Man will verhindern, daß andere angesteckt werden.
An der Kriminalität sind aber immer auch die schuldig, die nicht straffällig werden: weil sie die anderen überfordern oder weil sie ihre Hilfe versagen. Die erfolgreichste Waffe gegen Jugendkriminalität ist noch immer, jungen Menschen bei ihren Problemen rechtzeitig zu helfen. Die Kosten für einen resozialisierten Jugendlichen sind immer noch weitaus niedriger als für einen ungebesserten Kriminellen. Oder ist das Hauptmerkmal dieser Zu-kurz-Gekommenen, daß sie zwar randalieren und stehlen, aber keine politische Wahl entscheiden können?Für diese Folge wurden benutzt:
Bd. 3: Günther Lüschen/Rene König: Jugend in der Familie.
Bd. 5: Horst Schüler-Springorum/Rudolf Sieverts: Sozial auffällige Jugendliche.
Bd. 6: Hans Thomae: Vorbilder und Leitbilder der Jugend.
(Sämtlich Juventa-Verlag, München.)7. Zwölf Thesen zur Jugendpolitik
Das Material unserer Serie stammte weitgehend aus dem 18 bändigen "Überblick zur wissenschaftlichen Jugendkunde", den das "Deutsche Jugendinstitut" beim Juventa-Verlag in München herausgebracht hat. Die imponierende Leistung dieser Reihe besteht fraglos darin, daß mit ihr zum erstenmal in Deutschland versucht wurde, die zahllosen Einzelforschungen zur Jugendkunde nicht nur für den Wissenschaftler, sondern auch für den interessierten Laien zusammenzufassen. Ihr größter Mangel ist, daß sie sich gänzlich unpolitisch gibt.
Aber es gibt heute keine öffentliche Stellungnahme dieses Ausmaßes mehr, die nicht durch und durch politisch wäre, ob die Verfasser das wollen oder nicht. Die Gefahr dieser Reihe ist, daß sie - ungewollt, aber mit der Autorität, die Wissenschaft bei uns immer noch ausstrahlt - dem Leser suggeriert, daß alle Probleme, die das Jugendalter uns heute aufgibt, durch mehr Geld und im übrigen durch verbesserte pädagogische Maßnahmen oder allenfalls durch Appelle an die Erziehungsberechtigten (Eltern) zu lösen seien, daß aber grundsätzlich alles beim alten bleiben könne. Um dieses Bild zu korrigieren, soll unsere Serie mit einigen jugendpolitischen Thesen schließen, die nicht beanspruchen, die Probleme zu lösen, sondern sie nur in der Diskussion behalten wollen.
Viele Probleme des Jugendalters sind uns bekannt, seit es überhaupt zwischen Kindheit und Erwachsenen die Zwischenstufe "Jugend" gibt. Aber in mindestens drei Punkten können wir von einer verhältnismäßig neuen oder jedenfalls radikalisierten Jugendproblematik sprechen.
1. Im Jugendalter radikalisiert sich heute der Rollenpluralismus wie nie zuvor und wie in keiner Altersstufe sonst. Zwar merken auch wir Erwachsenen, daß wir in einer mehrdeutigen Welt leben, die an ihren verschiedenen Orten sehr Verschiedenes von uns verlangt, und die nicht mehr mit einer Handvoll allgemeingültiger "Tugenden" zu bestehen ist. Aber im Jugendalter müssen diese Rollen gelernt werden, während sie zugleich schon abverlangt werden. Außerdem wird die Verwirrung noch dadurch größer, daß die Kindheitsrollen die Erwachsenenrollen überlagern. Vieles, was junge Leute den Erwachsenen als "Unehrlichkeit" vorwerfen - zum Beispiel im Bereich der Politik - ist nichts anderes als die verständliche Unfähigkeit, sich in dem neuen Lebenshorizont angemessen zu orientieren.
2. Die Akzeleration sorgt dafür, daß mit dem Beginn der Pubertät das körperliche und geistige Entwicklungstempo verschiedener Jugendlicher verschieden schnell verläuft. Da die körperlichen und geistigen Leistungsanforderungen in Schule und Beruf aber weitgehend normiert sind, sind entweder die Langsam- oder die Schnellentwickler benachteiligt. Unser Ausbildungssystem geht immer noch von der gegenteiligen Annahme aus - und ist von daher durchkonstruiert - daß Gleichaltrige auch in gleichem Maße entwickelt und daß demnach die Langsamen die Dummen seien.
3. Noch nie zuvor mußte man - innerhalb wie außerhalb der Schule - zwischen 13 und 18 Jahren so Vieles und so Verschiedenes lernen wie heute. Da zudem vor allem das letzte Zeugnis einer Schule bestimmt, welcher beruflichen und sozialen Schicht man zugehören wird, ist gerade das Jugendalter mit Lebensentscheidungen belastet, die angesichts des herrschenden Bildungswesens fast unwiderruflich sind. Nicht nur die Stoffülle wächst in den Schulen, sondern jedem Jugendlichen werden neue soziale Lernprozesse abverlangt, die sich die alte "Reifeprüfung" nicht hat träumen lassen.
4. Die Gesellschaft muß den Jugendlichen daher mehr und längere Entlastung von den Ernstverpfichtungen, d. h von Erwachsenenverpflichtungen, gestatten. Berufsrolle, Geschlechterrolle und Freizeitrolle sind heute vor allem solche Ernstverpflichtungen. Um die Radikalisierung der Belastungen zu entspannen, muß das Berufseintrittsalter auf mindestens 16 Jahre heraufgesetzt und die zehnjährige allgemeine Vollzeitschule eingeführt werden Das muß nicht heißen, daß die junge Generation länger als bisher der Volkswirtschaft entzogen wird. Wenn die längst fällige Neuordnung der Berufsausbildung nicht länger als undurchsichtiger Kompromiß zwischen den verschiedenen Interessen, sondern als optimale Lösung der Probleme von allen Beteiligten angestrebt wird, dann kann die Berufsausbildung selbst auch rentabler gestaltet werden.
Auch bei einer 10-Jahres-Schule könnten Jugendliche die erste Phase ihrer Berufsausbildung mit 18 Jahren abgeschlossen haben. Ohne Zweifel ist der rückständigste Teil unseres Bildungswesens die Berufsausbildung. Daß für viele Berufe heute das Abitur gefordert wird, liegt weniger daran, daß die Personalpolitik der Wirtschaft unsinnig wäre, als vielmehr daran, daß wir in Deutschland - sehr im Unterschied zu anderen Ländern - kaum dem Leistungsniveau des Abiturs vergleichbare Berufsausbildungsstätten haben.
5. Die gegenwärtigen Vorstellungen zur Bildungsplanung sind fasziniert davon, daß unserer Wirtschaft einige tausend Ingenieure fehlen. So wichtig die Lösung dieser Frage zweifellos ist, so sehr besteht die Gefahr, sich für die nächste Zeit auf kurzschlüssige Lösungen festzulegen. Die anthropologische Problematik des gegenwärtigen Jugendalters ist umfangreicher, als der allgemeine Ruf nach mehr Abiturienten und Studenten erkennen läßt.
Es ist einfach geschichtlich rückständig, Schule und Ausbildung allein oder auch nur überwiegend weiterhin an der Berufsrolle zu orientieren. Zum Beispiel ist es genauso wichtig, die Geschlechterrolle zu erlernen - was immer das im einzelnen heißen mag. Wir können nicht länger so tun, als ob alles Wichtige sich noch an einem gesellschaftlichen Ort - zum Beispiel im Beruf - lernen lasse. So läßt sich im Betrieb - und wohl auch in der Schule - nicht ausreichend lernen, wie man seinen Urlaub vernünftig nutzt. Schule und Studium können nicht ohne Rest auf den Nenner des industriellen Arbeitsbegriffes gebracht werden.Die gegenwärtige ökonomisch-statistische Bildungsforschung steht in der Gefahr, die Sachen, die sie erforscht, mit den Methoden zu verwechseln, mit denen sie fragt. Wenn Schule und Studium nichts mehr sind als "gesellschaftlich nützliche Arbeit", werden wir nur ein Heer potentieller Eichmänner heranzüchten. Insofern haben jene Gymnasiasten, die ihre Schulzeit als "privilegierte Berufsausbildung" verstehen, nur pointierter sich angeeignet, was ohnehin zur herrschenden Ideologie in unserer Gesellschaft geworden ist.
Die künftige gesellschaftliche Bildungsplanung kann sich nicht mehr allein auf das Schul- und Hochschulwesen beschränken. Es ist kein Zufall, daß in den letzten Jahren die außerschulischen Maßnahmen der Jugendarbeit und Erwachsenenbildung an Umfang und Bedeutung immer mehr zugenommen haben. Sie sind zum Teil an ganz andere pädagogische Gesetze gebunden als die Schule, aber für das "Rollenüben" mindestens so wichtig wie sie. Diese pädagogischen Felder werden vermutlich immer mehr Teil des ganzen Freizeitsystems werden. In ihnen kann man zum Beispiel etwas lernen, was dem industriellen Arbeitsbegriff entschieden widerspricht: sinnvoll Zeit vergeuden. Daß sich die gegenwärtige Bildungsplanung fast ausschließlich auf das institutionalisierte Schulwesen konzentriert, ist nur ein weitere Beweis dafür. daß sie den vollen Ernst dessen, was Jung-Sein heute heißt, nicht zur Kenntnis nimmt. Weil man alles, was wichtig zu lernen ist, der Schule anlastet, steckt sie in einem Chaos von Lerngütern.
7. Unser gegenwärtiges Schul- und Hochschulwesen ist wesentlich durch die Vorstellung geprägt, daß man im Jugendalter ein für allemal lernt, was man später im Leben braucht. Der im Grunde unnötige Lernterror kommt vor allem dadurch zustande, daß man immer noch an diesem Grundsatz festhält, obwohl das in einer ständig sich wandelnden Gesellschaft eine Illusion ist. Nähme man die Institutionalisierung der Fortbildung in unserem Lande ebenso ernst wie die Schulreform selbst, dann würden falsche Berufs- und Schulentscheidungen im Jugendalter korrigierbar und damit der Druck auf diese Altersstufe weitgehend gemindert. Aber gerade das Fortbildungswesen ist bei uns in einem Chaos regionaler und berufsständischer Beschränktheit erstickt. Es ist nicht nur von Stadt zu Stadt verschieden, es hat auch kaum jemand Kenntnis von ihm.
8. Zur Fortbildung gehört auch, daß man fähig wird, sich der Beratung zu bedienen. Unsere sozialpolitischen Einrichtungen sind vielfach besser als ihr Ruf, aber sie haben mangels Aufklärung und Übung kein Publikum. Ärzte klagen etwa darüber, daß die meisten Patienten viel zu spät kommen. Wenn man im Jugendalter nicht lernt, sich solcher Dienstleistungen zu bedienen, lernt man es kaum noch. Hier läge die pädagogische Bedeutung einer verbesserten Schul- und Jugendmedizin. Sie soll lehren, wie man die Verantwortung für die eigene Gesundheit organisieren kann. Wenn man schon im Jugendalter nicht mehr alles lernen kann, was man im Leben braucht, so muß man wenigstens lernen und üben, wie man sich an wen wendet, wenn man später Rat und Hilfe benötigt. Daraus folgt, daß alle beratenden Berufe pädagogische Berufe sind und einer entsprechenden Ausbildung bedürfen.
9. Die meisten der heute diskutierten Vorstellungen zur Bildungsplanung greifen also zu kurz. Entweder orientieren sie sich an Einzelproblemen (zu wenig Studenten, zu wenig Lehrer, zu wenig Ingenieure). Dann laufen sie Gefahr, den Teil für das Ganze zu halten und in Wahrheit nur an Symptomen zu kurieren. Oder aber man versucht, die Probleme durch Kompromisse zwischen den herrschenden Meinungen und Interessen zu lösen. Aber nicht alles, was machtvolle Meinung ist, ist auch vernünftige Meinung. Wenn man vier oder fünf rückständige Meinungen auf einen Nenner bringt, garantiert das noch nicht eine optimale Lösung.
Ich bin dafür, den Ausdruck "Bildungsplanung" durch "jugendpolitische Planung" zu ersetzen. "Bildungsplanung" wäre dann allenfalls ein Teilaspekt. Ausgangspunkt einer solchen Planung wäre eine umfassende Interpretation der anthropologischen Probleme des Jugendalters im ganzen, was zugleich eine Interpretation der tatsächlichen gesellschaftlichen Verhältnisse wäre; denn "Jugend" ist überhaupt nicht denkbar ohne den Hintergrund der jeweiligen konkreten gesellschaftlichen Umgebung. Nur in einem solchen weiten Horizont werden schul- und bildungspolitische Entscheidungen möglich sein, die nicht schon in fünf Jahren wieder veraltet sind.
10. Eine sinnvolle Kooperation zwischen Wissenschaft und Politik ist bei uns so gut wie unbekannt. Sie verläuft meistens so, daß Wissenschaftler wissenschaftliche Bücher schreiben und die Politiker daraus machen, was sie wollen. Das ist zu einfach. Die Wissenschaftler müssen auch überprüfen, ob die Politiker ihre Fragen richtig stellen. Voraussetzung für eine jugendpolitische Planung wäre also ein umfassender Jugend-Report, der nicht von einer wissenschaftlichen Systematik, sondern von der Frage ausginge, was die Regierungen künftig tun sollen.
11. Der wichtigste Einwand gegen solche umfassenden Neuordnungen ist, daß sie zu viel Geld kosten. Aber das ist nur wahr unter der Voraussetzung, daß die berufsständischen, konfessionellen und regionalen Zufälligkeiten und Beschränktheiten unangetastet bleiben. "Rentabel" denkt man bei uns nur im Hinblick auf das schwächste Glied der Kette: den Schüler oder Lehrling. Der soll in möglichst kurzer Zeit möglichst viel leisten. Aber die heillose Zersplitterung der Institutionen lassen wir uns ein Vermögen kosten. Jede gute Planung kostet nicht nur Geld, sie spart auch welches ein.
12. Keine nach so gut durchdachte Planung kann sich mehr verwirklichen, ohne die Zustimmung einer breiten, aufgeklärten Öffentlichkeit. Es ist einer der folgenschwersten Fehler unserer Kulturpolitik daß sie die Menschen glauben macht, das alles sei nur eine Frage der Fachleute. Man kann aber zum Beispiel kein modernes Schulwesen einrichten, solange Eltern glauben, Töchter seien vor allem zum Heiraten da. Solange diese Öffentlichkeit nicht da ist, wird kein Kulturpolitiker mehr riskieren, als widerstreitende Interessen halbwegs miteinander zu versöhnen. Politik heißt heute aber nicht zuletzt, Interessen an den vorgegebenen tatsächlichen Problemen zu disziplinieren. Wer glaubt, heute schon die wichtigsten jugendpolitischen Notwendigkeiten verwirklichen zu können, versucht Unmögliches. Einstweilen kommt es mehr auf die Aufklärung und Mobilisierung der Bürger an als auf kurzschlüssige "Reformmaßnahmen", die zwar beruhigen, aber nichts lösen. Auch in einer Demokratie werden keine wichtigen Fragen ohne Kampf entschieden.

38. Wandlungen in der Theorie der Jugendarbeit (1965)
(In: Lebendige Seelsorge, H. 8/1965, S. 254-256)Dieser Beitrag läßt die kirchlichen und religiösen Aspekte des Themas bewußt außer acht, weil sie in den übrigen Beiträgen dieses Heftes kompetenter zur Sprache kommen, als es hier möglich wäre. Unsere Blickrichtung ist vielmehr die geschichtliche, soziologische und pädagogische.
Was wir heute "Jugendarbeit" nennen, ist eine erstaunliche Vielfalt von Formen, Inhalten und Maßnahmen. Fast könnte man von einem ungeordneten Sammelsurium sprechen. Das Feld der Jugendarbeit ist schon quantitativ völlig unüberschaubar geworden. Niemand in unserem Lande weiß, wieviel Träger und Maßnahmen es gibt, wieviel Jugendliche wirklich daran teilnehmen und wieviel Geld dafür ausgegeben wird. Selbst dem eben vorgelegten Jugendbericht der Bundesregierung ist es nicht gelungen, hier auch nur einigermaßen Klarheit zu schaffen.
Geschichtlich gesehen
Die Vielfalt der Formen und Maßnahmen geht vor allem darauf zurück, daß jede Form und jede Maßnahme, die wir heute noch vorfinden, zu einem bestimmten geschichtlichen Zeitpunkt entstand und damals eine Antwort auf ganz bestimmte Probleme und Schwierigkeiten war. Die gegenwärtige Jugendarbeit hat mindestens drei recht verschiedene historische Ansatzpunkte. Schon im 19. und noch mehr im 20. Jahrhundert bemühten sich immer mehr Erwachsenenverbände, ihren Nachwuchs und ihre Anhängerschaft möglichst früh aus der nachwachsenden Generation zu gewinnen. In dem Maße, in dem die moderne Gesellschaft die Jugend als eine selbständige soziale Gruppe aus sich entließ, wuchs sie nicht mehr selbstverständlich in die verschiedenen Erwachsenenverbände hinein, sondern mußte jeweils neu dafür geworben werden. Die Entstehung der modernen kirchlichen Jugendarbeit geht ebenso auf diesen soziologischen Tatbestand zurück, wie die Entstehung der Partei- und Gewerkschaftsjugendverbände.
Ganz andere Intentionen und Motive lagen der zweiten Quelle der modernen Jugendarbeit, der Jugendbewegung, zugrunde. Hier ging es gerade darum, den frühzeitigen Zugriff der Erwachsenenverbände auf die junge Generation abzuwehren und die eigenständige soziale und geistige Phase des Jugendalters zu verteidigen. Viele der gegenwärtigen Kontroversen darüber, ob Jugendarbeit eine "pädagogische Provinz" sei oder Hilfe zur "Integration" in die gesellschaftlichen Verbände, erklären sich aus diesen beiden verschiedenen historischen Ursprüngen.
Die dritte Quelle der gegenwärtigen Jugendarbeit schließlich ist in den staatlichen Bemühungen der Jugendwohlfahrt zu sehen, die zu Beginn dieses Jahrhunderts einsetzten und sich mindestens bis zum ersten Weltkrieg gegen die sozialistische Jugendarbeit wandten. Dieser Ursprung ist also ein staatspolitischer, der primär dazu dienen sollte, die junge Generation denjenigen gesellschaftlichen Verbänden zu entziehen, die als staatsfeindlich angesehen wurden. Den Höhepunkt dieser Entwicklung stellte das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz von 1922 dar, das nun zwar nicht mehr antisozialistisch, aber dafür antipolitisch orientiert war.
Alles das, was heute in Sachen Jugendarbeit gedacht und getan wird, läßt sich mehr oder weniger deutlich auf diese historischen Ursprungssituationen hin zurückverfolgen. Das hat unmittelbar zur Folge, daß es sehr schwer fällt, sich miteinander zu verständigen, bevor nicht die naive Tradition zur bewußten und geklärten ge-
254
schichtlichen Analyse geworden ist. Meistens ist man der Meinung, die Jugendarbeit sei lediglich entstanden aus einer immer größer werdenden pädagogischen Verantwortungsbereitschaft gegenüber der jungen Generation. Diese Ansicht spiegelt aber nur getreu das unpolitische Selbstverständnis der modernen, "autonomen" Erziehungswissenschaft wider. Tatsächlich nämlich ist die zweifellos schärfer gewordene pädagogische Verantwortung untrennbar mit bestimmten politischen Prozessen der modernen Gesellschaft verbunden. Die Kinderarbeit wurde relativ spät allgemein als Übel erkannt, und die Lage der proletarischen Jugend um die Jahrhundertwende, die bis dahin als unausweichliches Schicksal empfunden wurde, geriet vor allem deshalb in den Horizont der pädagogischen Verantwortung, weil sie vor allem durch die sozialistischen Gruppen mit politischer Brisanz geladen worden war. So sehr verschieden also die eben genannten drei historischen Ansatzpunkte der Jugendarbeit sind, so sehr werden sie doch auch durch einen sie übergreifenden geschichtlichen Prozeß zusammengehalten und vereinheitlicht. Die drei Ansatzpunkte sind, so könnte man sagen, verschiedene, standortbedingte Antworten auf ein und dieselbe Frage gewesen: auf die durch den Prozeß der "Fundamentaldemokratisierung" (Karl Mannheim) hervorgerufenen Probleme der politisch-gesellschaftlichen Entwicklung im allgemeinen und der daraus wiederum sich ergebenden Jugendprobleme im besonderen.
Soziologisch gesehen
Daraus folgt, daß die heutige Jugendarbeit sich von ihren unmittelbaren historischen Ursprüngen emanzipieren muß, weil die ihnen zugrundeliegenden Probleme durch die Entwicklung entweder gelöst oder doch soweit entschärft sind, daß sie ein eigenes pädagogisches Konzept der Jugendarbeit heute nicht mehr begründen können. Auf eine Formel gebracht: Jugendarbeit in einer Wohlstandsgesellschaft kann sich nicht einfach mehr an Leitbildern orientieren, die in einer Klassenkampfgesellschaft entstanden sind. Sie muß vielmehr heute ihren Blick viel stärker auf solche Probleme richten, die in den grundsätzlichen Zusammenhängen und Widersprüchen von Erziehung und moderner Gesellschaft angesiedelt sind. So beginnen sich denn auch in den neueren Theorien zur Jugendarbeit folgende Einsichten durchzusetzen:
1. Jugendarbeit ist eine wegen der unverminderten gesellschaftlichen Dynamik notwendig gewordene Sozialisierungshilfe, die sich wesentlich an den Konfliktstellen der Gesellschaft etabliert (Klaus Mollenhauer). Sie ist wesentlich Hilfe, solche Konflikte zu meistern.
2. Jugendarbeit ist nicht länger mehr "Notlösung" in einer "schlechten" Gesellschaft, die entfallen könnte, wenn die Gesellschaft "gut" und "richtig" geordnet wäre. So wurde es noch vor wenigen Jahren von einer Jugendpflegerkonferenz formuliert. Vielmehr gliedert sich die Jugendarbeit neben der Familie und der Schule als eigenständige Erziehungsinstitution aus. Es stellt sich nämlich immer mehr heraus, daß bestimmte notwendige Lernleistungen heute weder in der Familie noch in der Schule möglich sind. Seitdem z. B. die Frau nicht mehr nur mögliche Ehepartnerin des Mannes ist, sondern auch seine Kollegin und seine Freizeitpartnerin, muß ein Sozialstil mit einer breiten Varianz gegenüber dem anderen Geschlecht gelernt werden, was in der Schule schon deshalb nicht mehr möglich ist, weil die Ernstbegegnungen der Geschlechter im Betrieb und in der Freizeit stattfinden. Der Pluralität der Gesellschaft muß auch eine Pluralität der von ihr institutionalisierten Erziehungsfaktoren entsprechen.
3. Demnach ist Jugendarbeit nicht mehr wie bisher an den überlieferten Erziehungsvorstellungen der anderen Institutionen zu messen. Sie ist weder eine Familie,
255
noch eine Schule "mit anderen Mitteln", sondern bedarf eigener Erziehungskategorien. Dies ist der tiefere Grund dafür, daß man in den letzten Jahren verstärkt nach einer pädagogischen Theorie der Jugendarbeit sucht, die bisher nicht nötig war, weil sich die Aufgaben von selbst verstanden.
4. Das öffentliche Schulwesen - als das Schulwesen einer demokratischen, pluralistischen Gesellschaft - muß sich zunehmend von den Ansprüchen der einzelnen gesellschaftlichen Gruppen emanzipieren. Man mag es z. B. bedauern, daß der Einfluß der Kirchen auf das Schulwesen unaufhaltsam zurückgeht, aber soziologisch gesehen ist die Ursache klar: die Schule wurde zu einem Zeitpunkt der geschichtlichen Entwicklung eingerichtet, als die unmittelbaren Erziehungsträger nicht mehr ausreichten. Die Schulziele werden in dem Maße immer allgemeiner und abstrakter, je allgemeiner und abstrakter die gesellschaftlichen Aufgaben selbst werden, die den Heranwachsenden in Beruf, Politik und Freizeit zufallen werden. Der pädagogische Einfluß der Kirchen - wie auch der anderen gesellschaftlichen Gruppen - verlegt sich immer stärker in den Bereich der Jugendarbeit und wird wohl in Zukunft überhaupt nur dort noch eine Chance der intensiven kirchlichen und religiösen Bildung haben. Ich glaube, eine gute und erfolgreiche Konzeption für die Jugendarbeit ist für die Kirchen auf lange Sicht viel wichtiger als eine eigene Schultheorie. Das hängt auch noch mit etwas anderem zusammen. Die technischen und ökonomischen Kenntnisse, die nötig sind, um die moderne Gesellschaft vor katastrophalen Fehlentwicklungen zu bewahren, werden notgedrungen immer mehr die Lehrpläne der Schulen ausfüllen müssen. Diejenigen überlieferten Bildungsgüter dagegen, die nicht unmittelbar die "technologische Intelligenz" fördern, werden immer mehr als Luxus erklärt und damit in den Freizeitbereich verwiesen werden, von dem die Jugendarbeit ja ein Teil ist.
5. Die uns bekannten Traditionen der Jugendarbeit hatten es bisher nie mit einem Problem zu tun, das sich heute immer mehr in den Vordergrund schiebt. Ich meine das Problem der Wohlstandsgesellschaft, also die Luxusproblematik. Darauf finden wir in der ganzen pädagogischen Tradition keine Antworten, weil es dieses Problem - jedenfalls als ein Massenproblem - noch nie gegeben hat. Im Gegenteil, wir sind immer noch befangen in der Vorstellung, daß "Luxus" für die menschliche Sittlichkeit schlechterdings ein Hindernis sei. Schon der Gebrauch des Wortes ist negativ gefärbt. Luxus ist das, was überflüssig ist. Darin steckt eine sehr gefährliche Einseitigkeit. Gewiß wird man nicht sagen können, daß die meisten der heute üblichen Konsumverfahren ein Beweis für gesteigerte Humanität seien. Aber erstens ist ein gewisses Maß an Luxus aus ökonomischen Gründen notwendig geworden. Würde unser Volk über Nacht asketisch, so bräche in kürzester Zeit die Wirtschaft zusammen und ein unübersehbares soziales Chaos wäre die Folge. Einübung in den Luxus wäre also eine der dringendsten pädagogischen Aufgaben unserer Zeit.
Hier aber tun sich wohl die größten Schwierigkeiten für eine Theorie der Jugendarbeit auf. Man müßte nicht nur sehr viele bisher für gültig gehaltene Vorstellungen korrigieren, vielmehr hat auch die pädagogische Sprache aus leicht erklärlichen Gründen kaum einen Zugang zu diesem Phänomen. Sie ist, getreu den Traditionen des 19. und 20. Jahrhunderts, "leistungsorientiert". Selbst Worte wie "Spiel" und "Erholung" verraten noch den Geruch der leistungsorientierten Fremdbestimmung.
Pädagogisch gesehen
Die eminente Bedeutung der bisherigen, mehr abstrakten Überlegungen wird sofort deutlich, wenn wir nun einen Sprung machen und einige praktische Probleme der Jugendarbeit beschreiben.
256
1. Die feste Mitgliedschaft oder wenigstens die regelmäßige Bindung eines Jugendlichen an eine Jugendgruppe oder an eine Institution der Jugendarbeit gilt immer noch weithin als undiskutierte Voraussetzung. Die Jugendverbände z. B. werden auf der Grundlage ihrer Mitgliederzahlen finanziert. Da die Jugendlichen in zunehmendem Maße diesem Ansinnen die Gefolgschaft verweigern, ist man in den letzten Jahren immer mehr zur sogenannten "offenen Arbeit" übergegangen. Man rechnet nur noch bedingt mit neuen Mitgliedern, dafür aber stärker mit mehr Kunden für die eigenen Programme und Veranstaltungen. Aber vielfach war das nur ein Trick, neue Mitglieder zu gewinnen. Man wollte nur nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Der pädagogische Erfolg schien erst dann erreicht, wenn ein Jugendlicher sich für längere Zeit an den Veranstalter gebunden hatte. Selbst die Heime der offenen Tür, die doch vor allem die unorganisierten Jugendlichen ansprechen wollen, sehen ihren pädagogischen Erfolg wesentlich darin, wie lange sich Jugendliche an sie wenden.
Diese Sicht ist zweifellos sehr einseitig. Es gibt nämlich immer nur eine kleine Schicht von Jugendlichen, die wirklich aktiv ist und in der Jugendarbeit Führungsqualitäten ausprobieren möchte. Wäre es anders, so könnten wir gar nicht so viel Positionen auftreiben, wie wir Führungswillige hätten, was zu permanenter Unzufriedenheit und Unruhe führen müßte. Es gehört aber nun einmal zum gesellschaftlichen Leben, daß es nicht nur begabte Veranstalter, sondern auch Zuhörer und Publikum gibt. Dies ist die Mehrzahl der Jugendlichen, die entweder interessante Geselligkeit wünschen oder sich für bestimmte "Stoffe" interessieren. Eine gut durchdachte Jugendarbeit muß ihre Aufmerksamkeit auf beide Gruppen richten. Den Minderheiten muß sie die Chance geben, ihre Führungsqualitäten in gut dosierten Belastungsproben zu schulen. Den anderen muß sie Gelegenheit geben, ihre Wünsche und Interessen so qualifiziert wie möglich zu befriedigen und damit auf eine höhere Ebene zu heben. "Geschlossene Arbeit" und "offene Arbeit" sind also keine Alternativen, sondern aufeinander verwiesen.
2. Damit hängt die zweite Voreingenommenheit zusammen, daß wir nämlich immer noch die feste Gruppe als die eigentliche Veranstaltungseinheit in der Jugendarbeit betrachten. Der einmal in der Woche stattfindende Heimabend gilt als die zentrale pädagogische Situation. Aber die feste Heimabendgruppe verschleißt viele begabte Führer mit sinnlosen Aktivitäten. Gerade die Klügeren erleben die kleine Gruppe als eine soziale Beschränktheit, weil sie sehen, daß sie für das heutige Leben weniger intime, als vielmehr distanzierte Sozialität lernen müssen. Gerade die begabteren Jugendlichen, auf die es ankäme, bleiben weg, weil sie deutlich spüren, daß sie hier "unterfordert" sind. Außerdem gerät das Programm, das eine Jugendgruppe aus eigenen Mitteln bestreiten kann, in eine immer hoffnungslosere Konkurrenz zu den übrigen Freizeitangeboten. Für uns war in den ersten Jahren nach dem Krieg der Heimabend unsere interessanteste oder jedenfalls eine sehr attraktive Freizeitbeschäftigung. Heute hingegen würde ich mir als Sechzehnjähriger vermutlich auch überlegen, ob ich statt zum Heimabend ins Kino, zum Fernsehen, ins Theater oder in die Volkshochschule ginge.
3. Dieser Konkurrenzdruck hat in der Jugendarbeit vielfach zu einer nervösen Einstellung zu den übrigen Freizeitangeboten geführt. Es besteht die Gefahr, die eigene Leistungsunfähigkeit und Unangepaßtheit auf das kommerzielle Freizeitsystem zu projizieren. Viele Einrichtungen beziehen ihr pädagogisches Selbstbewußtsein vor allem daraus, daß sie nicht so seien wie Kino, Boulevardpresse und Fernsehen. Das ist nicht nur deshalb töricht, weil die Jugendarbeit de facto selbst ein Teil des Freizeitsystem ist, sondern vor allem deshalb, weil sie damit gerade diejenigen Gegenstände verteufelt, die ihre interessantesten Programmpunkte sein könnten.
257
4. Damit sind wir bei der vielleicht schwierigsten Frage angelangt, nämlich der Frage nach den Inhalten der Jugendarbeit. Für die weltanschaulich oder politisch gebundenen Gruppen mag diese Schwierigkeit weniger deutlich sein. So scheinen sich etwa die Inhalte der kirchlichen Jugendarbeit zwangsläufig aus dem zu ergeben, was die Kirche als ihren Auftrag betrachtet. Aber da auch die kirchliche Jugendarbeit nicht nur aus religiösen, sondern auch z. B. aus geselligen Veranstaltungen besteht, stellen sich die Schwierigkeiten in der Praxis auch hier stärker als in der Theorie. Lassen sich z. B. gesellige Veranstaltungen direkt aus dem kirchlichen Auftrag ableiten, oder widersprechen sie ihm nur nicht? Da überall in der Jugendarbeit sich die Formen der Geselligkeit angenähert haben und man daran eine katholische von einer sozialistischen Jugendgruppe kaum noch unterscheiden kann, liegt die Vermutung nahe, daß Geselligkeit ein Phänomen ist, das unabhängig von theologischen Positionen existiert. Viel schwerer aber tun sich hier diejenigen Veranstalter, die sich nicht als religiös oder politisch gebunden betrachten. Sie versuchen nämlich, die schwierige Frage der Inhalte zugunsten der Formen auszuklammern. So ist es etwa kennzeichnend für eine bestimmte Version der deutschen Gruppenpädagogik, nicht von den Inhalten, sondern von den Gesprächsformen auszugehen.
Solche Vorstellungen gehen von der falschen Voraussetzung aus, daß man Erziehungsinhalte eigentlich nur im Rahmen einer bestimmten weltanschaulichen oder politischen Position entscheiden könne. Das trifft aber nur für bestimmte Erziehungsinhalte zu, keineswegs für alle. Überall nämlich, wo sachgerecht gearbeitet wird, bedarf es nicht unbedingt eines solchen Horizontes. Ganz offensichtlich gibt es in der gegenwärtigen Jugendarbeit eine deutliche Tendenz zur Bildungsarbeit. Bricht die "offene Arbeit" das bisherige Monopol der Heimabendgruppe, so die Bildungsarbeit das Monopol der sogenannten "jugendpflegerischen Inhalte". Darunter verstand man bisher vor allem alle Formen der musischen Bildung. Nun gibt es keine pädagogischen Inhalte mehr, die von nichtpädagogischen zu unterscheiden wären, sondern es kann alles Gegenstand der Jugendarbeit werden, was junge Leute interessiert. Und was sie interessiert, wird so sachgerecht wie möglich behandelt. Ziel ist nun z. B. nicht nur, sich über einen gemeinsam gesehenen Film auszusprechen, sondern ihn zu verstehen. Dazu muß man jetzt Leute gewinnen, die genügend vom Film wissen, und es genügt nicht mehr, daß ein Jugendleiter lediglich die technischen Regeln der Gruppenpädagogik beherrscht. Die meisten Jugendlichen, die sich heute für Jugendarbeit interessieren, wollen etwas sehr Handfestes dabei lernen. Sie verlangen dafür in immer stärkerem Maße Fachleute und weniger solche Erzieher, die außer ihrer guten Gesinnung und hilfreichen Zuwendung kein Sachgebiet haben, das sie wirklich beherrschen.
Auf diesen Wandel sind aber unsere Ausbildungsstätten noch kaum eingestellt. Sie sind vielleicht noch am meisten den alten Ideologien verhaftet. Ihre Absolventen haben zwar viele Fächer studiert, aber im Grunde verstehen sie trotzdem von nichts wirklich etwas. Eine Reform der zur Jugendarbeit hinführenden Ausbildungsstätten ist im Augenblick die vordringlichste Aufgabe für die Theorie und Praxis der Jugendarbeit.
258

39. Was ist Sozialpädagogik? (1965)
(In: deutsche jugend, H. 4/1965, S. 177-184)Kaum ein Begriff der gegenwärtigen pädagogischen Diskussion ist so schillernd und vieldeutig wie der der "Sozialpädagogik" Soll er aber in Zukunft wissenschaftlich verwendet werden, so muß er auf einen bestimmten begrenzten Gegenstand hin präzisiert werden können. Diesem Ziel diente in den letzten Jahren eine Reihe von Bemühungen. Und wie vielfältig und intensiv diese Bemühungen sind, das zeigt die Tatsache, daß vergangenes Jahr nahezu gleichzeitig drei Publikationen erschienen sind, die eine Ortsbestimmung der Sozialpädagogik versuchen:
Klaus Mollenhauer: Einführung in die Sozialpädagogik - Probleme und Begriffe". Verlag Julius Beltz, Weinheim 1964, 141 Seiten.
Helmut Rünger: Einführung in die Sozialpädagogik. Luthe--Verlag, Witten 1964, 176 Seiten.
Friedrich Schlieper: Sozialerziehung - Sozialpädagagik. Sinn der Sozialerziehung und Aufgaben der Sozialpädagogik. Quelle & Meyer Verlag, Heidelberg 1964, 42 Seiten.Im folgenden soll nun versucht werden, diese drei Veröffentlichungen daraufhin zu befragen, inwieweit es ihnen gelungen ist, den Begriff der Sozialpädagogik zu präzisieren oder neu zu bestimmen. Dabei wollen wir diese Arbeiten nun unter folgenden fünf Leitfragen überprüfen: 1.Wann und warum entstand Sozialpädagogik? 2. Hat sie es mit spezifischen Aufgaben zu tun, die sich hinreichend deutlich von denen anderer Erziehungsfelder abgrenzen lassen? 3. Hat sie es mit spezifischen Problemen zu tun, mit besonderen Schwierigkeiten, die vor allem in ihrem Feld auftauchen und dort bewältigt werden müssen? 4. Hat sie es mit spezifischen Methoden zu tun, die sich von denen anderer Erziehungsfelder, etwa der Schule, genügend unterscheiden lassen? 5. Vollzieht sie sich in spezifischen Insti-
177
tutionen, deren soziale Stellung, organisatorische Struktur und Zielsetzung sich von denen anderer Erziehungsinstitutionen unterscheiden lassen?
1. Wann und warum entstand Sozialpädagogik?
Daß das, was heute allgemein "Sozialpädagogik" genannt wird, um die Wende vom 18. zum 19.Jahrhundert entstanden ist, wird übereinstimmend vermerkt. Aber über die Gründe des Entstehens gehen die Meinungen in dem Maße auseinander, wie jeweils die Schwierigkeiten der Gegenwart in die Geschichte zurückverlegt werden. Rünger (S. 13) und Schlieper (S. 9) deuten sie aus der Reaktion gegen die individualistischen Tendenzen in der damaligen Pädagogik und treffen damit sicherlich das Selbstverständnis von Autoren wie Pestalozzi, Fichte, Schleiermacher und Diesterweg. Mollenhauer hingegen begnügt sich nicht mit der Feststellung dessen, was man damals über Sozialpädagogik gedacht hat, sondern überprüft diese Aussagen von unserem heutigen Wissen aus, also in ideologiekritischer Sicht.
Sozialpädagogik bezeichnet nach seiner Ansicht "denjenigen Bereich der Erziehungswirklichkeit, der im Zusammenhang der industriellen Entwicklung als ein System gesellschaftlicher Eingliederungshilfen notwendig geworden ist, sich erweitert und differenziert hat; Eingliederungshilfen, die gleichsam an den Konfliktstellen dieser Gesellschaft entstehen" (S. 12). Demnach handelt es sich also um eine geschichtlich einmalige und besondere pädagogische Antwort auf einen ebenso einmaligen und besonderen gesellschaftlichen Prozeß. Die Sozialpädagogik "sieht sich. . . dem Werden dieser Gesellschaft gegenübergestellt, das heißt konkret: den Schäden, die sie dem Menschen zufügt oder zuzufügen im Begriff scheint" (S. 21).
Denkt man diesen Ansatz konsequent zu Ende, so wäre Sozialpädagogik die Summe aller Maßnahmen, die planbar außerhalb der traditionellen Erziehungsfelder Familie und Schule stattfinden. Gegen eine solche historisierte Deutung wendet sich Schlieper. Er schreibt: "Das Ziel der Erziehung ist unwandelbar, ihre Aufgabe kann daher nicht aus den besonderen gesellschaftlichen Bedingungen abgeleitet werden. Sozialerziehung ist nicht nur eine Erziehungsaufgabe in besonderen Stadien der gesellschaftlichen Entwicklung, sondern ein Wesenszug der Erziehung überhaupt, weil die soziale Veranlagung zum Wesen des Menschen gehört und der Mensch sich immer in einer sozialen Situation befindet, in der er sich als sittlich handelnde Persönlichkeit bewähren muß" (S. 8). Schon hier wird deutlich, daß es zwischen Mollenhauer und Schlieper kaum eine Verständigungsmöglichkeit gibt. Für Schliepers naturrechtlich-anthropologischen Ansatz ist das, was Mollenhauer als geschichtliche Individuation für so bedeutsam hält, nichts anderes als das alte Thema des Verhältnisses von "Individuum und Gemeinschaft". Hat man einmal die Prinzipien dieses Verhältnisses durchschaut, dann sind die konkreten historisch-gesellschaftlichen Erscheinungen nur noch ein besonderes Feld ihrer Anwendung. Das soziale Leben ist dann nichts anderes als ein "Feld der sittlichen Bewährung" (S. 31). In dem Maße, wie die konkrete historische Entwicklung für das pädagogische Denken unverbindlich wird, gerät Schlieper dann auch folgerichtig in einen
178
fast scholastischen Begriffsautomatismus: "Sozialerziehung" als die pädagogische Praxis wird unterschieden von der "Sozialpädagogik" als einer erziehungswissenschaftlichen Teildisziplin, die jene Praxis wissenschaftlich untersuchen soll (S. 33). Als ob nicht das, was wissenschaftlich über eine Praxis gedacht wird, auch ein Moment ihrer selbst ist und umgekehrt! "Aufgabe der Sozialpädagogik ist", so schreibt Schlieper, "die Erforschung des gesamten Problemkreises "Erziehung und Gemeinschaft"' (S. 37). Die Sozialpädagogik wird dann systematisch aufgeteilt in eine "allgemeine" und eine "besondere", die beide wiederum in "historische", "angewandte", "theoretische", "empirisch-explikatische" und "normative" unterteilt werden. Es liegt auf der Hand, daß diesen Unterscheidungen gar keine unterscheidbaren Wirklichkeiten mehr entsprechen können. So heißt es zum Beispiel: "Die allgemeine Sozialpädagogik abstrahiert von den Besonderheiten der einzelnen Sozialgebilde und untersucht die allgemein gültigen Wechselwirkungen zwischen der Erziehung und dem Leben des Menschen als sozialem Wesen" (S. 36). Eine solche Reflexion ist von alters her eine Aufgabe der politischen Philosophie, aber es muß im Dunkel bleiben, wie man pädagogisch produktiv über die Sozialität des Menschen nachdenken kann, indem man von seinen konkreten Sozialverhältnissen völlig absieht.
Offensichtlich ist das Selbstverständnis der heutigen Sozialpädagogik nachdrücklich darauf angewiesen, die eigenen konkreten historischen Entstehungszusammenhänge so ernst wie irgend möglich zu nehmen. Das geschieht bei Rünger und Mollenhauer, wobei Rünger in Anlehnung an einen Aufsatz von Theodor Wilhelm ("Zum Begriff Sozialpädagogik", in: Zeitschrift für Pädagogik, 1961) die historische Betrachtung durch eine Unterscheidung der gegenwärtigen sozialpädagogischen Epoche von der "fürsorgerischen" Nohls und der "staatsbürgerlichen" Natorps weiter zu präzisieren trachtet. So sehr aber der historische Ansatzpunkt bei beiden im Grundsatz einleuchtet, so muß man andererseits doch fragen, ob der ehemals sicher richtige Unterschied zwischen gesellschaftlich statischen Erziehungsfeldern (Schule und Familie) und dem dynamischen Feld der Sozialpädagogik auch in der Gegenwart noch aufrecht erhalten werden kann. Könnte nicht sein, daß unter dem Stichwort Sozialpädagogik in einer bestimmten geschichtlichen Epoche wichtige Aufgaben der allgemeinen Erziehung angegangen worden sind, die aber heute in das allgemeine Erziehungsdenken eingegangen sind und daher keiner besonderen Betonung mehr bedürfen? Wenden wir uns zur weiteren Klärung dieser Frage den besonderen Aufgaben der Sozialpädagogik zu.
2. Die spezifischen Aufgaben
Wir sagten schon, daß für Schlieper Sozialpädagogik kein Teilbereich der Erziehungswirklichkeit ist, sondern eine Universitätsdisziplin: die Erforschung dessen, was Sozialerziehung im weitesten Sinne ist. Da aber Sozialerziehung nur ein Moment der umfassenden Fragestellung nach dem Verhältnis von Erziehung und Gemeinschaft ist, kann sie für sich genommen auch nur ein Teilbereich der sozialpädagogischen Forschung sein. Die Reichweite der Sozialpädagogik ist also wesent-
179
lich größer: "Forschungsgegenstand der Sozialpädagogik kann sein 1) der Erziehungsprozeß, der im Hinblick auf die positive und negative Beeinflussung durch soziale Gegebenheiten untersucht wird, 2) die Rückwirkungen der Erziehung auf das soziale Handeln des Menschen und damit auf die soziale Ordnung und 3) die sozialen Gegebenheiten im Hinblick auf ihre erziehliche Bedeutung" (S. 35).
Rünger beantwortet diese Frage, indem er aufzählt, in welchen praktischen Maßnahmen Sozialpädagogik stattfindet: vorbeugende Hilfen für Kind und Familie, Jugendgesundheitspflege, Jugendförderung, Jugendschutz, Jugendberufshilfe, Hilfe für schutzbedürftige Minderjährige und besondere erzieherische Einzelhilfen. Dabei fällt auf, daß diese Aufgabenbestimmung in keinem rechten Zusammenhang zu der voranstehenden historischen Erörterung steht, die etwas bloß Hinzugefügtes bleibt.
Bei Mollenhauer nun sind die "Aufgaben" gar kein Gliederungsprinzip seiner Arbeit mehr. Das ist einigermaßen verwunderlich. Denn nichts liegt ja zunächst näher, als einen besonderen Bereich der Praxis von ihren besonderen Aufgaben her zu bestimmen. Aber getreu seinem historischen Ansatz, daß Sozialpädagogik nicht in der Vermittlung gesellschaftlicher Traditionen, sondern im pädagogischen Aufgreifen gesellschaftlicher Konflikte angesiedelt sei, kann er auch die Aufgaben nicht näher bestimmen oder sie gar ein für allemal festlegen, sondern er muß sie jeweils aus dem gesellschaftlichen Prozeß selbst ablesen. Was gestern noch Aufgabe der Sozialpädagogik war, kann sich heute erledigt haben und morgen in neuer Variation wieder auftauchen. Damit ist zugleich auch gesagt, daß Pädagogik nicht mehr arbeitsteilig m dem Sinne verstanden werden kann, daß man in der Theorie und in der institutionalisierten Praxis isoliert voneinander arbeiten kann. Es geht Mollenhauer also letztlich gar nicht darum, einen deutlichen Trennungsstrich etwa zwischen Schule und Sozialpädagogik zu ziehen. Aber so einsichtig dieser Gedankengang ist, so wenig taugt er dazu, unsere Frage zu klären, was nun das Besondere der Sozialpädagogik sei.
3. Spezifische Probleme
Wenn man einen Sachzusammenhang von den Aufgaben her aufgliedert und systematisiert, dann`denkt man sich den Zusammenhang so, daß über diese Aufgaben selbst hinreichende Einigkeit bestehe und es fast nur ein technisches Problem sei, wem man welche davon zur Erledigung übergibt. Sowohl Schlieper wie Rünger vertrauen darauf, daß man sich auch heute noch über den gesamten pädagogischen Aufgabenkatalog weitgehend einig werden könne. Mollenhauer ist da weniger optimistisch. Deshalb ist sein Gliederungsprinzip nicht von den Aufgaben, sondern von den Problemen her bestimmt. Es ist interessant, daß von Problemen bei Schlieper und Rünger kaum die Rede ist. Natürlich würden auch sie sagen, daß es Aufgabe der Pädagogik sei, bestimmte Probleme zu lösen. Aber sie messen ihnen nicht so viel Bedeutung zu, daß sie sie zum Gliederungsprinzip ihrer Darstellung erheben würden. Genau das aber tut Mollenhauer, und genau das macht das Eigentümliche seines Buches aus. Wenn sich die Sozialpädagogik, wie Mollenhauer
180
meint, von Anfang an an den Konfliktstellen zwischen dem Heranwachsenden und der Gesellschaft eingenistet hat, dann hat sie ihren Ausgangspunkt von einem besonderen Problembewußtsein her genommen. Generation, Gesundheit, Gefährdung, Verwahrlosung, Grundbedürfnisse, Anpassung, Umlernen und Konflikte sind Kategorien, mit denen Mollenhauer diese Probleme beschreibt. Sie können aber schon deshalb nicht einfach arbeitsteilig einem bestimmten pädagogischen Bereich zur Aufgabe gemacht werden, weil sie in dem Augenblick, wo sie auftauchen, sowohl das kritisieren, was die Gesellschaft für "normal" hält, wie auch das, was die Erziehung für richtig hält. So erweisen diese Probleme die Annahme als irrig, daß Familie und Schule das "eigentliche" Reservat der Erziehung seien. Indem die Sozialpädagogik ferner "die objektiven Bedingungen der entstehenden Hilfsbedürftigkeit wie der Hilfe selbst" (S. 21) reflektiert, tritt sie der Gesellschaft auch als kritisches Potential gegenüber.
Aber es ist nicht nur eine Frage der äußeren Gliederung oder des Darstellungsstiles, ob man dieses pädagogische Feld von den Aufgaben oder von den Problemen her angeht. Rünger und Schlieper sind nämlich die hier angemessenen pädagogischen Zielsetzungen letztlich nicht zweifelhaft. Beide sind sie zutiefst einem kirchlich-christlichen Verständnis von Erziehung verbunden. Wer aber wie Mollenhauer Probleme zum Ausgangspunkt nimmt, der muß auf neuer Ebene sich letztlich doch zu den Zielvorstellungen äußern, zu denen die Probleme als solche ja nicht hinreichend Stellung nehmen. Ziel ist für ihn "das Bild des mündigen Menschen . . . Dieses Bild bleibt von einem großen Teil der ideologischen Differenzen im wesentlichen unberührt; in ihm deutet sich der . . . Konsensus aller gesellschaftlichen Gruppen im Hinblick auf die Richtung der Erziehung an" (S. 25). Hier scheint Mollenhauer am stärksten jener Tradition der Erziehungswissenschaft verbunden zu sein, die glaubte, mit dem Begriff der "Mündigkeit" und der "Selbstwerdung" die Pluralität der Erziehungsvorstellungen doch noch zu einer überzeugenden Einheit integrieren zu können. Selbst wenn verbal alle Gruppen der Gesellschaft hierin übereinstimmen würden, muß mehr als zweifelhaft bleiben, ob diese Übereinstimmung auch noch besteht, sobald jeder auf seine Weise diese Begriffe interpretiert hat. Es scheint mir kein Zufall zu sein, daß in den beiden anderen Arbeiten der Begriff der "Mündigkeit" so gut wie keine Rolle spielt. Und ganz gewiß würde Schlieper, der ja immerhin ein in der Praxis einflußreiches sozialpädagogisches Denken repräsentiert, entschieden widersprechen, wenn Mollenhauer sagt, in der Sozialpädagogik trete zurück: "in vorgegebene Ordnung sich einfügen, Autorität anerkennen, behütet und isoliert werden, gehorchen lernen, Vorbildern nacheifern" (S. 24). In dem Versuch, die politisch-ideologischen Partien der hier fälligen Auseinandersetzungen weitgehend auszuklammern, finden sich`Schlieper und Mollenhauer in überraschender Weise zusammen. Schlieper meint, es sei "gefährlich, die Zielsetzungen von Sozialerziehung und Politik bzw. Sozialpolitik nicht sauber auseinander zu halten" (S. 14). Aber während er ernsthaft glaubt, damit auch die Wirklichkeiten säuberlich trennen zu können, ist sich Mollenhauer über ihren unlösbaren Zusammenhang zu Recht im klaren. Doch auch er kann Mündigkeit nicht als Pädagoge, sondern nur als ein der aufklärerischen Tradition
181
verpflichteter und in ihr engagierter politischer Bürger fordern. Sein pädagogisches Engagement hat ein politisches zur Folge, das sich gegen bestimmte andere wenden muß und umgekehrt.
Im Sinne unserer eingangs gestellten Frage, was denn Sozialpädagogik sei, sind wir nun aber auch mit diesem Punkte nicht weitergekommen. Die von Mollenhauer hier erörterten Probleme und Aspekte der Sozialpädagogik sind - wenngleich in unterschiedlicher Intensität - heute auch in den anderen pädagogischen Feldern zu Hause.
4. Spezifische Methoden
Rünger spricht von den drei Methoden der Individual-, Gruppen- und Heilpädagogik, die für ihn aber Methoden aller modernen Pädagogik und nicht spezifisch für die Sozialpädagogik sind (S. 76ff.). Mollenhauer spricht nicht von Methoden, sondern von "Aspekten der sozialpädagogischen Tätigkeit" (S. 95 ff.) und nennt Fürsorge, Planung, Diagnose, Schutz, Pflege und Beratung. Er meint damit mehr, als man gemeinhin unter "Methode" versteht. Methode ist Weg zu einem Ziel, aber gerade im Feld der sozialen Arbeit sind Methoden und Ziele nicht mehr scharf zu trennen. Wie schon bei den "Aufgaben", so verläßt Mollenhauer bei den Methoden die herkömmliche Unterscheidung, die in der Tat seiner Betrachtungsweise im Wege stehen würde. Er glaubt, daß sich verschiedene Momente des einzelnen Erziehungsvorganges in einem bestimmten pädagogischen Bereich zu einem "Grundstil des jeweiligen Bereiches" (S. 97) zusammenfassen ließen: "So ließe sich ... der Grundstil der Familienerziehung durch die Begriffe Sorgen, Pflegen, Unterstützen, Gewöhnen, Einüben usw. charakterisieren; der Grundstil der Schulpädagogik durch die Begriffe Unterrichten, Überliefern, Einweisen, Einüben usw. Betrachtet man dagegen die Sozialpädagogik sowohl in ihrer Geschichte und ihren Institutionen wie auch in ihrer gegenwärtigen Praxis, dann scheint ihr Grundstil durch Momente der Erziehungstätigkeit charakterisiert werden zu können, deren wichtigste sich in den Begriffen Schützen, Pflegen und Beraten zusammenfassen lassen" (S. 97`f.). Daß aber auch auf diese Weise keine überzeugende Abgrenzung der sozialpädagogischen Tätigkeit von den übrigen zu erreichen ist, liegt auf der Hand.
5. Spezifische Institutionen
Am leichtesten wäre es vermutlich, von den sozialpädagogischen Institutionen her das Feld der Sozialpädagogik abzugrenzen. Darüber, daß sich die pädagogische Tätigkeit in solchen Institutionen - etwa gegenüber der Schule - durchaus absetzen läßt, dürfte Einigkeit bestehen. Merkwürdigerweise verzichten aber alle drei Autoren auf diesen so naheliegenden Ausgangspunkt. Rünger beschreibt sie zwar ausführlich, geht aber nicht der Frage nach, welche Folgen die institutionellen und organisatorischen Bedingungen für die pädagogische Praxis im einzelnen haben. Auch Mollenhauer verweist die Institutionen in den Anhang und setzt sie für seine Reflexionen kurzerhand voraus, indem er seine begrifflichen Analysen
182
weitgehend aus dem Selbstverständnis der Praxis entwickelt. Aber weder kritisiert er die pädagogische Funktionsfähigkeit der Institutionen, noch auch nimmt er sie als Bedingungen setzende Elemente der jeweiligen Erziehungswirklichkeit ernst. Das ist zweifellos auch eine Lücke seines historischen Ansatzes. Denn indem die ursprünglich kritischen Impulse der Sozialpädagogik institutionalisiert werden, werden sie zweifellos auch weitgehend entschärft. So stellen sich auch bei Mollenhauer die charakteristischen Mängel der sogenannten historisch-systematischen Methode ein: Der konkrete historische Prozeß, der sich nicht zuletzt im Charakter der Institutionen repräsentiert, bleibt letztlich doch "uneigentlich", wird zum Anschauungs- und Beweismaterial für die systematische Absicht. Damit bekommen dann aber auch die einzelnen Reflexionen ein scheinhaft revolutionäres Moment. Es scheint dann leicht so, als ob der kraftvolle Antritt der historischen Ausgangssituation im Prinzip weiterhin ungebrochen sei.
Das Resümee?
Wenn wir das Resümee aus dieser Betrachtung ziehen, so verdanken wir diesen drei Arbeiten wichtige Analysen für die gegenwärtigen Erziehungsprobleme im ganzen, aber doch keine überzeugende Antwort auf die Frage, was denn nun Sozialpädagogik sei. Indem wir die drei Arbeiten "über einen Kamm scherten", wurden wir ihnen allerdings auch nicht ganz gerecht. Schlieper geht es vor allem um eine begriffliche Abgrenzung zwischen "Sozialerziehung" und "Sozialpädagogik . Methodische Fragen und solche der Institutionen haben ihn dabei gar nicht interessiert. Rünger will weniger problematisieren, als vielmehr den Pädagogikstudenten eine brauchbare Einführung in die Praxis dessen geben, was sich heute Sozialpädagogik nennt. Lediglich Mollenhauer problematisiert in jeder Zeile. Aber das Ergebnis ist weniger eine neue Bestimmung dessen, was Theorie und Praxis der sozialen Arbeit heißen könnte, sondern viel eher eine umfangreiche Analyse der Frage, was das Aufkommen der industriellen Gesellschaft für die Pädagogik insgesamt bedeutet. In keiner pädagogischen Arbeit ist mir bisher eine so gründliche Kritik pädagogischer Begriffe, Kategorien und Leitvorstellungen von den Prinzipien der modernen Gesellschaft her begegnet. Dies macht den eigentlichen Wert des souverän geschriebenen Buches aus, das sich mit Recht "Einführung in das pädagogische Denken" nennen könnte.
Dennoch stellt sich die Frage, ob man den Begriff "Sozialpädagogik" weiterhin als Überschrift über die Erziehungs- und Bildungsmaßnahmen jenseits von Elternhaus und Schule beibehalten sollte. Gerade seine geschichtliche Herkunft sowie die Art und Weise seiner Verarbeitung in der pädagogischen Tradition machen ihn vielleicht ungeeignet dafür. Wenn solche Begriffe unscharf werden, so ist das niemals Zufall, sondern hat auch etwas mit der Sache zu tun. Wenn man von einem besonderen Bereich der pädagogischen Praxis die Brücke zur allgemeinen Pädagogik schlagen und zugleich die Besonderheiten herausarbeiten will, dann muß man die konkreten gesellschaftlichen Zusammenhänge so ernst wie irgend möglich nehmen. Es könnte nämlich sein, daß heute sozialer Druck und gesellschaftlicher Konformis-
183
mus im Bereich der Jugendsozialarbeit viel stärker wirksam sind als in den Schulen, die sich dagegen durch ihr betont intellektuelles Selbstverständnis viel eher zur Wehr setzen können. Gerade die Fürsorge wird heute durch gesellschaftliche Organisationen und Verwaltungen nahezu unausweichlich umklammert, und es muß zweifelhaft erscheinen, ob es überhaupt sinnvoll ist, in ihren Merkmalen so verschiedene Bereiche wie Jugendpflege und Jugendfürsorge unter einem Begriff - dem der "Sozialpädagogik" - zusammenzufassen. Hinzu kommt die soziale Isolation der sozialpädagogischen Tätigkeit. Es fehlt dieser Praxis meist das "Kollegium", das der einzelnen Tätigkeit Selbstvertrauen und Korrektur gewähren könnte. Sehr im Unterschied zu den großen Lehrerverbänden kann man hier kaum das eigene pädagogische Selbstverständnis gegenüber der Öffentlichkeit begründen und gegenüber den Verwaltungen zur Not auch durchsetzen, ganz abgesehen davon, daß die hier vorhandene Fachausbildung - wiederum sehr im Unterschied zur Lehrerschaft - den Verwaltungen meist nicht den geringsten Respekt abnötigt. Solche vielfältigen soziologischen, sozialen und psychologischen Bedingungen bestimmen das Selbstverständnis der heutigen sozialpädagogischen Praxis sicher mehr als das Bewußtsein des historischen Ansatzpunktes. Mollenhauer tut sicher recht daran, diese Ausgangspunkte wieder mit Nachdruck zum Bewußtsein zu bringen. Aber der zweite Schritt, die konkrete pädagogische Kritik der konkreten Bedingungen der sozialpädagogischen Praxis, bleibt noch zu leisten. Von den drei Autoren wäre Mollenhauer von seinem Ansatz her am ehesten dazu in der Lage.
Im übrigen aber zeigt sich gerade im Falle der Sozialpädagogik wieder, daß ein einzelner Bereich der pädagogischen Praxis nur dann überzeugend bestimmt werden kann, wenn man eine Theorie vom Zusammenhang aller pädagogisch wirksamen sozialen Felder - vom Elternhaus bis zu den Massenmedien - entwickelt und sie aufeinander bezieht. Nur so können heute wohl noch ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten hinreichend genau in den Blick treten.
184

40. Sinn und Standpunkt der Jugendarbeit heute (1965)
(In: Jugendpflege in Hessen, o. O.,o. J. (1965), S. 10-14)Was wir heute "Jugendarbeit" nennen, ist eine erstaunliche Vielfalt von Formen, Inhalten und Maßnahmen. Es ist kaum möglich, sie aufzuzählen und in einem Zusammenhang zu beschreiben. Um dies einigermaßen angemessen zu tun, müßte man ständig den Blickpunkt wechseln und in immer neuen Ansätzen die Wirklichkeit der Jugendarbeit ausleuchten. Die Vielfalt der Formen geht vor allem darauf zurück, daß Jede Form und Jede Maßnahme, die wir heute noch vorfinden, zu einem bestimmten, geschichtlichen Zeitpunkt entstand und damals eine Antwort auf ganz bestimmte Probleme und Schwierigkeiten war. Ebenso kann man die heute vorhandenen Vorstellungen über Aufgabe und Ziel der Jugendarbeit in eine solche geschichtliche Reihenfolge bringen. Wer heute zum Beispiel von der "lntegration" in die gesellschaftlichen Verantwortlichkeiten als Hauptaufgabe der Jugendarbeit spricht - wie die meisten Jugendverbände -, orientiert sich wahrscheinlich an der Entstehungssituation der öffentlichen Jugendpflege oder auch der Arbeiterjugend. Wer "jugendgemäß" sagt, erinnert sich meist an die eigene Jugendzeit, in der er vielleicht die Entstehung der bündischen Jugend miterlebte. Und wer mit Worten wie "Jugendhilfe" und "Jugendnot" die pädagogischen Aufgaben beschreibt und die Wichtigkeit der "Erzieherpersönlichkeit" unterstreicht, versteht sich vermutlich innerhalb der langen Tradition der Fürsorge und der Arbeit mit sozial gefährdeten Jugendlichen.
Diese Beispiele müssen zur Andeutung des Gemeinten genügen. Sie sollen zeigen, daß wir heute in der Jugendarbeit zahlreiche Formen und Vorstellungen vorfinden, die deshalb nicht recht miteinander in Einklang zu bringen sind, weil sie ganz verschiedene Ursprünge haben. Dies führt auch zu vielen Mißverständnissen in der heutigen Diskussion. Eine brauchbare "Geschichte der Jugendarbeit" ist leider noch nicht geschrieben.
Nun können wir nicht einfach bei dieser Tatsache stehenbleiben. Sie erklärt zwar vieles, aber sie bringt unsere Überlegungen für die Zukunft allein nicht weiter. Die große Gefahr dabei ist, daß man die geschichtliche Entwicklung einfach als eine bloße Reihenfolge von Formen und Vorstellungen versteht, wo die eine überflüssig und "unmodern" wird, sobald die jeweils neue auf den Plan tritt. Das ist eine
10
zutiefst ungeschichtliche Vorstellung, die zu erheblichen Irrtümern führt. So ist etwa die Vorstellung, Jugendarbeit solle Junge Menschen in die gesellschaftliche Wirklichkeit " integrieren ", keineswegs "moderner" als die gegenteilige der bündischen Jugend, sondern sie ist sehr viel älter. Vermutlich wird man bei genauerem Nachsehen feststellen, daß jede geschichtliche Ausprägung der Jugendarbeit auch heute noch ein Moment an Wahrheit und Vernünftigkeit hat, das bewahrt werden sollte.
Damit mögen die historischen Überlegungen auf sich beruhen bleiben. Meine Überzeugung ist, daß man über den Sinn und Standpunkt der Jugendarbeit noch in einem weiteren Sinne nachdenken muß. Der Blick muß sich richten auf den Gesamtzusammenhang von Erziehung und Gesellschaft. Wenn wir uns einmal vorstellen, welche Kräfte und Mächte an der Erziehung und Bildung der Jungen Generation heute beteiligt sind, dann kommen wir zu einer stattlichen Liste: Familie, Schule, Arbeitsplatz, Film, Fernsehen, Jugendgruppe, Freundeskreis und schließlich das ganze System der Angebote in der Freizeit. Erziehung und Bildung ist also ein ungemein komplizierter Vorgang geworden, und er wird noch komplizierter dadurch, daß die eben genannten Machte noch vielfach zu unterteilen wären. Nun ziehen diese Kräfte keineswegs alle am gleichen Strang, sondern ihre Einflüsse widersprechen sich auch oder heben sich gegenseitig auf. Gerade deswegen sehen wir die Massenmedien in unserer Arbeit mit Skepsis, und auch die Schule ist ja sehr viel mehr und anderes als die bloße Fortsetzung der Erziehungsvorstellungen der Eltern. Zwei von diesen Wirkkräften sind "pädagogische Felder" in dem engeren Sinne, daß sie weitgehend nach pädagogischen Intentionen und Motiven gestaltet werden Können: die Schule und die Jugendarbeit. Die übrigen Felder unterliegen dagegen stärker den Marktgesetzen des Austausches und dem Mechanismus von Angebot und Nachtrage. Man kann sich also den Gesamtzusammenhang von Erziehung heute nur noch klarmachen, wenn man - in Anlehnung an kybernetische Denkmodelle - die beiden "pädagogischen" Felder zu den anderen ins Verhältnis der "Rückkopplung versetzt. Von der Praxis der Schule und Jugendarbeit aus kann der gesamte Prozeß der Erziehung und Bildung - also auch der Einfluß der anderen Faktoren - wieder Ins Bewußtsein gehoben werden. Demnach kommen der Schule und der Jugendarbeit zwei grundsätzliche Aufgaben zu. Sie decken die "Defizite", die von den anderen übrig gelassen werden. Zugleich aber melden sie solche Defizite an die Gesellschaft zurück, indem sie gesellschaftliche Verhältnisse im Namen des wünschenswerten Gesamtbildes von Erziehung und Bildung kritisieren. JWenn also zum Beispiel sich im pädagogischen Umgang mit jungen Arbeitern herausstellt, daß ihr Sprachschatz so umfangreich ist wie der der Bildzeitung, dann muß diese Erfahrung mit Nachdruck an die Gesellschaft zurückgemeldet werden, indem zugleich die konkreten Gründe für diese Tatsache mitgeteilt werden. (In diesem Falle etwa die zu kurze Schulzeit und die zu frühe Absorbierung der Lernenergien im Arbeitsprozeß usw.) Eine pädagogische Praxis, die sich nicht immer auch In dieser Weise gesellschaftskritisch versteht, erfüllt Ihre Aufgabe der "Rückmeldung" nicht.
Diese These hat unmittelbar praktische Konsequenzen. Wir haben in der Schule wie in der Jugendarbeit immer noch die Vorstellung, man müsse "das Ganze" der jugendlichen Bildung und Erziehung - von der Gewissensbildung bis zum Erlernen sozialer Techniken - sich zunächst einmal ausdenken, um dann alles in jedem Erziehungsfeld auch zu verwirklichen. In diesem Sinne ist es gewiß richtig, daß der junge Mensch auch In die hier und heute vorhandene politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Wirklichkeit "eingeübt" werden müsse ("lntegration"), aber es folgt daraus keineswegs zwingend, daß dies nun die besondere Aufgabe der Jugendarbeit sei; denn die "Vergesellschaftung" durch den Arbeitsplatz, die Massenmedien und das Freizeitsystem erfüllen diese Aufgabe nicht nur besser, sondern auch so, daß man die Übermächtigkeit dieser lautlosen Erziehung nicht nur den jungen Menschen bewußt machen, sondern sie auch wieder kritisch davon distanzieren muß.
Bis jetzt haben wir Schule und Jugendarbeit zusammen den anderen erziehenden Faktoren der Gesellschaft gegenübergestellt. Aber es leuchtet schon auf den ersten Blick ein, daß sie nicht die gleiche Aufgabe und die gleichen Mittel zu ihrer Lösung haben. Das wäre einfach unwirtschaftlich. Dann würde es genügen, die Schule zu verbessern und die Jugend-
11
arbeit abzuschaffen. Vielmehr besteht zwischen der Schule als der voll institutionalisierten Erziehungsform unserer Gesellschaft und den Formen der Jugendarbeit wiederum ein Verhältnis der Rückmeldung. So geben sich etwa junge Leute in den Experimentierfeldern der Jugendarbeit oft ganz anders als in den Schulen. Würde man also die schulische Erfahrung mit jungen Leuten als die einzig pädagogische ansehen, so müßte das zu einem sehr einseitigen Bild führen. Ich erinnere in diesem Zusammenhang nur an Helmut Kentlers Buch "Jugendarbeit in der Industriewelt". Es würde hier zu weit führen, die Unterschiede im einzelnen zu beschreiben. Aber so viel sei grundsätzlich gesagt: Es ist ein großer Mangel der gegenwärtigen Diskussion über "Bildungsplanung" und "Bildungsreform", daß sie sich nahezu ausschließlich am pädagogischen Feld der Schule orientiert und damit zum Ausdruck bringt, daß sie keine angemessene Vorstellung vom heute notwendigen Gesamtbewußtsein über das Verhältnis von Erziehung und Gesellschaft hat. Auf diese Weise erhält die außerschulische Jugendarbeit den Charakter der "Ergänzung", des "Uneigentlichen", und dies stimmt durchaus mit dem Ansehen überein, das sie in der öffentlichen Meinung genießt. Ihr Handicap ist, daß sie allerdings zum Problem der besseren Berufsausbildung und der höheren Abiturientenzahlen unmittelbar wenig beitragen kann. Ihre Aufgabe liegt gerade umgekehrt in der Ausfüllung der Lücken, die die zunehmende Ökonomisierung und Technisierung des öffentlichen Schulwesens für die Jugendphase hinterläßt. Sie vergeudet Zeit, was sonst als unrentabel gilt; sie vergibt keine Zeugnisse, mit denen man beruflich weiterkommen könnte; sie orientiert sich nicht an Lehrplänen, die von äußeren Leistungs- und Verhaltenserwartungen her konzipiert sind. So wie die Tätigkeit der Hausfrau in der Familie ein ständiger Widerspruch zum ökonomischen Gesamtsystem ist, insofern ihre Leistung "unmeßbar" bleibt, so sind in der Jugendarbeit alle jene Maßstäbe zu Hause, die seit langem Bestand pädagogischer Erfahrung sind, heute aber im Widerspruch zur technisch-ökonomischen Ideologie der`Gesellschaft stehen: daß man zum Lernen Zeit vertrödeln muß; daß Gedanken "ausruhen können müssen" (Herbart); Jdaß viele Umwege nötig sind, bis man entdeckt, was einen interessiert und wozu`man taugt; daß auch das Ich und nicht nur die Sachen und äußeren Ansprüche im Mittelpunkt des Nachdenkens stehen müssen usw.
Nimmt man zu diesen Überlegungen noch hinzu, daß Jugendarbeit heute in der freien Zeit stattfindet, so kann man innerhalb der oben genannten Erziehungsfaktoren ihr vor allem folgende Aufgaben stellen, die ihre Schwerpunkte ausmachen könnten. Sie lassen sich am besten innerhalb der jüngsten Tendenzen zur "offenen Arbeit" und zur "Bildungsarbeit" beschreiben.
Die Tendenz zur "offenen Arbeit"
Die soziale Grundform der überlieferten Jugendarbeit ist die kleine, geschlossene Gruppe. Der Jugendliche, der sich für die Angebote der Jugendarbeit interessierte, wurde bisher angehalten, einer festen Jugendgruppe beizutreten und regelmäßig an ihren Programmen teilzunehmen. Dieses Modell stammt aus der Jugendbewegung. Damals schlossen sich Junge Menschen zu Gruppen zusammen, führten gemeinsame Programme durch und verbrachten überhaupt die ihnen zur Verfügung stehende freie Zeit möglichst gemeinsam. Diese Gruppen waren "autark", d. h. sie benötigten kaum organisatorische und finanzielle Unterstützung von außen. Aber schon mit dem Entstehen großer überregionaler Jugendverbände wandelten sich die Motive. Zudem erkannte man, welche Möglichkeit zur Kontrolle und sogar zur Indoktrination die kleine, stetige Jugendgruppe enthielt, wenn man sie nur in möglichst großer Zahl einer funktionierenden Organisation einverleibte. Es ist kein Zufall, daß antidemokratische Jugendorganisationen bis auf den heutigen Tag diese Chance erkennen und entschlossen nutzen.
Viele Motive und Traditionen spielten eine Rolle, als man auch nach 1945 ganz selbstverständlich von der stetigen "Heimabendgruppe" als Grundform der Jugendarbeit ausging. Interessanterweise verstanden auch die "Heime der Offenen Tür" - im Widerspruch zu ihrem Namen - die "offene Arbeit" mit unorganisierten Jugendlichen und labilen "Gruppen auf Zeit" zunächst lediglich als einen Vorhof zur "eigentlichen" Arbeit, die erst dann erreicht schien, wenn der Jugendliche sich in einer festen Gruppe auf längere Zeit gebunden hatte. Noch In den sogenannten "Gau-
12
tinger Beschlüssen" kann man diese Einstellung nachlesen.
Die Beliebtheit der festen, geschlossenen Arbeit bei den Jugendlichen zerbrach in den letzten Jahren an einer einfachen, elementaren gesellschaftlichen Tatsache: an der Entwicklung und Differenzierung des Freizeitsystems, also der Angebote, auf die man in seiner freien Zeit zurückgreifen konnte. So interessant wie das, was sich in der lokalen Umgebung, Im Fernsehen oder im Kino zur Zeit des Heimabends abspielte, konnte der Heimabend selber selten sein. Die kleine Gruppe wurde zunehmend als eine Beschränkung im Vergleich zu den anderen Freizeitmöglichkeiten erlebt.
Die kleine Gruppe, in der man sich immer wieder trifft, ist zwar nach wie vor noch sehr beliebt bei Jugendlichen, insofern man unter Gleichaltrigen ist und sich über private Sorgen, Probleme und Wünsche aussprechen kann, aber man begann zu spüren, daß die intime Solidarität innerhalb der eigenen Gruppe als Erfahrung für die in der Erwachsenengesellschaft verlangte Sozialität nicht ausreichte. Es ist ein großer Unterschied, ob man einen Tanzabend veranstaltet, wo sich jeder kennt, oder ob man zum Tanz in ein Jugendkaffee geht, wo man mit nicht-bekannten Partnern des anderen Geschlechts "gesellschaftlich verkehren" muß. Die eine Erfahrung ersetzt die andere nicht. Und in demselben Maße, wie durch Kleidung und Kosmetik eine distanzierende Verhaltenserwartung in der Öffentlichkeit sich einstellte und es nicht mehr ausreichte, sich mit naiv-unfertiger Jugendlichkeit alten Stils in Restaurants zu bewegen, wurde die stetige Gruppe als nicht ausreichend für das heute notwendige gesellschaftliche Lernen erlebt. Nicht-ntime Sozialität kann man aber nur in nicht-lntimen Sozialsituationen lernen.
Damit ist aber nun die kleine Gruppe keineswegs überflüssig geworden, sie hat vielmehr einen neuen Sinn bekommen, über den noch zu sprechen sein wird. Der Trend zur "offenen Arbeit" markiert also die Versuche, den Absolutheitsanspruch der kleinen, stetigen Jugendgruppe zu brechen. Das kann im einzelnen vieles heißen. Es kann sein, daß eine Heimabendgruppe nun ihr Programm stärker aus dem Angebot der lokalen Umgebung einschließlich des Fernsehens bestreitet und sich selbst viel stärker als Diskussionsforum der von außen empfangenen Eindrücke versteht; es kann sein, daß "Gruppen auf Zeit" für ganz bestimmte sachliche Vorhaben eingerichtet werden, die sich wieder auflösen, sobald das Vorhaben erledigt Ist. Oder ein Jugendverband richtet seine Angebote von vornherein auf einen größeren Kreis interessierter Jugendlicher, von denen er zwar Teilnahme am Programm, aber nicht auch im selben Maße Mitgliedschaft im Verband erwartet.
Die Tendenz zur "Bildungsarbeit"
Eng mit der Entwicklung zur "offenen Arbeit" ist die Entwicklung zur "Bildungsarbeit" verbunden. Bricht die "offene Arbeit" das bisherige Monopol der Heimabendgruppe, so die moderne "Bildungsarbeit" das Monopol der sogenannten "Jugendpflegerischen Inhalte". Darunter verstand man bisher vor allem alle Formen der musischen Bildung. Nun gibt es keine "pädagogischen" Inhalte mehr, die von "nicht-pädagogischen" zu unterscheiden wären, sondern es kann alles Gegenstand der Jugendarbeit werden, was junge Leute interessiert. Und was sie interessiert, wird so "sachgerecht" wie möglich behandelt. Ziel ist nun zum Beispiel nicht nur, sich über einen gemeinsam gesehenen Film "auszusprechen", sondern ihn zu verstehen. Dazu muß man jetzt Leute gewinnen, die etwas vom Film wissen, und es genügt nicht mehr, daß ein Jugendleiter lediglich die technischen Regeln der Gruppenpädagogik beherrscht. Politische Bildung wird nun nicht mehr nur so betrieben, daß in der Gruppe möglichst jeder zu Wort kommt und seine Meinung gleich wichtig wird wie alle anderen, sondern so, daß das zur Debatte stehende Problem möglichst angemessen verstanden wird.
Dabei ist die Gefahr sehr groß, daß einfach die schulischen Formen der Bildungsarbeit kopiert werden: Man hat ein Thema, das man logisch in einzelne Abschnitte gliedert und mit Hilfe von Referenten "lehrgangsgemäß" der Reihe nach behandelt. Die besondere Chance der Jugendarbeit liegt aber darin, daß sie von Problemen ausgehen kann, von offenen Fragen, die ihre eigentümliche Gliederung haben. Wenn eine Gruppe zum Beispiel über "Freizeit" diskutieren möchte, weil sie über ihr eigenes Freizeittun nachdenken möchte, das ihr "problematisch" erscheint, dann hat es wenig Sinn, gleich einen Refe-
13
renten zu holen, der ein hervorragendes Referat über die ökonomischen Seiten des Freizeitproblems hält. Das kann allenfalls am Ende eines Gruppenprozesses stehen, wenn die Gruppe hinreichend begriffen hat, warum sie eigentlich an diesem Thema interessiert ist. Und hier wird jetzt wieder die kleine, intime Gruppe wichtig. Denn sie ist der rechte Ort sozialer Vertrautheit, der es gestattet, gerade die persönlichen Aspekte des objektiven Problems hinreichend offen mit anderen zu besprechen. Junge Leute sind also zunächst an persönlichen Problemen und Schwierigkeiten interessiert und weniger an der Logik einer Sache. Daß beides eng miteinander zusammenhängt, ist für Jugendliche, die nicht schon in strenger Sachlichkeit geschult sind, keineswegs von vornherein klar und kann daher auch nicht am Anfang eines Vorhabens in der Jugendarbeit stehen, sondern allenfalls am Schluß, wenn das Interesse dafür weit genug trägt.
Gerade der "Durchbruch der Schallmauer" im Hinblick auf die Sozialformen und die Inhalte der Jugendarbeit hat die verwirrende Vielfalt dessen hervorgebracht, was wir heute unter dem Stichwort "Jugendarbeit" zusammenfassen. Nichts wäre schlimmer, als diese Vielfalt nun wieder zu vereinheitlichen. In Zukunft kann die Jugendarbeit ein pädagogisches Experimentierfeld großen Stils werden, in dem nicht nur neue Formen der pädagogischen Arbeit, sondern auch Meinungen und Verhaltensweisen junger Leute ausprobiert werden können. Damit aber tauchen ganz neue und schwerwiegende Probleme auf. Sie beginnen bei der Frage, was nach welchen Maßstäben in Zukunft von der öffentlichen Hand finanziert werden kann und soll. Gibt es überhaupt eine befriedigende Möglichkeit, eine solche Vielfalt in den auf möglichst kleinen Ermessensspielraum durchkonstruierten Verwaltungszusammenhang einzubauen? Wird es möglich sein, den pädagogischen Instanzen soviel - auch finanziellen - Entscheidungsspielraum zu lassen, wie sie für den improvisatorischen Charakter ihrer Arbeit benötigen? Wird es ferner möglich sein, die bisher immer noch auf Kleingruppen und "jugendpflegerische Inhalte" ausgerichtete Aus- und Fortbildung der jugendpflegerischen Kräfte entsprechend zu reformieren? Wie soll das geschehen, wenn alles unter bestimmten Voraussetzungen Gegenstand der Jugendarbeit sein kann? Kann man die Vielfalt zu einigen wenigen "Fächern" zusammenfassen, so daß sie lehrbar wird? Wird nicht die "Fortbildung" der Mitarbeiter ganz neue Bedeutung gewinnen, neuer Formen, Inhalte und Institutionen bedürfen, von denen wir noch kaum eine Vorstellung haben?
In den letzten Jahren ist die Praxis der Jugendarbeit ihrer Theorie davongelaufen. Wir müssen sie mit neuen, angemessenen Vorstellungen schnellstens wieder einholen, damit wir nicht das interessanteste pädagogische Feld verlieren, das wir heute noch haben.
14

41. Carlo Schmidt/Erich Ollenhauer (1965)
(In: Neue Politische Literatur, H. 2/1965, S. 218-219)Carlo Schmid: Tätiger Geist. Gestalten aus Geschichte und Politik. 214 S., Verlag J. H. W. Dietz Nachf. GmbH., Hannover 1964.
Erich Ollenhauer: Reden und Aufsätze, hrsg. von Fritz Sänger. 357 S., Verlag J. H. W. Dietz Nachf. GmbH., Hannover 1964.Der Band von Carlo Schmid enthält neun Essays, von denen zwei bisher unveröffentlicht waren. Es sind, wie der Verf. im Vorwort selbst vermerkt, Gelegenheitsarbeiten, die ursprünglich nicht für eine Buchpublikation gedacht waren. Sie gelten historischen Gestalten, die im weitesten Sinne des Wortes politische Denker und Täter waren und denen der Verf. sich offensichtlich im Sinne eines politischen Bekenntnisses verpflichtet weiß. Machiavelli, Rousseau, Heine, Lorenz von Stein, Lassalle, Henri Dunant, Ludwig Frank, Wilson und Kurt Schumacher werden uns nicht im Stile eines biographischen Abrisses, sondern so vorgestellt, daß die Wirkungen und das für die Gegenwart Bedeutsame in den Blick treten.
Es ist weder möglich, die einzelnen Arbeiten im eigentlichen Sinne zu "besprechen" - man könnte allenfalls betonen, daß man hier und dort anderer Meinung sei - noch auch, das eine oder andere hervorzuheben; denn auch dort, wo man die paraphrasierten Autoren gut zu kennen glaubt, präsentiert Sch. immer wieder neue und unvermutete Aspekte. Vor allem: die Lektüre ist von der ersten bis zur letzten Seite ein ästhetischer Genuß! Man sollte diese Essays sowohl im Deutschunterricht wie in der Gemeinschaftskunde unserer Gymnasien lesen.
Auf den ersten Blick scheinen die Texte von Erich Ollenhauer weder inhaltlich noch sprachlich den Vergleich mit Carlo Schmid auszuhalten. Aber das liegt nur daran, daß sie aus einem anderen Zusammenhang stammen, aus dem Zusammenhang des politischen Kampf-Alltags, wo es nicht um Geschichtsmächtigkeit, sondern um die Banalität unmittelbarer Bedürfnisse, nicht um Ästhetik, sondern um Wirkung geht. Man hat Ollenhauer einen Mann genannt, der den Begriff des "Funktionärs" durch seine persönliche Integrität zu einem positiven Leitbild des politischen Führungsstils gemacht habe. In diesem guten Sinne sprach er auch die Sprache des
218
Funktionärs. Wie alle Arbeiterführer seiner Generation suchte er die Vermächtnisse der Humanität in den Alltag politischen Handelns zu übersetzen. Das sozialistische Sprachpathos der Zwanziger Jahre mag uns heute merkwürdig berühren, aber damals ging es darum, den hochfliegenden Enthusiasmus der jungen Generation auf unmittelbar einsichtige und vernünftige Ziele zu lenken: darauf, wie Menschen wirklich leben und wie sie leben könnten. Ob O. 1924 für politischen Anstand eintrat und dafür, sich die Mittel des politischen Kampfes nicht von der Rechten diktieren zu lassen, oder ob er 1933 nach Hitlers Machtergreifung dem neuen Regime ohne eine Spur von Haß den Kampf ansagte - er wußte, daß schlechte Mittel auch die Ziele korrumpieren.
Fritz Sänger hat die Texte zum Gedenkband für den Verstorbenen zusammengestellt. Er hat darauf verzichtet, aus der Zeit nach 1945 das aufzunehmen, was in die Aktualität des politischen Kampfes führen müßte. Das ist verständlich und zu diesem Zeitpunkt wohl auch voll berechtigt. So sind die Texte aus der Zeit von 1920 bis 1963 zum Teil erheblich gekürzt und ergeben naturgemäß auch nur ein unvollständiges Bild des SPD-Politikers. Es ist dringend zu hoffen, daß das im Vorwort gegebene Versprechen bald eingelöst wird, O.s Arbeiten vollständig zu publizieren. Eine solche vollständige und kritische Edition könnte für die zeitgeschichtliche Forschung von unschätzbarem Nutzen sein.
219

42. Tourismus als neues Problem der Erziehungswissenschaft (1965)
(In: H. Hahn (Hrsg.): Jugendtourismus. Beiträge zur Diskussion über Jugenderholung und Jugendreisen. München 1965, S. 103-122)Im Zusammenhang mit "Jugendreisen" und "Jugendtourismus" ist allenthalben von pädagogischen Problemen die Rede. Pädagogische Termini werden gebraucht und pädagogische Zielsetzungen erörtert. Deshalb muß gefragt werden, ob es in unserer Erziehungswissenschaft überhaupt einen Ort für dieses Phänomen "Tourismus" gibt. So selbstverständlich, wie das auf den ersten Blick scheinen mag, ist das gar nicht. Zwar ließe sich eine lange "Ahnenreihe" pädagogischer Klassiker anführen, die sich - meist zustimmend - zum Reisen geäußert haben. Aber er{tens haben solche Äußerungen einen bestimmten Ort im Gesamtzusammenhang ihres pädagogischen Denkens und können deshalb nicht einfach daraus isoliert werden, und zweitens haben sie sich dabei nicht mit dem Phänomen des modernen Tourismus beschäftigt, sondern mit solchen Formen des Reisens, die ihnen bekannt waren.
Werfen wir einen Blick auf pädagogische Äußerungen zum Reisen in diesem Jahrhundert, so stellen wir fest, daß zwei Formen dabei die Aufmerksamkeit der Pädagogen gefunden haben, die heute zweifellos nur noch Randformen des Tourismus sind: die pädagogisch motivierte Schulreise des Lehrers mit seiner Klasse und die touristische Form des Wanderns. Die Beachtung des Wanderns ist dabei vor allem auf den Einfluß der Jugendbewegung zurückzuführen. Beide Formen waren und sind pädagogisch geplante Unternehmen. Insofern ist es verständlich, daß sie bisher das ausschließliche Interesse der Erziehungswissenschaft gefunden haben. Das liegt daran, daß die Pädagogik zumeist als ihren Gegenstand die "Erziehungswirklichkeit" ansieht, womit sie fast immer solche Felder meint, die vorwiegend durch pädagogisch motivierte Handlungsreihen und Absichten zustande kommen. Aber gerade das Wandern macht hier schon die Ausnahme. In neueren pädagogischen Stellungnahmen erscheint es an sich - also durchaus auch außerhalb der pädagogischen Felder - als pädagogisch wünschenswert: eine Meinung, die nur auf einem bestimmten kulturkritischen Hintergrund verständlich wird.
Sieht man von einer Fülle von Einzelüberlegungen und Berichten ab, die sich um das Jugendherbergswerk, die Fahrten der Jugendgruppen und die Schulreisen einschließlich der Schullandheimaufenthalte grup-
103
pieren, so kann man die nach 1945 erschienene grundsätzliche pädagogische Literatur zum Thema verhältnismäßig schnell anführen. Hermann Röhrs verdanken wir eine subtile Meditation, aus der sich möglicherweise Hypothesen für Einzelforschungen ableiten lassen ("Vom Sinn des Reisens", in: Die Sammlung, 1955). Wolfgang Brezinka ("Erziehung durch das Wandern", in: Die Sammlung, 1957) und Arnold Stenzel ("Die anthropologische Funktion des Wanderns und ihre pädagogische Bedeutung", in: Erziehung und Leben, Heidelberg 1960) haben der touristischen Sonderform des Wanderns wichtige anthropologische und pädagogische Einsichten entnommen.
In den letzten beiden Arbeiten ist unter dem Stichwort "Wandern" von einem Phänomen die Rede, das zunächst einmal unabhängig von pädagogischen Intentionen besteht, dem aber gleichwohl pädagogische Implikationen zuerkannt werden. Man könnte sagen, Wandern sei ein Moment der "funktionalen Erziehung", wenn dieser Begriff nicht arg belastet und mißverständlich wäre. Jedenfalls gilt sowohl Brezinka wie Stenzel das Wandern als ein Tun, das, obwohl nicht pädagogisch hergestellt, gleichwohl als pädagogisch zu bezeichnende Wirkungen ausübt. Da zunächst aber nicht einzusehen ist, warum dies nur für die Sonderform des Wanderns und nicht generell für alle touristischen Formen gelten sollte, erreicht damit die Frage, warum und in welcher Weise der Tourismus Gegenstand der Erziehungswissenschaft sein könnte, eine erhebliche Reichweite.Tatsächlich aber kommt diese Frage von außen, von der Praxis des Tourismus selbst. Die Ausbreitung des Reisens auf das jugendliche Publikum hat Tatsachen geschaffen, die bis zu einem gewissen Grade von allen Beteiligten als bedenklich angesehen werden: daß zahllose Jugendliche gefährdet werden, weil die Nachfrage das gut überlegte Angebot bei weitem übersteigt; daß die traditionellen Formen der Jugendpflege - an kleine Zahlen, überschaubare Gruppen und ehrenamtliche Helfer gebunden - buchstäblich "überfahren" werden. Allenthalben ruft man nun nach der Wissenschaft, und manchmal erwartet man von ihr wahre Zauberleistungen: Sie soll möglichst schon bis zur nächsten Saison nicht nur die Zusammenhänge aufklären, sondern auch klare Anweisungen für die Verbesserung der Praxis geben.
Aber gesellschaftliche Entwicklungen - und erst recht solche der Marktdynamik - sind immer schneller als der wissenschaftliche Verstand, der sie sich zum Bewußtsein bringen will. Gegenwärtig steht die wissenschaftliche Erforschung des Tourismus noch ganz am Anfang. Da selbst
104
alle einzelwissenschaftlichen Probleme - psychologische, soziologische, ökonomische usw. - noch völlig offen sind, wäre nichts leichtfertiger, als im Handumdrehen eine pädagogische Theorie des Tourismus zu entwerfen, die nach Lage der Dinge nur Klischees bieten könnte. Wir müssen vielmehr davon ausgehen, daß "Tourismus" ein Feld ist, das bisher überhaupt nicht im Fragehorizont der Erziehungswissenschaft gestanden hat. Was heute in diesem Zusammenhang als "pädagogisch" bezeichnet wird, entbehrt infolgedessen jeder wissenschaftlich geprüften Grundlage. Es handelt sich dabei meist um die mehr oder weniger glückliche "Anwendung" für "pädagogisch" gehaltener Meinungen und Ansichten.
Nun kann man nicht so vorgehen, daß man mit einem fraglos vorausgesetzten Bestand von pädagogischen Kategorien und Einsichten an den Sachverhalt "Tourismus" herangeht und ihn wie mit einer Wünschelrute daraufhin absucht, was an ihm pädagogisch sei und was nicht. Das wäre eine gänzlich ungeschichtliche Vorstellung von Erziehungswissenschaft. Vielmehr wird man zweckmäßigerweise von einer Wechselwirkung ausgehen: Durch die pädagogische Fragestellung werden sich bestimmte Momente des Tourismus besonders beleuchten lassen, während andererseits von den eigentümlichen Merkmalen dieses neuen Feldes aus Korrekturforderungen an bisher für gültig gehaltene allgemeine pädagogische Einsichten ergehen. Diesem Zusammenhang soll im folgenden - noch ohne tiefere systematische Absicht - in einigen Punkten nachgegangen werden. Dabei ist auch das hypothetisch gemeint, was in die Form der These gekleidet ist.
Tourismus als Beweis für erzieherische Mängel
Nach allem, was wir bisher wissen, ist Tourismus offensichtlich ein soziales Feld, das dem Pädagogen Aufschluß über eine Reihe von erzieherischen Mängeln gibt, die sonst nicht derart in den Blick treten. Die bisherigen Untersuchungen stimmen darin überein, daß vielen oder sogar den meisten Menschen in der touristischen Sozialsituation bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten fehlen, die für eine produktive. Bewältigung dieser Situation unentbehrlich sind. Insofern ist der Tourismus als eine Form des "Lebens" ein Korrektiv für Inhalte und Ziele der allgemein von der Gesellschaft veranstalteten Erziehung. Bestimmte Fehlleistungen der Menschen - insbesondere der Jugendlichen
105
- im Tourismus können als Versagen der Erziehung erkannt werden und zur Verbesserung der Erziehungsplanung führen. Vor allem folgende Mängel werden immer wieder offensichtlich:
1. Vielfach fehlt den Jugendlichen ein hinreichend differenzierter kultureller Vorstellungszusammenhang, der ihnen ermöglichen könnte, politische, kulturelle und soziale Eigenarten der fremden Umgebung zu verstehen, zu denen man aus der eigenen vitalen Erfahrung keinen Zugang mehr hat. Die politischen und sozialen Probleme eines südeuropäischen Landes etwa kann ein Jugendlicher, der sie in seiner Umwelt nicht mehr vital erlebt, nur noch über einen hinreichend gegliederten geistigen Vorstellungszusammenhang zur Kenntnis nehmen.
Wenn wir also gerade unsere Nicht-Oberschüler nicht in den Stand setzen, ihr Vorstellungsvermögen so feinnervig zu entwickeln, daß sie damit menschliche Probleme im weitesten Sinne erfahren können, die für sie selbst unmittelbar keine Bedeutung haben, dann lassen wir sie auch in dem touristischen Zustand, den wir heute kritisieren. Mit anderen Worten: Das oft einseitig betonte "praktische Denken" in unserer Volksschul- und Berufsschulbildung - die Hervorhebung dessen, was "unmittelbar interessiert" - wird angesichts des Tourismus in seiner begrenzten Tragweite erfahren. Es erreicht das "ganz andere" etwa die Mentalität von Süditalienern - nicht, und damit zeigt es eben auch ein Moment der Inhumanität. Spätestens seit es Tourismus gibt - frühestens seit politische Bildung notwendig wurde - , zeigt sich, daß die Erziehungswissenschaft den Begriff des "Lebens", auf das hin erzogen werden soll, erweitern muß. Die Ausbildung einer Vorstellungs- und Einbildungskraft gerade im Hinblick auf nicht unmittelbar zuhandene praktische und nützliche Lebenszusammenhänge - bisher allenfalls in der literarisch bestimmten Oberschule beheimatet - wird zur Forderung einer allgemeinen Volksbildung.
2. Vielen Jugendlichen fehlt ferner ein hinreichend differenziertes Repertoire sozialer Verhaltensweisen. Der Tourismus scheint zu belegen, daß in unseren Erziehungsfeldern zu sehr intime, an Kleingruppen orientierte soziale Verhaltensweisen erlernt werden, die zwar für die Bewältigung des unmittelbaren sozialen Milieus ausreichen, nicht aber für die Bewältigung fremder und ungewohnter Sozialsituationen. Die touristischen Erfahrungen legen die Vermutung nahe, daß unsere geplante Sozialerziehung möglicherweise allzusehr auf die Einübung in ein bestimmees soziales Milieu zielt. Wir müssen also stärker als bisher nicht nur überprüfen, wie weit die Inhalte unserer allgemeinen Volks-
106
bildung heute tragen, sondern auch wo die Grenzen der Reichweite dessen liegen, was wir im engeren Sinne "Erziehung" nennen. Es geht - so könnte man sagen - um eine Überprüfung des pädagogischen "Tugend-Katalogs".
Tourismus als Korrektur pädagogisch geplanter Reisen
Wenn wir davon ausgehen, daß bestimmte Formen des modernen Tourismus nicht auf Grund pädagogischer Planungen und Absichten, sondern im Rahmen des üblichen Marktmechanismus zustande kommen, und daß wir andererseits innerhalb der Jugendarbeit und Erwachsenenbildung auch weiterhin pädagogisch durchdachte Reiseveranstaltungen pflegen wollen, so kann das eine nicht ohne Blick auf das andere geschehen. Die Reflexion darüber, was pädagogisch geplantes und veranstaltetes Reisen heute sinnvoll heißen könne, kann nicht ohne genaue Kenntnis der Möglichkeiten und Bedingungen des modernen Tourismus auskommen. Aufgabe einer wie immer konzipierten "Reisepädagogik" wird vor allem sein, die Heranwachsenden "tourismusfähig" zu machen, das heißt, sie auf die Realitäten des Tourismus vorzubereiten. Selbst wenn man glaubt, auch in Zukunft pädagogisch durchdachte Reiseveranstaltungen als betonte Gegenmaßnahme gegen das touristische Reisen beibehalten zu müssen, wird man damit zu rechnen haben, daß in Zukunft nur dann alle Menschen verreisen können, wenn man im Prinzip jene organisatorischen, technischen und kommerziellen Bedingungen und Notwendigkeiten akzeptiert, die wir in ihrer Summe die "touristischen" nennen. Auch derjenige, der pädagogisch geplante Reisen nicht nur für eine Vorbereitung auf den Tourismus hält, sondern ihr eine auch für das Erwachsenenleben gültige Eigenständigkeit einräumen will, wird nicht an der Tatsache vorbeigehen können, daß für die meisten Menschen die touristischen Bedingungen und Formen des Reisens gelten werden und daß man sie daher auf diese Bedingungen wird vorbereiten müssen. Damit tauchen komplizierte Fragen auf: Kann man überhaupt in einer Situation wie der der Schule auf die so gänzlich andere Situation des Tourismus vorbereiten? Was kann man tun, und wie kann man es tun? Und weiter: Können pädagogisch geplante Reisen da weiterhelfen, ohne das Problem kurzzuschließen und sie fälschlich für die pädagogisch optimale touristische Form auszugeben?
107
Tourismus als Lernfeld eigener Art
Unabhängig von jeder möglichen pädagogischen Intervention ist das touristische Feld ein Lernfeld ersten Ranges. Was das "Massenreisen" gerade für diejenigen, die zum erstenmal in der Geschichte ihrer sozialen Schicht daran teilnehmen dürfen, an Erlebnissen, Erfahrungen und Urteilen beinhaltet, ist noch kaum zu ahnen. Die scheinbare äußere Uniformität des sogenannten "Massentourismus" darf uns nicht darüber täuschen, daß subjektiv jeder einzelne diese Erfahrungen mit seiner Bedeutung versieht und daß das, was objektiv als "Vermassung" erscheint, subjektiv durchaus ein Fortschritt von Erkenntnissen, Erfahrungen und Urteilen sein kann. In diesem Sinne ist der Tourismus ein unaustauschbares Lernfeld: Bestimmte Erfahrungen und Erlebnisse können viele Menschen nur hier und nirgends sonst haben. Wer sich wirklich mit fremder Mentalität und Kultur einläßt, relativiert die eigene. Wer da glaubt, man könne das Fremde verstehen und zugleich seinen "klaren Standpunkt" behalten, verkennt die Wirksamkeit von Erfahrungen. Wer das südliche "dolce far niente" nicht als Faulheit mißdeutet, dem muß klar werden, was ihm in seiner eigenen Gesellschaft vorenthalten wird. Oder denken wir daran, welche Folgen für die Selbstdeutung eintreten, wenn plötzlich in der touristischen Umgebung die sozialen Alltagskontrollen empfindlich reduziert oder gar aufgehoben werden.
Man muß - wegen ihres verschleierten dokumentarischen Wertes - touristische Illustrierten-Romane lesen, um sich das voll klarzumachen: Die "brave" 18jährige, die sich bitter eingestehen muß, daß ihre "Tugend" bislang kaum mehr war als eine Funktion ihres sozialen Milieus der "glückliche" Familienvater, der plötzlich fasziniert ist von der Vorstellung, daß sein Leben mit einer anderen Frau vielleicht ganz anders verlaufen wäre; oder die "ehrbare" Mutter, die einem taufrischen Casanova zu erliegen droht, weil sie zum erstenmal in ihrem Leben charmant verwöhnt wird. Solche Beispiele ließen sich beliebig fortführen. In früheren Jahrzehnten wurden sie als Trivial-Literatur von den Massen der Zu-kurz-Gekommenen gelesen, heute sind sie ebenso massenhaft Realität geworden. Aber werden solche Erlebnisse wirklich zu Erfahrungen gewendet in dem Sinne, daß sie als Bereicherung der Welt-, Menschen- und Selbstkenntnis ins Bewußtsein genommen werden? Welche Faktoren und Momente der touristischen Situation helfen dabei?
108
Die Erziehungswissenschaft müßte sich also fragen, welche Lernvorgänge sich in diesem Feld abspielen und wie sie in Beziehung gesetzt werden können zu den übrigen pädagogischen Intentionen und Veranstaltungen. Wenn sich mit einer hinreichenden Verallgemeinerungsfähigkeit herausfinden ließe, welche Faktoren des Tourismus die Erlebnis- und Erfahrungsfähigkeit der Menschen besonders fördern und welche sie hemmen oder gar verhindern, dürfte das für das "Menschenbild" der Schule und der anderen Erziehungsfelder nicht folgenlos sein. Besonders interessant in diesem Zusammenhang wäre, ob und in welcher Weise Kategorien des Marktes pädagogische Implikationen enthalten. Der "Service" eines Reiseunternehmens zum Beispiel ist ja zunächst nichts als vordergründiger "Dienst am Kunden". Aber erstens liegt auch einer solchen bloßen Marktvorstellung ein bestimmtes Bild vom Menschen und seinen Bedürfnissen zugrunde, und es ist fürs erste noch gar nicht ausgemacht, ob es unzutreffender ist als vergleichbare pädagogische Vorstellungen. Zweitens richtet sich ja "Service" auf angenommene Mängel des Kunden, hat also den Charakter einer Hilfeleistung für die Erfüllung eines Bedürfnisses, und auch hier ist nicht von vornherein ausgemacht, ob eine solche Hilfeleistung nicht auch pädagogisch akzeptabel ist. Wenn aber ein recht verstandener Service - der seinen kommerziellen Erfolg nicht in manipulativen Augenblickslösungen sieht, sondern darin, die gründlich ermittelten Bedürfnisse mit einer gewissen Langfristigkeit zu jefriedigen - nicht notwendig dem widersprechen muß, was wir im pädagogischen Sprachgebrauch "Hilfe" nennen, dann bietet sich die Möglichkeit an, touristische Unternehmungen und Maßnahmen vom pädagogischen Sachverstand aus und trotzdem "marktgerecht" zu kritisieren. Daß in diesem Sinne alle Marktbegriffe pädagogische Implikationen haben, ist uns im Grunde geläufig, seit es "Freizeitpädagogik" gibt. Aber kaum irgendwo wird dieser Zusammenhang so unmittelbar evident wie im besonderen Freizeitfeld des Tourismus.
Tourismus als extreme Freizeitsituation
Der Tourismus ist ein Teil des Freizeitsystems. Während im Alltag die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit fließend sind, werden die neuen Elemente der Freizeit im Urlaub besonders erfahrbar. Urlaub als Befreiung von den Lasten des Alltags - die ja vornehmlich Lasten
109
vielfältiger sozialer Verpflichtungen sind - ist eine Vorstellung, die sich wohl allgemein einstellt, sobald jemand seine Urlaubsreise antritt. Damit aber steigert sich das, was der Freizeit an Chancen und Grenzen allgemein anhaftet, in der besonderen Situation des Urlaubs in besonderer Weise. Sieht man nämlich die moderne Freizeit als Symptom eines größeren sozialgeschichtlich-ökonomischen Zusammenhangs, dann repräsentiert sie in höchstem Maße mindestens drei Befreiungen des Menschen: die Befreiung von der Totalität der Berufsrolle, die Befreiung vom Existenzminimum und die Befreiung vom Milieu als sozialem Schicksal.
Wir entdecken in den neuen Möglichkeiten der Freizeit erstens, daß wir seit dem Aufkommen der industriellen Gesellschaft den mit ihr verbundenen Zwängen dadurch gehorchen mußten, daß wir auch in der Erziehung Tugenden und Zielsetzungen in den Vordergrund stellten - wenn nicht gar verabsolutierten - , die auf diese besondere geschichtliche Situation produktiv antworteten. "Ordnung", "Pflichtgefühl", "Ausdauer", "Bescheidenheit" usw. sind Tugenden, die es zwar in einem abstrakten und formalen Sinne wohl immer schon gegeben hat, deren konkrete inhaltliche Bestimmung aber vornehmlich von den Leistungen und Erwartungen des modernen Erwerbslebens her vorgenommen wurde. Aber schon Karl Marx hatte deutlich gesehen, daß eine derartige Totalisierung des menschlichen Daseins von der beruflichen Leistung her den Menschen "bornieren" muß. Wie sehr solche leistungsorientierten Vorstellungen sich in unserem pädagogischen Denken festgesetzt haben, wird sofort deutlich, wenn wir uns die pädagogischen Zielvorstellungen ansehen, die im Zusammenhang mit dem Jugendreisen und Jugendtourismus verkündet werden. Der Begriff "Erholung", der zum Kernbegriff staatlicher Bezuschussung für Jugendreisen geworden ist, spiegelt diese Einseitigkeit wider. Er meint ja doch vor allem Wiederherstellung der geistigen, körperlichen und seelischen Kräfte zum Zwecke der dadurch verbesserten beruflichen Leistungsfähigkeit.
Ohne Zweifel wird "Erholung" auch in Zukunft eine unerläßliche Kategorie der Urlaubspädagogik bleiben. Ihre Reichweite aber trifft gerade nicht mehr das, was das Neue am Tourismus ausmacht. Die entscheidenden pädagogischen Probleme der Freizeit im allgemeinen und des Tourismus im besonderen setzen dort ein, wo die Massen den Anspruch auf Vergnügen, Luxus und Genuß in der Weise erheben, daß sie ihn in einer gewissen Autonomie gegenüber den mannigfaltigen
110
sozialen und politischen Pflichten sehen, die im übrigen dadurch keineswegs nennenswert beeinträchtigt werden müssen. Bert Brecht hat in den "Flüchtlingsgesprächen" diesen Punkt sehr markant bezeichnet: "Jedenfalls stimmen wir ein darüber, daß Genußsucht eine der größten Tugenden ist. Wo sie es schwer hat oder gar verlästert wird, ist etwas faul... Aber das Entscheidende ist: Das Genußleben ist vollständig getrennt vom übrigen Leben. Es ist nur zur Erholung, damit Sie wieder tun können, was kein Genuß ist. Sie kriegen überhaupt nur das bezahlt, was Ihnen keinen Genuß bereitet". Will die Pädagogik nicht in Zukunft den Faktor "Vergnügen" weiterhin ignorieren, wird sie zur Relativierung und Korrektur jener ihrer Vorstellungen gezwungen sein, die sie der Absolutsetzung bestimmter historischer Erfahrungen verdankt. Ober aber sie wird präzisieren müssen, ob und weshalb sie der Auffassung ist, das gegenüber sozialen Pflichten autonome Vergnügen sei abzulehnen. So oder so werden wir pädagogische Maßstäbe gegenüber diesem Phänomen entwickeln müssen, die ihm angemessen sind. Sind das von außen herangetragene "Werte"? Oder sind es ästhetische Prinzipien der "Angemessenheit", der "Differenziertheit", also kurz: des "Stiles"? Und wie und wo wird man das den Heranwachsenden beibringen können?
Eine der wichtigsten Voraussetzungen für den modernen Tourismus ist das, was man die "Befreiung vom Existenzminimum" nennen kann. Auch scharf kalkuliertes touristisches Reisen ist teuer, und jeder einzelne wird nur in dem Maße daran teilnehmen können, wie sein Einkommen das Existenzminimum übersteigt. Bekanntlich hemmen uns auch hier wieder jene schon kritisierten Vorstellungen aus der ersten Phase der Industrialisierung. Mindestens auf der Ebene der praktischen Pädagogik haben wir eigentlich immer behauptet - im Sinne einer Zwecklüge - , daß Reichtum in Betracht eines menschenwürdigen Daseins bestenfalls indifferent, in der Regel aber eher hinderlich sei. Es kann aber heute keinem Zweifel mehr unterliegen, daß es zwischen Reichtum und Menschlichkeit eine positive Beziehung in dem Sinne gibt, daß zwar der Reiche nicht unbedingt auch der bessere Mensch ist, daß aber bestimmte menschliche Differenzierungen und Kultivierungen ohne ein gewisses Maß von über das Existenzminimum hinaus verfügbaren Geldmitteln prinzipiell nicht möglich sind. Auch diese - insbesondere wieder im modernen Tourismus erfahrbare - Einsicht kann für das, was die Erziehung unter "Vorbereitung auf das Leben" versteht, nicht gleichgültig sein.
111
Für die Erziehung unmittelbar am bedeutsamsten scheint mir aber die "Befreiung vom Milieu als sozialem Schicksal" zu sein. In der Soziologie spricht man hier lieber von der "Nivellierung der Klassengegensätze". Ich ziehe den Ausdruck "Milieu" hier deshalb vor, weil er diesen sozialen Prozeß stärker aus der Perspektive des Wandels der einzelnen Lebenssituation beschreibt. Alle "vor-touristischen" Formen des Reisens verblieben innerhalb des eigenen sozialen Milieus. Die "grand tour", die "Bildungsreise", die "Badereise" und schließlich auch die "Fahrt" haben gemeinsam, daß sie sich alles in allem innerhalb der Vorstellungen und Verhaltensweisen des eigenen sozialen Milieus bewegten. Außerdem sind die in der Praxis herrschenden Vorstellungen über soziales Verhalten sowie über Sinn und Aufgabe des Reisens einem bestimmten klein- bis mittelbürgerlichen Milieu zuzurechnen. Was zum Beispiel jeweils konkret unter "Gemeinschaft" und "Freude" verstanden wird, das entspricht dem Selbstverständnis einer bestimmten sozialen Schicht und ist keineswegs allgemeingültig. Besonders deutlich wird das bei den manichäischen Partien dieses Denkens. Nun sind die am weitesten entwickelten Formen des modernen Tourismus unter anderem dadurch gekennzeichnet, daß sie gar kein "Milieu" mehr aufweisen. Zwar bleiben die "Arbeiter", "Kleinbürger", "Mittelständler", "Bauern" usw. auch in der touristischen Situation weitgehend das, was sie zu Hause sind, aber die im heimischen Milieu angeeigneten und praktizierten Verhaltensweisen und Einstellungen finden in den touristischen Bedingungen selbst keine Stütze mehr. Genau dies macht die bekannte Unsicherheit vieler Gruppen von Reisenden aus und führt zu den zum Teil grotesken "Schutz-Reaktionen" - von dem Wunsch nach der "deutschen Kneipe" und dem "deutschen Bier" bis hin zu den geläufigen nationalen Vorurteilen, mit denen man sich gegen die Verarbeitung neuer Erfahrungen abschirmt.
Ebenso wie die anderen beiden Befreiungen, so ermöglicht auch die vom sozialen Milieu erst einen Reichtum an Erfahrungen, Erlebnissen, Urteilen und Meinungen, der ohne sie nicht möglich ist. Angesichts dieser Zusammenhänge wird sich die Pädagogik fragen müssen, ob das, was sie als "soziale Tugenden" und als "Sozialisierung" erstrebt, nicht tatsächlich auf ein bestimmtes soziales Milieu hin konzipiert ist, so daß damit bestimmte Situationen des Lebens wie die touristische gar nicht erreicht werden können.
112
Tourismus als unaustauschbares Feld der Jugendforschung
Schon aus dem bisher Gesagten wird deutlich, daß möglichst genaue Kenntnisse über den Tourismus auch unsere Kenntnisse über die Menschen und ihr Verhalten bereichern werden. Das kann noch durch eine weitere Überlegung präzisiert werden. Eine Grundschwierigkeit aller heutigen Jugendforschung ist ja, daß wir das Verhalten Jugendlicher immer nur in bestimmten Situationen messen können. Es ist eine für die wissenschaftliche Erkenntnis höchst bedeutsame Tatsache, ob man Jugendliche im Elternhaus, in der Schule, im Beruf oder in der Freizeit untersucht. Die Ergebnisse weichen dann ganz erheblich voneinander ab - eine Tatsache, die uns im Zeitalter des "außengeleiteten Menschen" nicht mehr verwundert. Daraus folgt, daß unsere Kenntnis über die Jugend um so genauer sein wird, je verschiedenartigere Situationen den Erhebungen zugrunde liegen. Das ist für die Erziehungswissenschaft nicht nur deshalb von großer Wichtigkeit, weil die Kenntnis der Jugend allgemein zu den wichtigsten Voraussetzungen ihres Denkens gehört, sondern auch, weil die Pädagogik ihre Erziehungs- und Bildungserfahrungen mit der Jugend immer nur in einem ganz begrenzten Situationsfeld - in der Regel im schulischen Situationsfeld - macht. Daher sind ihre Vorstellungen darüber zum Beispiel, was Jugendliche eines bestimmten Alters lernen können und wollen und was nicht und auf welche Erfahrungen der Jugendlichen die Lerntheorie sich dabei stützen kann, immer in besonderer Weise einem geradezu beruflich bedingten Irrtum ausgesetzt. Seitdem andere Erziehungsfelder außerhalb der Schule stärker ins Blickfeld der Pädagogik rücken, wird auch klar, daß bestimmte Lernmotivationen, die in der Schule gar nicht oder nicht überzeugend zur Geltung kommen, in anderen Feldern durchaus dominant werden können. Die möglichst genaue Kenntnis solcher Lernmotivationen und Lernbedürfnisse, wie sie sich möglicherweise im extremen Freizeitfeld des Tourismus zeigen, wären deshalb auch für die allgemeine Pädagogik von großem Wert. Aus diesen Gründen erscheint es auch nicht ratsam, den Komplex des Jugendtourismus voreilig aus dem touristischen Gesamtzusammenhang zu isolieren. Sonst läuft man leicht Gefahr, sich ein zu begrenztes Bild von den jugendlichen Bedürfnissen zu machen, das vielleicht gerade durch den gesellschaftlichen Zusammenhang der touristischen Phänomene korrigiert wird.
113
Tourismus im sozialgeschichtlichen Fragehorizont
Ein offensichtlicher Mangel der bisherigen Diskussion um den Tourismus ist darin zu sehen, daß den meisten Betrachtungen die historische Perspektive fehlt. Dieser Mangel äußert sich vor allem in der Unsicherheit des Sprachgebrauches. Während der eine "Tourismus" sagt und damit die neuen Formen des Verreisens meint, versteht ein anderer darunter "Reisen überhaupt", womit er sich durchaus auf den Brockhaus berufen kann. Begriffliche Klärungen ohne einen hinreichenden historischen Hintergrund bleiben hier problematisch und erwecken den Anschein der Willkür. Hinzu kommt, daß man ohne den geschichtlichen - im Falle des Reisens also vor allem sozialgeschichtlichen - Hintergrund die Erscheinungen zu einfach interpretiert und vor allem bei pädagogischen Überlegungen leicht alles für realisierbar hält, was nur "menschlich" genug gedacht ist.
Leider werden wir auch in dieser Hinsicht von der Wissenschaft fast völlig im Stich gelassen. Zwar verdanken wir Hans Joachim Knebel ("Soziologische Strukturwandlungen im modernen Tourismus", Stuttgart 1960) und Hans Magnus Enzensberger ("Eine Theorie des Tourismus", in: Einzelheiten I, Edition Suhrkamp, Nr. 63) wichtige Hinweise. Sie können aber auch nicht mehr als begründete Hypothesen bieten. Der historische Zusammenhang kann folgendermaßen angedeutet werden:
Der gegenwärtige Tourismus ist hervorgegangen aus einem geschichtlichen Prozeß, der immer neuen und schließlich allen sozialen Schichten eine Art touristischer Gleichberechtigung verschaffte. Dabei fand die jeweils neue Schicht alte Formen der vor ihr reiseprivilegierten Schicht vor, übernahm sie und veränderte sie im Prozeß dieser Aneignung und Sozialisierung. So übernahm etwa die frühere Arbeiterbewegung das bürgerliche Vorbild der "Bildungsreise", das sie aber nicht nur nachahmte, sondern auch den eigenen Bedürfnissen und Maßstäben entsprechend veränderte. Wichtig zu beachten ist dabei, daß es bis in die Gegenwart hinein immer noch Schichten gab, die - im wesentlichen aus ökonomischen Gründen - an diesem Privileg nicht teilhatten. Diese Tatsache ist nun andererseits für das, was die privilegierten Schichten unter "richtigem Reisen" verstanden, wichtig gewesen. Das Selbstbewußtsein etwa, das dem "gebildeten Bürger" die "Bildungsreise" vermittelte, lebte wesentlich davon, daß diese Erfahrung zahllosen anderen Menschen prinzipiell verschlossen war -
114
wie ja überhaupt die sogenannten "Bildungsgüter" nicht zuletzt dadurch sich bestimmten, daß sie den meisten gar nicht zugänglich waren und deshalb zu einem Faktor des Sozialprestiges werden konnten.
Übrigens sieht man heute kaum, daß die Anziehungskraft der Jugendbewegung nicht zuletzt darin bestand, daß die an ihr Teilnehmenden sich zu den Reiseprivilegierten rechnen konnten. Dank der durch rigoroseM Sparsamkeit erreichten Verbilligung (Jugendherbergen zum Beispiel) konnten sich die Jugendlichen der Jugendbewegung leisten, was den meisten ihrer Eltern versagt war.
Mit dem allerdings, was wir heute "Tourismus" nennen, schlägt diese Entwicklung um. Unter diesem Begriff hebt eine Phase der sozialgeschichtlichen Entwicklung an, die in kürzester Zeit die touristische Gleichberechtigung aller schafft. Zum erstenmal in der neueren europäischen Sozialgeschichte gibt es keine soziale Schicht mehr, die nicht verreisen kann. Diese Tatsache hat schwerwiegende ideologische und organisatorische Folgen.
Die ideologischen Folgen bestehen vor allem darin, daß mit dem Wegfall der Privilegiertheit wesentliche Motive entfallen, weiterhin noch eine bestimmte, überlieferte Form des Verreisens zu bewahren. Andererseits ergibt sich das, was man die "Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen" (Karl Mannheim) genannt hat: Verschiedenartige Vorstellungen, die aus ganz verschiedenen geschichtlichen Erfahrungen und sozialen Strukturen sich ergaben, bestehen nun nebeneinander, durchdringen sich, drücken scheinbar dasselbe aus, führen aber tatsächlich zu kaum noch kontrollierbaren Sprach- und Verständigungsschwierigkeiten. Ein Beispiel nannten wir schon: Das Wandern, ursprünglich vor allem deshalb publik geworden, weil es für bestimmte Schichten die ökonomisch einzig mögliche Form des Verreisens war, wird gegenüber seinen historischen Entstehungszusammenhängen verselbständigt und nimmt - etwa bei Brezinka - den Charakter eines anthropologischen Grundbedürfnisses an.
Die organisatorischen Folgen sind vielleicht noch beachtlicher. Hier ergibt sich ein merkwürdiger Zirkel. Wenn schließlich fast alle Heranwachsenden und Erwachsenen - noch dazu in bestimmten Stoßzeiten - verreisen, wird ein ungeheures Maß an vorplanender Organisation erforderlich. Das Verkehrschaos in den Hauptreisezeiten belehrt uns darüber, was geschehen würde, wenn tatsächlich jeder "spontan" und "auf eigene Initiative" verreisen wollte, wie das offenbar immer noch dem herrschenden Persönlichkeitsbild entspricht. Umgekehrt zwingt
115
die planende Organisation zur Rationalisierung und ermöglicht sie. Das Verreisen wird billiger und dadurch wieder für mehr Menschen erschwinglich. Die unumgänglich notwendige Organisation gewinnt nun auch Einfluß auf die Formen des Verreisens. Preislich günstig ist auch das, was leicht zu organisieren ist. Angesichts des Zwanges zur Organisation haben die überlieferten Formen des Reisens nur noch so viel Wert, wie sie eben organisierbar sind. Das hat nun keineswegs dazu geführt - wie man meist fälschlich annimmt - , daß alle früheren Formen von der touristischen Form überflügelt worden seien, sondern umgekehrt dazu, daß wir heute einen Formenreichtum des Reisens finden wie nie zuvor. Man kann sich buchstäblich keine noch so eigenwillige Reise ausdenken, die nicht in jedem Falle leichter zu realisieren wäre als noch vor 50 Jahren. Daß unter den Bedingungen moderner Organisation Reisen um so teurer werden, je eigenwilliger sie geplant sind, steht auf einem anderen Blatt. Aber die früheren Reisevorstellungen, die an ein bestimmtes Milieu gebunden waren, das man nicht ungestraft verlassen durfte, waren sicher nicht weniger provinziell als die gegenwärtigen massentouristischen Formen. Gewiß kann man, wenn man weit genug von der Wirklichkeit abstrahiert, von einer "Totalität der touristischen Rolle" (Knebel) sprechen, aber für die pädagogische Betrachtungsweise ist diese Bestimmung zu grob, weil sie außer acht läßt, daß in der Sicht des einzelnen Reisenden die verschiedenen Variationen des Tourismus keineswegs einfach austauschbar sind, da sie je verschiedene Erlebnis- und Erfahrungsmöglichkeiten beinhalten.
Ich halte es daher für sinnvoll, unter dem Begriff des "Tourismus" alle heute noch üblichen und demnächst vielleicht noch entstehenden Formen des Reisens zusammenzufassen. Die Berechtigung, im einzelnen so verschiedene Dinge wie die "Fahrt" und eine "Touropa-Reise" unter einem Begriff zusammenzufassen, ergibt sich nicht nur daraus, daß unter den modernen touristischen Bedingungen alle modernen Formen des Reisens tatsächlich "aufgehoben" sind, sondern auch daraus, daß bestimmte Freizeitvorstellungen, Reisemotive und Erwartungen sich allenthalben in ähnlicher Weise finden dürften. Die sogenannten jugendpflegerischen Formen des Reisens sind in ihrem Selbstverständnis schon seit langem ebenso auf den Vergleich mit den kommerziellen touristischen`Formen angewiesen, wie diese umgekehrt zahlreiche Erfahrungen von jenen übernommen haben. Außerdem tragen wir mit einer solchen Begriffsbestimmung dem Einheit stiftenden Charakter der sozialgeschichtlichen Entwicklung Rechnung. Innerhalb der Fülle der
116
Formen lassen sich nun je nach der Erkenntnisabsicht verschiedene Unterscheidungen treffen. Für die pädagogische Betrachtung sind vor allem wohl zwei Gruppierungen sinnvoll.
1. Man kann die einzelnen Formen hinsichtlich ihrer Entstehungszusammenhänge beschreiben, sie also historisieren. Dabei käme es vor allem auch auf gründliche sozialgeschichtliche Studien an. Es wäre unter anderem nach der sozialen Funktion sowie nach den durch die Sozialisierungsprozesse bestimmten Veränderungen zu fragen. Dieses Verfahren käme also einer historischen Kritik heutiger Reiseformen gleich, was die Pädagogik vor der Absolutsetzung geschichtlich bedingter Einsichten - wie im Falle des "Wanderns" - bewahren könnte.
2. Man kann die Reiseformen nach dem Ausmaß ihrer Planung unterscheiden. Dann kommt man zu einer Skala von relativ wenig bis zu relativ streng geplanten Maßnahmen. Auf der einen Seite steht vielleicht das Trampen, auf der anderen Seite die Schulreise, bei der vielleicht sogar bis in konkrete Tageszeiten hinein Veranstaltungen vorgeplant sind. Diese Unterscheidung ist deshalb interessant, weil jede Planung das pädagogisch bedeutsame Erfahrungsfeld erst konstituiert andererseits dadurch aber auch "vor-fabrizierte" Erfahrungen und Erlebnisse zustande bringt. Dabei macht es grundsätzlich keinen Unterschied, ob die Planung mit pädagogischen Motiven erfolgt. Ob sie im Einzelfalle pädagogisch sich rechtfertigen läßt, hängt nicht allein von den Vorstellungen der pädagogischen Planer ab, sondern bedarf eines umfassenderen kritischen Horizontes. Andererseits kann eine Planung, die nicht von hauptberuflichen Pädagogen, sondern von gut ausgebildeten Reiseleitern gemacht wird, sich auch pädagogisch rechtfertigen lassen.
Tourismus als Grenze des Jugendschutzes
Aus einer solchen sozialgeschichtlichen Betrachtung der Dinge ergibt sich nun eine prinzipielle Begrenzung der Möglichkeiten des Jugendschutzes. Zwar können die Eltern nach wie vor bestimmte Vorhaben der Jugendlichen verbieten und andere erlauben, aber die Gesellschaft als Ganzes hat nur noch ein sehr grobes Netz von Kontroll- und Schutzmöglichkeiten zur Verfügung. Sie werden allenthalben von den durch die drei Befreiungen geschaffenen Libertäten durchbrochen. In diesem Sinne kann der Jugendliche heute - insbesondere im Ausland -
117
ziemlich uneingeschränkt an der Freizügigkeit des Erwachsenenlebens teilnehmen. Daß damit gerade für das Jugendalter erhebliche pädagogische Probleme entstehen, liegt auf der Hand. Man darf mit gutem Grund annehmen, daß Jugendliche durch die plötzliche Abwesenheit der alltäglichen Sozialkontrolle in der Regel überfordert werden. Aber ebenso klar muß man sich darüber sein, daß man mit gesetzlichen Maßnahmen des Jugendschutzes nicht einmal an den Kern des Problems herankommt, geschweige es lösen kann. Spätestens angesichts des Tourismus entdecken wir, daß die`pluralistische Gesellschaft als solche zwar noch formal, aber nicht mehr konkret material normativ prägend wirken kann, daß in Wahrheit die normativen Prägungen eben immer innerhalb eines bestimmten sozialen Milieus, innerhalb einer "Bezugsgruppe" erfolgen. Die pluralistische Gesellschaft als Ganzes aber ist keine prägende Bezugsgruppe. Selbst solche Zielsetzungen, die von allen Gruppen der Gesellschaft als jugendschützend angesehen werden, lassen sich gar nicht oder nur schwer gesetzlich verwirklichen, weil die jugendgefährdenden Partien nicht isolierbar sind aus dem ganzen gesellschaftlichen Funktionskomplex und weil der Versuch einer solchen Isolierung dann immer auch problematische Eingriffe in das Ganze hervorruft. Erschwert werden solche Eingriffe noch dadurch, daß in den meisten Fällen die umstrittenen Gegenstände ein mehrdeutiges Gesicht haben, daß sie also für ein bestimmtes Bewußtsein entwicklungshemmend wirken, für ein anderes aber zur Erweiterung des Lebenshorizontes führen können. Die Hoffnung also, man könne solche Phänomene noch weitgehend eindeutig bestimmen, erweist sich als ein Denken, das den Sinn dessen, was "Fundamentaldemokratisierung" heißt, noch gar nicht zur Kenntnis genommen hat. Je einseitiger wir uns also um negative Jugendschutzmaßnahmen im Tourismus bemühen, um so mehr betrügen wir uns um den vollen Ernst der Sachverhalte. Der wirksamste Jugendschutz - das erweist wieder die Extremsituation des Tourismus - ist der positive Jugendschutz, das heißt die angemessene Vorbereitung der Erziehung auf das "Leben", hier auf die touristische Rolle. Wir haben also zum Beispiel zu fragen: Gewöhnen wir unsere Jugendlichen in unseren Erziehungsfeldern so sehr an eine autoritäre Folgsamkeit, daß sie die Bewältigung einer so extrem freiheitlichen Situation wie die touristische nicht schaffen? Unterdrücken wir zwischengeschlechtliche Konfliktsituationen, anstatt sie aufbrechen zu lassen und sie gemeinsam mit den Jugendlichen zu lösen? Eine Gesellschaft, der es wirklich um die bestmögliche Entwicklung ihrer
118
Jugend geht, darf sich nicht mit irrealen Jugendschutzforderungen begnügen, nur weil ihr die konstruktiven und positiven Lösungen zu aufwendig sind.
Tourismus als Grenze der traditionellen Jugendarbeit
Zweifellos hat der moderne Tourismus die überlieferten Maßnahmen des jugendpflegerischen Reisens quantitativ "überfahren". Noch bis vor wenigen Jahren hatte man es hier mit kleinen Zahlen und kleinen Gruppen in einfachen organisatorischen Zusammenhängen zu tun, die von wenigen Hauptamtlichen und zahlreichen Ehrenamtlichen gemeistert werden konnten. Seit man begonnen hat, das Volumen der eigenen Maßnahmen erheblich auszuweiten, stellen sich auch hier massentouristische Probleme ein: Der organisatorische Apparat, weiterhin auf ehrenamtliche Kräfte gestützt, wird immer krisenanfälliger; die Auswahl der geeigneten Mitarbeiter, bisher vor allem durch persönliche Bekanntschaft erleichtert, muß sich zunehmend "objektiver", "unpersönlicher" Maßstäbe bedienen; die Programme, bisher vorwiegend aus einem langen Gemeinschaftsprozeß der reisenden jugendlichen Gruppe erwachsen, müssen zusehends normiert, in die Verkaufssprache der Werbung gekleidet und an ein anonymes jugendliches Publikum herangetragen werden.
So ist heute weithin zu beobachten, daß die überlieferten Vorstellungen - zum Beispiel die Forderungen nach der kleinen Gruppe oder nach dem Programm als gemeinsame Initiative -ideologisch geworden sind, weil sie in einen Widerspruch zu den Bedingungen ihrer Verwirklichung geraten sind. Die heute sogenannten "jugendpflegerischen Programminhalte" der als "jugendfördernd" angesehenen Reiseformen waren ursprünglich dadurch definiert, daß sie aus der selbstverständlichen gemeinsamen Initiative kleiner wandernder Gruppen erwuchsen. Sie bezeichneten das, was man selbst ohne großen Aufwand jederzeit unterwegs veranstalten konnte. Heute haben sich die Inhalte bis in die Behördensprache in dem Maße verselbständigt, wie die sozialen Grundlagen der jugendlichen Gemeinschaft verschwunden sind. Die kleine Gruppe - ursprünglich die optimale Sozialform für die gemeinsam erwarteten Fahrterlebnisse und Abenteuer - gilt nun im Gegenteil als Optimum sozialer Kontrolle und pädagogischer "Betreuung".
Das Problem wird noch dadurch verschärft, daß die Grenzen zwischen
119
kommerziellem und jugendpflegerischem Tourismus immer fließender werden, daß also die pädagogischen Begründungen für staatliche Zuschüsse immer weniger überzeugen. Die positiven Begründungen - "Erholung", "jugendgemäße Freude", "Gemeinschaftserlebnis" usw. - geraten angesichts des eben genannten Widerspruchs in den Ideologieverdacht, und der Hinweis auf die im Verhältnis zum kommerziellen Tourismus verstärkte Sozialkontrolle ist für sich genommen ein höchst zweifelhaftes pädagogisches Argument, weil es produktive Erfahrungen eher verhindert als fördert.
Zwei pädagogische Kategorien
Bisher ist wohl hinreichend deutlich geworden, wie viele ineinander verschränkte Zusammenhänge berücksichtigt werden müssen, bevor man daran gehen kann, pädagogische Zielvorstellungen gegenüber diesem neuen Feld zu entwickeln.
Fürs erste schlage ich eine Unterscheidung zwischen "touristischer Emanzipation" und "touristischer Erfahrung" vor. "Touristisch emanzipiert" wollen wir denjenigen nennen, der in der Lage ist, die vorhandenen Bedingungen und Möglichkeiten so zu kombinieren, daß er eine bestimmte Reisevorstellung optimal durchsetzen und verwirklichen kann. Das ist eine rein formale und deshalb gefährliche Definition, wie sich sofort zeigen wird. Sie gilt nämlich auch für den 17jährigen, der seine Eltern täuscht und dann aus der Fülle der Möglichkeiten jene auswählt, die ihm mit Erfolg ein möglichst unkontrolliertes Zusammensein mit seiner gleichaltrigen Freundin garantieren. So sehr man aber hier Zweifel an der Richtigkeit des Zweckes haben kann, so wenig kann andererseits zweifelhaft sein, daß es sich um eine souveräne Kenntnis der Bedingungen und Möglichkeiten handelt.
"Touristisch erfahren" hingegen können wir nur jemanden nennen, der die Vielschichtigkeit der Reiseformen wenigstens teilweise ausprobiert hat, die Unterschiede erlebt und geistig verarbeitet und in einen hinreichend differenzierten Vorstellungszusammenhang einbezogen hat. Im Sinne eines älteren Sprachgebrauches könnte man ihn den "touristisch Gebildeten" nennen. Jedenfalls schlägt die Kategorie der "touristischen Erfahrung" die Brücke zur allgemeinen Pädagogik. Während man fast sozialwissenschaftlich messen kann, ob jemand in unserem Sinne "touristisch emanzipiert" ist, ist das hier unmöglich. Gleichwohl
120
ist es nötig, einen derartigen qualitativen Maßstab mit ins Spiel zu bringen, weil sonst alles, was wir in Sachen "Reisepädagogik" tun würden, zur bloßen Sozialtechnik würde. Die Reflexion gerade über die Zwecke, über die eigenen Erfahrungen, über den Vergleich mit anderen Erlebnissen, über das einem selbst "Gemäße" - dies alles muß hinzukommen, obwohl es sicher schwer nachprüfbar ist. Jener Pfadfinder, der Jahr für Jahr mit seiner Gruppe geschickt und erfolgreich Fahrten unternimmt, diese seine Erfahrungen aber schlechthin verallgemeinert oder gar einzig von ihnen aus die übrigen Möglichkeiten des Reisens aburteilt, ist zwar touristisch emanzipiert, aber nicht touristisch erfahren. Das gleiche gilt für jenen Studienrat, der mit seiner Familie Jahr für Jahr weite Wanderungen unternimmt, aber ohne weitere Erfahrungen Vorurteile gegen das Camping entwickelt. Überhaupt ist zwar die touristische Emanzipation vorwiegend ein Problem jener Schichten, die erst vor kurzer Zeit zum Reisen gekommen sind, während das Problem der touristischen Erfahrung keineswegs an bestimmte gesellschaftliche Schichten gebunden ist. Wo immer eine mögliche Selbst- und Welterfahrung vorweg verweigert wird, da haben wir es mit Vorurteilen zu tun. Natürlich gilt das auch für jene "Modernisten", die das Wandern schon deshalb ablehnen, weil es älter als das Automobil ist, dabei aber übersehen, daß bei dieser Form des Reisens bestimmte Erfahrungen möglich sind, die bei anderen Formen nur schwerlich auftauchen. Daß sehr wahrscheinlich die meisten Formen des Tourismus nicht gegenseitig austauschbar sind, haben wir schon gesagt. Offensichtlich ist "touristische Emanzipation" Voraussetzung für die "touristische Erfahrung".
Die Aufgabe des pädagogischen Tourismus
Bisher mochte der Eindruck entstanden sein, daß es keine rechte Aufgabe für die pädagogischen Formen des Tourismus mehr gebe. Dies wäre nur dann richtig, wenn man von einem Gegensatz zwischen kommerziellem und pädagogischem Tourismus ausginge. Aber ein solcher Gegensatz wäre weder sozialgeschichtlich noch auch soziologisch-ökonomisch zu rechtfertigen. Die pädagogischen Maßnahmen auf diesem Gebiet sind zum Scheitern verurteilt, wenn sie sich weiter an historischen Klischees anstatt am objektiven System des Tourismus selbst orientieren. Ihre Aufgabe wäre vielmehr, innerhalb des dialektischen
121
Gefüges der touristischen Befreiungen sich auf die Seite jener positiven Momente zu schlagen, die zu einer vorher ungeahnten Bereicherung des Selbst- und Weltbildes führen können. Diese Momente sorgfältig herauszufinden, wird vornehmste Aufgabe einer noch zu entwickelnden Urlaubspädagogik sein. Wie groß der Fragehorizont dabei sein muß, hoffe ich in dieser Skizze gezeigt zu haben. Nötig wäre, mit pädagogischen Leitvorstellungen, wie zum Beispiel "touristische Emanzipation" und "touristische Erfahrung", die pädagogische Planung des Reisens neu zu durchdenken sowie geeignete Methoden und Ausbildungsmaßnahmen zu entwickeln. In einer so verstandenen pädagogischen Reflexion käme gleichsam das System des Tourismus derart zu seinem Bewußtsein, daß seine produktiven Momente und Aspekte weitergetrieben werden und für das ganze System zu einem neuen Anspruch werden können. Diese Bemühungen wären zugleich eine neue Begründung für die staatliche Subvention, weil das bloße Marktsystem des Tourismus eine solche Reflexion und ihre praktische Realisierung nicht aus sich selbst hervorbringen kann.
Endziel einer erziehungswissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Tourismus wird sein müssen, die Ergebnisse zu einer "Theorie", das heißt zu einer "Berufslehre" für die in diesem Feld Handelnden zu verdichten. Warum das so schwierig ist, sollte dieser Beitrag erklären. Es mag den an der Praxis Leidenden ein Trost sein, daß die Schwierigkeiten zum allerwenigsten in der persönlichen Fähigkeit oder Unfähigkeit der Beteiligten begründet sind.
122

43. Gegen eine positivistisch verstandene "Erziehungswirklichkeit" (1965)
(In: deutsche jugend, Heft 10/1965, S. 468-472)Die Diskussion und Kritik des Buches "Was ist Jugendarbeit?" ( München 1964; vgl. Nr. 33 in dieser Edition, H.G.) hat so viele interessante und lehrreiche Aspekte erbracht, daß man der Aufforderung, sich dazu auf knappem Raum zu äußern, einigermaßen hilflos gegenübersteht. Wo soll man anfangen und wie soll man auswählen? Es ist wohl am besten, einen einzigen Beitrag herauszugreifen und durch eine Auseinandersetzung mit ihm das Gespräch weiterzutreiben. Dabei scheint mir der Beitrag von Walter Hornstein ("Die Schwierigkeit, eine Theorie der Jugendarbeit zu entwerfen", in "deutsche jugend", Maiheft 1965, S. 219-227) besonders geeignet, weil er einmal sich am intensivsten mit unserem Begriff von "Theorie" befaßt und weil er das zweitens von einer bestimmten erziehungswissenschaftlichen Position her tut, deren Reichweite nach meiner Ansicht wesentliche Probleme einer Theorie der Jugendarbeit gar nicht erreichen kann.
Walter Hornstein hat unseren Theoriebemühungen vorgeworfen, sie beruhten auf "gesellschaftspolitischen, kulturtheoretischen und sonstigen Prämissen" (S. 221). Das dabei entstehende Bild einer erhofften verbesserten Praxis der Jugendarbeit nähre sich daher notwendig von Wünschen, Zielen und Vorstellungen, "die aus allen möglichen Bereichen, nur nicht aus der erzieherischen Wirklichkeit stammen". Hornstein hat wohl am deutlichsten von allen Kritikern gesehen, wie verschieden die Ansatzpunkte der vier Theorieversuche sind. Aber Mollenhauers These vom "fortschreitend repressiven Charakter unserer Kultur" liegt allen vier Beiträgen mehr oder weniger undiskutiert zugrunde. Diese These nun nennt Walter Hornstein eine "Prämisse".
Nach allgemeinem philosophischen Sprachgebrauch ist eine Prämisse eine Grundannahme, die nicht bewiesen ist oder überhaupt nicht beweisbar ist. Rousseaus Annahme, daß die Menschen im Urzustand wilde, aber asoziale glückliche Einzelne
468
gewesen seien, ist ebenso eine Prämisse, wie die Annahme, Gott habe die Welt erschaffen. Der Streit, was eine Prämisse sei, ist in unserem Fall keineswegs nur ein "philosophischer", sondern ein eminent "praktischer". Wenn Hornstein nämlich recht hat, dann gilt, was Mollenhauer zur Theorie der Jugendarbeit schreibt, gar nicht allgemein, sondern nur für eine "Jugendarbeit a la Mollenhauer". Wem sie nicht paßt, der sucht sich eben eine andere Prämisse, die ihm besser zusagt, und baut sich daraus eine eigene Theorie auf.
Daß unsere Gesellschaft repressiv sei, ist aber keine Prämisse, sondern - spätestens seit der Entdeckung der Psychoanalyse und der Psychosomatik - eine wissenschaftlich unbestreitbare Erkenntnis, hinter die wir nicht mehr zurückgehen können, wenn wir uns nicht dem Verdacht aussetzen wollen, philosophische Reflexion mit Weltanschauung zu verwechseln. Daß die Repression - also die Unterdrückung der menschlichen Triebe, Wünsche, Hoffnungen und Chancen - "fortschreite", ist zwar nicht im ganzen, aber doch partikular evident: Seit etwa der Zusammenhang zwischen Organisation und Repression entdeckt ist, ist auch diese Behauptung alles andere als eine Prämisse. Allenfalls könnte man sagen, es sei eine normative Prämisse, Repression für etwas Schlechtes zu halten; sie könne ja auch etwas Gutes sein. Aber auch hier sind die Dinge so einfach nicht. Daß für uns Repression etwas Schlechtes, Änderungswürdiges ist, ist nicht eine willkürliche Setzung, weil die Verfasser Sozialisten oder Liberale wären, sondern ein objektives Ergebnis dessen, was wir als den modernen Prozeß der Demokratisierung bezeichnen können. Bestimmte, hiermit zusammenhängende Normen sind zwar nicht in einem philosophisch-logischen, aber im geschichtlichen Sinne vorgegeben. Die normative Ablehnung der Repression ist also höchstens in dem Sinn eine Prämisse, wie unser ganzes Grundgesetz eine solche ist. Aus all dem folgt: Wer heute irgendeine pädagogische Theorie schreibt, die die Tatsache der gesellschaftlichen Repression nicht ernst nimmt, schreibt eben keine rational kontrollierbare Theorie mehr.
Dabei ist es völlig gleichgültig, was die "Praktiker" in der "Erziehungswirklichkeit" selbst über sich und ihre Arbeit denken. Wenn etwa ihre Vorstellungskraft es nur bis zur Weltanschauung bringt, kann man natürlich untersuchen, woher das kommt. Aber man kann von dem, was sie meinen, nicht einfach abhängig machen, ob eine Theorie stimmt. Natürlich sollte es eine intensive "pädagogische Tatsachenforschung" geben, die es für den Bereich der Jugendarbeit praktisch nicht gibt. (Auch der Jugendbericht der Bundesregierung basiert in seinem II. Teil nicht auf Tatsachenforschungen, sondern auf den Meinungen derer, die die Arbeit tun.) Aber abgesehen davon, daß ich mir unter pädagogischer Tatsachenforschung außer exakten sozialwissenschaftlichen und lernpsychologischen Untersuchungen nichts Rechtes vorstellen kann und daß solche Untersuchungen, wenn sie exakt sind, eine sehr geringe Reichweite haben und um so mehr einer philosophisch präzis kontrollierten Interpretation bedürfen, abgesehen davon hängt die Verständigung der "in der Erziehung verantwortlich Tätigen über ihre Erziehungstätigkeit" (S. 222) weniger von der pädagogischen Tatsachenforschung und auch weniger von ihren Meinungen über ihre Praxis ab, als vielmehr davon, ob sie bereit sind, sich von der
469
Befangenheit ihrer eigenen Praxis zu lösen und sich auf ein von außen kommendes Gedankenangebot diszipliniert und aktiv einzulassen. Verständigung über eine kollektive gesellschaftliche Praxis - sei es Erziehung, Sozialpolitik oder Außenpolitik - ist nur möglich auf der Basis, daß alle Beteiligten wissenschaftliche Erkenntnisse und Ergebnisse akzeptieren und deren`Interpretation (also deren "Philosophie") nach rational kontrollierbaren Regeln gemeinsam betreiben. Damit ist keineswegs einer Wissenschaftsmagie das Wort geredet. Auch dann werden vielmehr genug Parteiungen, Meinungen, Hoffnungen und Wünsche übrigbleiben, die nicht ohne weiteres mit einer rationalen Analyse zu bewältigen sind. Wer aber Wissenschaftlichkeit und Rationalität nicht als Voraussetzung einer Verständigung betrachtet, also zum Beispiel die Ergebnisse der Psychoanalyse und Psychosomatik für die Analyse der Jugendproblematik ignoriert, mit dem kann man sich nicht mehr "verständigen", sondern den kann man nur noch im politischen Sinne "tolerieren".
Selbstverständlich ist Walter Hornstein von einer solchen Ignorierung weit entfernt; denn er fordert später ausdrücklich - und mit vollem Recht - , die pauschale These von der Repression im Hinblick auf die Jugendproblematik zu konkretisieren und zu modifizieren (S. 225). Aber das zeigt doch wohl auch, daß er vorher den Begriff der Prämisse nicht allzu ernst gemeint haben kann.
Nun scheint mir sehr bemerkenswert, daß Hornsteins Überlegungen dadurch in Schwierigkeiten geraten, daß sie eine zu geringe Reichweite haben; und dies wiederum liegt daran, daß er von einer geschichtlich gewordenen erziehungswissenschaftlichen Position ausgeht, deren wichtigster Gegenstand "nicht die nach wie vor höchst kontroversen Ziele und Leitvorstellungen, sondern gewisse erzieherische Grundprobleme (waren), die sich überall in ähnlicher Weise stellten". So sei auch in der Jugendarbeit "eine Verständigung in der Ebene der gemeinsamen praktischen Aufgabe viel leichter möglich als in derjenigen der Zielvorstellungen".
"Verständigung" der Pädagogen scheint für Hornstein ein Selbstzweck zu sein. Aber warum sollen sich eigentlich die Sozialisten und die Katholiken über die Jugendarbeit verständigen? Würden sie nicht beide mit staatlichen Mitteln finanziert, so gäbe es nur beliebige Gründe dafür (zum Beispiel den Erfahrungsaustausch); so aber ist die Verständigung zwingend nötig geworden! Was bei Hornstein als bloßes Fachinteresse von Pädagogen erscheint, ist also in Wahrheit eine staatspolitische Notwendigkeit! Nur einer durch und durch entpolitisierten Erziehungswissenschaft kann es einfallen, politisierte Phänomene auf pädagogische Fachfragen zu reduzieren. Wenn das stimmt, dann müssen aber gerade die Zielvorstellungen Gegenstand der Theorie sein, denn die Bundesregierung muß vor dem Parlament verantworten, wofür und warum sie das Geld ihrer Jugendpläne ausgibt.
Zweitens muß eine solche Selbstbeschränkung unentwegt Ursachen mit Symptomen verwechseln. So wirft Walter Hornstein Mollenhauer eine "einseitig akzentuierte historische Herleitung der Jugendarbeit" vor (S. 224). Für ihn selbst hat sie "eine Wurzel in dem Gegensatz der Generationen, wie er zum erstenmal bei den Stürmern und Drängern auftritt. Von daher stammt ihr kulturkritischer und gesell-
470
schaftsreformerischer Impuls". Dabei ist doch mit Händen zu greifen, daß Hornsteins geschichtliche Erklärung zu kurz greift. Warum entstand denn gerade damals der Gegensatz der Generationen? Das ist keine geheimnisvolle Frage, deren Antwort man als Prämisse deklarieren müßte, sondern sie ist aus dem, was uns die historischen Wissenschaften heute zur Verfügung stellen, einigermaßen objektiv zu beantworten: als Folge solcher gesellschaftlichen Veränderungen, wie sie Mollenhauer zum Ansatzpunkt seiner historischen Analyse wählt.
Drittens kann sich Walter Hornstein die Struktur der Beziehungen von jugendlichen Bedürfnissen und vorgegebenen Inhalten offenbar nur so vorstellen, daß man entweder das eine auf Kosten des anderen ignoriert oder aber die jugendlichen Bedürfnisse zum bloßen Vehikel für von außen festgelegte Inhalte macht (S. 223 f.); im letzten Falle klärt etwa die Lernpsychologie, was in welchem Alter lernbar ist, und der Stoffplan wird danach gestuft. Wahrscheinlich wird die Schule aus Gründen ihrer Unterrichtsorganisation immer so verfahren müssen. Aber es ist auch eine andere Struktur der Inhalte denkbar, wie sie wohl wenigstens fragmentarisch allen vier Beiträgen unseres Buches zugrunde liegt: Man kann ein individuelles Bedürfnis oder verschiedene Probleme als Widerspiegelung eines objektiven Problems verstehen. Wenn ein Jugendlicher etwa mit seinem Problem der Sexualität nicht fertig wird, so ist das weitgehend eine Widerspiegelung der Tatsache, daß die Gesellschaft damit eben auch nicht fertig wird. Wenn ein 16jähriger politisch desinteressiert ist, so spiegelt das die Tatsache wider, daß es die Gesellschaft ja auch ist und so weiter. Indem ich also einem Jugendlichen bei der Lösung seines individuellen Problems helfen will, muß ich es ihm zunächst erklären; verzichte ich dabei auf die Bezeichnung des objektiven gesellschaftlichen Konfliktes, der sein Problem wesentlich konstituiert, so erhält er von mir im Grunde auch keine Hilfe, sondern allenfalls kostenlose moralische Ratschläge. Auf diese Weise käme man also zu einer ganz anderen Struktur des Verhältnisses von jugendlichen Bedürfnissen und objektiven Stoffen. Die Konsequenzen wären kaum abzusehen: Es gäbe keinen "Kanon" von Stoffen mehr; die Unterscheidung von "Jugend" und "Erwachsenen" würde bedeutungslos (im Begriff der Repression ist sie ohnehin nur noch graduell enthalten); die Vorstellung, Erwachsenwerden sei ein zeitlicher, entwicklungspsychologischer Prozeß, der vom Pädagogen sorgfältig gestuft wird, geriete ins Wanken; die Vorstellung von der Pädagogik als "normativer Wissenschaft" müßte modifiziert werden, denn "Aufklärung" liegt dann auf einer ganz anderen Ebene als "Tugend". Was immer das Ergebnis einer solchen Überlegung sein wird, sicher ist, daß die hier kritisierte Vorstellung von Walter Hornstein zunächst einmal nichts weiter als eine unzulässige Verallgemeinerung typisch schulischer Probleme und Lösungen ist.
Viertens schließlich wird niemand bestreiten, "daß das, was in inhaltlich festgelegten`Jugendverbänden der Jugend vorgelegt wird, Chancen der Ichfindung und Selbstverwirklichung darstellen könnte" (S. 225). Im Gegenteil: je mehr die Schule sich von den Ansprüchen einzelner gesellschaftlicher Gruppen emanzipieren muß, um so nötiger wird es, daß die Erwachsenenverbände in der Jugendarbeit ihre Position zur Geltung bringen und sich damit überhaupt der jungen Generation vorstel-
471
len können. Walter Hornstein kritisiert mit Recht, daß dieser Gesichtspunkt in den Beiträgen des Buches viel zu kurz gekommen ist. Aber auch darauf kann man doch nur kommen, wenn einem "eine Art Arbeitsteilung zwischen der Jugendarbeit und den anderen Erziehungsinstitutionen vorschwebt" (S. 225), wenn man das Verhältnis von Erziehung und Gesellschaft insgesamt in den Blick bekommt.
Wenn also die Berechtigung verbandsnaher Jugendarbeit grundsätzlich nicht bestritten werden kann, so liegen die Begründungen dafür doch noch keineswegs klar auf der Hand. Gewiß ist die Personwerdung zu einem guten Teil Identifikation mit Gruppen und deren Werten. Aber daran herrscht ja kein Mangel. Die junger Leute identifizieren sich ja unentwegt mit irgend etwas. Warum sollen sie sich gerade mit den Kirchen und nicht mit den Beatles identifizieren Warum mit einer Partei, deren Jugendarbeit vom Staat finanziert wird, und nicht mit einem rechtsradikalen Jugendbund? Erst bei solchen Konkretionen setzt die wahre Anstrengung der Theorie ein. Solche Konkretionen werden aber von keinem erziehungswissenschaftlichen Ansatz erreicht, der auf Zielkritik zugunsten der "Ebene der gemeinsamen praktischen Aufgabe" verzichtet. Auch in einer Demokratie können philosophische Probleme nur durch Nachdenken, nicht durch Abstimmungen gelöst werden.
Walter Hornstein argumentiert von einer erziehungswissenschaftlichen Position aus, die der Soziologie immer "Positivismus" vorgeworfen hat, wenn sie in ihren Untersuchungen das, was ist, mit dem identifizierte, was sein soll. Aber eine pädagogische Theorie, die auf Zielkritik verzichtet, steckt den positivistischen Wolf nur in den Schafspelz der "pädagogischen Verantwortung". Sie überläßt dann nämlich die Ziele solchen Mächten und Ideen, die keine andere Qualität als die der größten Durchsetzungskraft aufweisen`müssen. Gewiß ist das Verhältnis von Theorie und Praxis das komplizierteste Problem unserer Erziehungswissenschaft; aber sie wird es nicht lösen, wenn sie nicht ganze Jahrzehnte ihrer Wissenschaftsgeschichte so radikal in Frage stellt, wie das die meisten anderen Disziplinen - und gerade auch die Soziologie - längst getan haben. Gewiß ist pädagogische Tatsachenforschung heute unentbehrlich für eine pädagogische Theorie; aber ich muß nicht erst zahllose empirische Untersuchungen anstellen, um zu erkennen, daß diejenigen Momente einer Theorie, die nicht aus der Beschreibung der Praxis stammen, sondern an sie herangetragen werden, auch diejenigen sind, die allein diese Praxis kritisieren können. Im Gegenteil: wenn ich mir nicht vorher über diese Struktur einer Theorie im klaren bin, werden auch die empirischen Untersuchungen amateurhaft bleiben.
Die zentrale Schwierigkeit einer heute möglichen pädagogischen Theorie ist, ihre Reichweite sinnvoll zu begrenzen. Ist sie zu weit, so gerät man unentwegt in für die Lösung der Probleme unnötige theologische und weltanschauliche Grundsatzdebatten; ist sie aber zu gering, so wird sie immer hinter den jeweiligen Stand wissenschaftlicher Erkenntnis zurückfallen und zum Beispiel Symptome für Ursachen halten oder politische Phänomene als bloß pädagogische verkennen: sie wird zum besten Positivismus, den es je gab.
472
URL des Dokuments: http://www.hermann-giesecke.de/werke4.htm
Inhaltsverzeichnis aller Bände