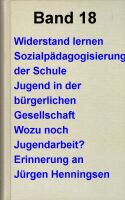 Hermann
Giesecke
Hermann
Giesecke
Gesammelte Schriften
Band 18: 1984 - 1985
© Hermann Giesecke![]() Inhaltsverzeichnis
aller Bände
Inhaltsverzeichnis
aller Bände
Zu dieser Edition
Dieser 18. Band meiner gesammelten Schriften enthält Arbeiten aus den Jahren 1984 und 1985. In diesem Jahr war ich (seit 1967) als Professor für Pädagogik und Sozialpädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Göttingen tätig. Nähere biographische Angaben finden sich in meiner Autobiographie Mein Leben ist lernen, Weinheim: Juventa Verlag 2000.
Die Texte sind nach ihrem Erscheinungsjahr geordnet.
Die Plazierung der Fußnoten wurde vereinheitlicht; sie befinden sich nun am Ende des jeweiligen Beitrags. Offensichtliche Druckfehler wurden korrigiert. Darüber hinaus wurden die Originale jedoch nicht verändert. Nachträgliche Anmerkungen des Herausgebers sind durch (*) oder durch ein Namenskürzel ("H.G.") gekennzeichnet. Um die Zitierfähigkeit der Texte zu gewährleisten, wurden die ursprünglichen Seitenangaben mit aufgenommen und erscheinen am linken Textrand; sie beenden die jeweilige Textseite des Originals.
Die
Beiträge werden von "1"
an nummeriert, die vorangehenden Arbeiten befinden sich in den früheren
Bänden.
![]()
Inhalt von Band 18
138. Widerstand lernen (1984)
139. Skeptische und engagierte Notizen über Pädagogik (1984)
140. Wozu noch Jugendarbeit? (1984)
141. Zum Gedenken an Jürgen Henningsen (1984)
142. Wozu noch "Politische Bildung" (1985)?
143. Wer braucht Freizeitpädagogen? (1985)
144. Jugend in der bürgerlichen Gesellschaft (1985)
145. Vorbehalte gegen eine Sozialpädagogisierung der Schule (1985)
146. Auch Lehrer lernen dazu (1985)
![]()
138. Widerstand lernen (1984)Zum Verhältnis von Pädagogik und Protest
(In: W. Hill (Hrsg.): Widerstand und Staatsgewalt. Gütersloh 1984, S. 103-113)
Die 1983 begonnene Aufstellung neuer Raketen hat den Widerstand einer breiten Friedensbewegung quer durch alle Generationen und Parteien hervorgerufen. Dabei geht es nicht nur um das Recht auf Meinungsäußerung und auf öffentliche Demonstration der politischen Überzeugung in dieser Sache, sondern auch um Handlungen, die teilweise gegen bestehende Gesetze verstoßen, wie Besetzungen von Gebäuden und Gelände oder die Sperrung von Zufahrtswegen. Diese Friedensbewegung ist aber nur das markanteste Beispiel für die in den letzten Jahren zunehmenden Versuche, politische oder administrative Entscheidungen oder auch bestehende Rechts- und Besitzverhältnisse nicht mehr einfach hinzunehmen, sondern die Entscheidungsträger durch die Mobilisierung von öffentlicher Gegenmacht zu beeinflussen; man denke etwa an Hausbesetzungen, die Anti-Atomkraft-Bewegung sowie ökologisch motivierte Proteste.
An den Demonstrationen gegen die Aufstellung neuer Raketen haben auch Lehrer und Schüler während der Schulzeit teilgenommen, was die Frage aufwarf, welche Rolle die Schule - und damit die Pädagogik überhaupt - im Rahmen derartiger Protestbewegungen spielen könne und dürfe. Darf die Schule zum innenpolitischen Widerstand ermuntern oder gar auffordern? Dürfen die Lehrer in solchen politischen Kontroversen einseitig Partei ergreifen, z. B. unter Berufung auf die hohe Moralität derer, die sich gegen die Aufstellung neuer Raketen wenden? Haben diejenigen
103
recht, die den sogenannten "linken" Pädagogen die Schuld für die Protestbereitschaft eines Teils der Jugend zuweisen? Oder wird hier wieder einmal die Macht der Pädagogik erheblich überschätzt, hat die Bereitschaft von Menschen zum Widerstand ganz andere Quellen, über die Pädagogen gar nicht verfügen können? Solche Fragen sind Grund genug, dem Verhältnis von Pädagogik und Widerstand etwas genauer nachzugehen.
Zunächst einmal gilt es zu sehen, daß jede Erziehung immer auch Erziehung zum Widerstand ist. Wer erzieht, hat dabei Ziele im Auge, an denen sich das Kind orientieren soll, und das schließt andere Ziele aus; denen soll es sich widersetzen. Um kulturfähig werden zu können, muß das Kind der Allgegenwärtigkeit seiner Triebe widerstehen und diese zu ordnen lernen. Der Katholik oder Protestant soll sich der Versuchung und der Sünde erwehren, der überzeugte Nationalsozialist sollte sich einmal vom Liberalismus und der parlamentarischen Demokratie fernhalten, der Kommunist soll den Einflüsterungen der kapitalistischen Propaganda nicht erliegen. Deutschlehrer erwarten, daß ihre Schüler sich nicht mit Schundliteratur identifizieren, Geschichtslehrer, daß sie keine Neonazis werden.
Die Beispiele ließen sich beliebig vermehren, und sie weisen alle in dieselbe Richtung: Wer erzieht, erzieht immer auch zum Widerstand, weil erzieherisches Handeln keine normative Gleichgültigkeit oder Beliebigkeit zuläßt. Das "Wozu" der Erziehung schließt immer auch ein "Wogegen" ein. Das Positive ist sozusagen ohne das Feindbild des Negativen nicht auszumachen.
Die in diesem Sinne erlernte Unterscheidung von "gut" und "böse", von "richtig" und "falsch" kann, wenn sie tief genug verinnerlicht wurde, in bestimmten Situationen zur Legitimation von Widerstand werden.
So war zum Beispiel für den Widerstand gegen das offensichtlich verbrecherische Nazi-Regime ein solcher moralischer Fundus unentbehrlich; er war insofern unproblematisch, als die moralische Rechtfertigung dafür kaum strittig
104
sein konnte, wenn man nicht schon innerhalb der moralischen Umwertungen des Nationalsozialismus gefangen war. Eine solche moralische Haltung kann aber unter anderen, etwa unter demokratischen Bedingungen, problematisch werden. Der Widerspruch zwischen den erlebten Realitäten und den rigorosen moralischen Ansprüchen an diese Realität, wie sie in der Erziehung verinnerlicht wurden, kann sogar so unerträglich werden, daß diese Spannung nur mit zur Not auch gewalttätigen Aktionen gemildert werden kann. Die Anfänge des linken Terrorismus bei uns hatten nicht wenig mit diesem Problem zu tun.
Die Beispiele zeigen ein unauflösliches Dilemma der Pädagogik. Einerseits ist eine erfolgreiche moralische Erziehung, die zur Identifikation mit dem Guten und zu einer entsprechenden Bildung des Gewissens führt, Voraussetzung sowohl für loyales bzw. Iegales gesellschaftliches Verhalten, wie auch für den Ungehorsam oder gar Widerstand gegen unmoralische politische Regimes wie den Nationalsozialismus. Andererseits kann eben diese Moralität aber auch zu falschen Schlußfolgerungen führen mit dem Ergebnis, daß gerade die moralischen Prinzipien, in deren Namen man antritt, dabei auf der Strecke bleiben. Die Erziehung - so läßt sich folgern - kann nicht über ihre Ergebnisse verfügen, also über das zukünftige Handeln der Erzogenen, und insofern kann es eine planmäßige Erziehung zum Widerstand gar nicht geben. Aus demselben Erziehungspotential erwachsen Anpassung und Loyalität wie auch Protest und Widerstand.
Aber Erziehung provoziert auch Widerstand gegen sich selbst. Kinder trotzen ihren Eltern, Schüler wenden sich gegen ihre Lehrer. Der Widerstand richtet sich hier gegen die Macht, die dem erzieherischen Handeln eigen ist. Widerstand zu leisten, sei es im Sinne der Erziehung oder sei es gegen ihre Ansprüche, und die dabei auftretenden Erfolge und Mißerfolge ertragen zu lernen, ist eine fundamentale Dimension der menschlichen Existenz. Wer sich nicht wenigstens gelegentlich den Ansinnen anderer widersetzen kann,
105
ist im Extremfall lebensunfähig. Erziehung setzt den Widerstand des Kindes notwendig voraus, ein widerstandsloses Kind könnte nicht erzogen werden, sich aber auch nicht von alleine entwickeln. Der nimmermüde Jasager ist eine Fiktion. Unsere Sozialität braucht die Balance von ja und nein.
Nun kennen wir jene dramatischen Konflikte, z. B. zwischen Vater und heranwachsendem Sohn, aus früheren Zeiten; die Literatur ist voll davon. Erwachsenidentität gewann der Sohn erst, wenn er in Auseinandersetzung mit seinem Vater eine neue Position zu ihm gefunden oder den nicht selten endgültigen Bruch heraufbeschworen hatte; manch sensibler Junge blieb dabei auf der Strecke, beschädigt für den Rest seines Lebens.
Solche Konfliktkonstellationen werden immer seltener. Die Dominanz des Vaters wie überhaupt die Erziehungsmacht der Familie ist im Vergleich zu früher gebrochen; Vater und Mutter versuchen, ihre Rollen im Umgang mit dem Kind einander anzugleichen; statt offener Auseinandersetzungen im Erziehungsprozeß findet sich immer häufiger psychologisierendes Verständnis. Aber der Widerstand des Kindes, den es zu seiner Selbstvergewisserung braucht, läuft dabei mehr und mehr ins Leere. Die moderne Erziehung postuliert nicht nur die rechtliche, sondern auch die psychologische Gleichheit von Vater- und Mutterrolle, und statt der offenen Auseinandersetzung psychologische Konfliktlösungsstrategien. Mit der Durchsetzung der "vaterlosen Gesellschaft" und mit der Abschwächung des traditionellen Erziehungsverhaltens verringert sich die Fähigkeit zu überzeugter Loyalität ebenso wie die komplementäre Fähigkeit zum Widerstand, wird weniger Widerstand gelernt als vielmehr Integration, oder, wie es im Jargon bezeichnenderweise heißt: das "Sicheinbringen" in soziale Beziehungen. Das Nein wird als Kränkung empfunden; als Ideal gilt ein soziales Beziehungsmuster, in dem so lange Kompromisse verhandelt werden, bis alle ja sagen kön-
106
nen.
Jene alte, strenge bürgerliche Erziehung hat also nicht nur - wie oft einseitig betont wurde - die sogenannten "autoritären Persönlichkeiten" hervorgebracht, sondern auch einen Teil jener Männer und Frauen, die gegen den Nationalsozialismus Widerstand geleistet haben.
Pädagogisch nachdenklich aber sollte machen, daß die moderne psychologisierende Erziehung Loyalität und Widerstand erschwert, weil sie entsprechende Konfliktsituationen zu meiden trachtet, sie vorweg künstlich entschärft oder z. B. in der Schule die "Subkultur" der Schüler mit ihrem Jargon und mit ihren Aufmüpfigkeiten zu integrieren versucht. Vieles deutet sogar darauf hin, daß manche jugendliche Rebellion der Gegenwart so zu verstehen ist, daß hier Widerstandserfahrung, die in der vorausgegangenen Erziehung nicht oder nicht genügend gemacht werden konnte, auf neuer Ebene gleichsam nachgeholt wird. Die Auseinandersetzung mit der Polizei ist endlich einmal eine Ernstsituation, kein pädagogisches "Als ob", hier kann man seine Kräfte messen, wird Widerstand sinnlich erfahrbar und vermag so etwas wie Selbstwertgefühl und Selbstbewußtsein zu vermitteln. Hier wird also in die öffentliche Sphäre verlagert, was jedenfalls früher sich im Erziehungsbereich zu vollziehen hatte, wodurch der falsche Eindruck eines politischen Engagements entsteht.
Tatsächlich jedoch sind solche Rebellionen unpolitisch, eine Verlängerung privater Probleme in die Öffentlichkeit. Die meisten Rebellionen verlaufen ja auch sanfter, ohne nennenswerte öffentliche Aggressivität: In der Drogen-, Sekten- und Neonazi-Szene. Da ist außer vagen Postulaten nichts von politischer Innovation zu entdecken oder gar von argumentativ durchformulierten politischen Konzepten, es sind Fluchtnischen derjenigen, die Widerstand nicht haben lernen können. Mangelnde Erziehung zum Widerstand kann also selbst zum öffentlichen, zum politischen Problem werden.
Das gilt auch noch für einen anderen Zusammenhang. Früher war die Erziehung nur mittelbar gesamtgesellschaftlich
107
orientiert, unmittelbar dagegen an gesellschaftlichen Teilkollektiven: Man wurde z. B. als katholischer oder evangelischer Christ erzogen, als Mitglied der jüdischen Gemeinde oder im Rahmen der sozialistischen bzw. kommunistischen Arbeiterbewegung, im Milieu des Offizierskorps oder des liberalen Bildungsbürgertums. Ein wichtiger Teil der Identität erwuchs aus einer solchen Zugehörigkeit.
Diese Kultur- und Erziehungsmächte sind inzwischen mehr oder weniger wirkungslos geworden, zwischen dem einzelnen und der Gesamtgesellschaft gibt es kaum noch stabile kulturelle Milieus, die allen gemeinsame Kultur ist die von den Massenmedien verbreitete. Gewiß leben wir alle noch außerhalb der Familie in vielfältigen sozialen Beziehungen, aber die sind - außer im Beruf - wählbar, somit austauschbar und fördern deshalb keine eigentümliche kulturelle Identität mehr.
An diesem Prozeß der Emanzipation von den Teilgemeinschaften und der Individualisierung ist die Pädagogik nicht unschuldig. Das moderne pädagogische Ideal nämlich, das sich in den letzten zweihundert Jahren durchsetzte, ist der mündige Mensch, der durchaus sich zugehörig fühlen mag zu einer sozio-kulturellen Gemeinschaft, wie etwa einer Kirche oder der Arbeiterbewegung, von dem aber erwartet wird, daß er dennoch sein Urteil selbständig findet, wenn es sein muß, auch gegen die Mehrheit seiner Gesinnungsfreunde.
Aufklärung hat also in diesem Sinne tatsächlich eine entfremdende Tendenz, und der Intellektuellenhaß nicht nur der Nazis kommt nicht von ungefähr. Gegenwärtige pädagogische Leitvorstellungen wie "Selbstbestimmung" und "Selbstverwirklichung" stellen den einzelnen Menschen und sein Wohlergehen in den Vordergrund, soziale Gemeinschaften werden nur in dem Maße akzeptiert, wie sie diesem Ziel nicht widersprechen. Wer den Eindruck hat, sich in seiner Familie nicht verwirklichen zu können, kann sich leicht scheiden lassen und damit die Familie auflösen. Die Zugehörigkeit des einzelnen aber zur Gesamtgesell-
108
schaft, ohne das Zwischenstück der Teilgemeinschaften, bleibt abstrakt, vermag die sinnliche Anschaulichkeit der alten Teilsozialitäten, der alten Milieus nicht auszustrahlen. Die demokratische Verfassung von Staat und Gesellschaft wird nicht als ein bestimmter, substantieller Inhalt erlebt, für den sich Identifikation und Engagement lohnen, sondern als ein Bündel von formalen Regeln und Mechanismen. Die politischen Parteien sind von Weltanschauungsparteien zu pragmatischen Machteroberungs- und Machterhaltungsapparaten geworden. Die soziale Kälte und Entfremdung in unserer Gesellschaft, über die insbesondere viele junge Menschen klagen, hat wesentlich etwas damit zu tun, daß für viele die verbindlichen Teilgemeinschaften fehlen, die nicht einfach abwählbar sind und die mehr repräsentieren als soziale Beziehungen auf Abruf.
Für unser Thema ist diese Entwicklung in zweierlei Hinsicht von Bedeutung. Einmal zeigte gerade der Widerstand gegen den Nationalsozialismus, daß das Potential dafür aus der Zugehörigkeit zu solchen Teilgemeinschaften erwuchs. Da leisteten nicht abstrakte Staatsbürger Widerstand, sondern z. B. Katholiken, Protestanten, Sozialisten, Kommunisten, Offiziere. Ihr moralisches Fundament reichte zwar über ihre Teilgemeinschaft, sogar über das eigene Volk hinaus, aber diese allgemeinen moralischen Prinzipien wurden anerzogen im Rahmen der jeweiligen Teilgemeinschaften und dort in erster Linie praktiziert.
In vielen Fällen war ein solcher Widerstand nur durchzuhalten, weil man der politischen Isolierung durch die Verfolger das Bewußtsein von der Solidarität der anderen entgegensetzen konnte. Berichte aus den Konzentrationslagern haben das vielfach belegt, etwa am Beispiel des Katholiken, der sich in der Gemeinschaft seiner Kirche geborgen wußte, oder des Kommunisten, der an seine draußen weiterkämpfenden Genossen dachte.
Andrerseits markierte die Zugehörigkeit zu einer Teilgemeinschaft auch Grenzen der Widerstandsbereitschaft. Charakteristisch dafür ist der bekannte Satz von Martin
109
Niemöller, daß man geschwiegen habe, als die Juden und die Kommunisten von der Gestapo abgeholt wurden, und als man selber abgeholt wurde, da habe es niemanden mehr gegeben, der dagegen hätte protestieren können. In der Tat gehörte es zur Taktik der nationalsozialistischen Machtergreifung, die Teilgemeinschaften auseinanderzudividieren, die Hoffnung entstehen zu lassen, es ginge nur gegen die Juden und Kommunisten, die anderen hätten nichts zu befürchten. Die Distanz der Teilgemeinschaften - vor allem der Kirchen - zum Staat trübte den Blick dafür, daß nur das rechtzeitige Eintreten für die Rechte jedes Bürgers auch für die eigene Teilkultur die erfolgreichste Form von Widerstand gewesen wäre.
Heute dagegen wird politischer Widerstand kaum noch von der moralischen Basis solcher Teilgemeinschaften aus geleistet - eine Ausnahme ist vielleicht die Evangelische Kirche im Rahmen der Friedensbewegung; im Gegenteil dient der Protest vielfach dazu, solche Gemeinschaften neu zu stiften. Dafür sind die Auseinandersetzungen mit der Polizei eine Art von Symbol, um das herum neue Solidaritäten und die unmittelbare Gruppe übersteigende Sozialitäten entstehen könnten. Dieser Gedanke spielte schon in der Anfangsphase des linken Terrorismus eine Rolle und läßt sich seitdem bei allen Protestformen beobachten.
Deshalb sind die Symbole von großer Bedeutung, wie überhaupt die Gesetzesübertretungen hier in erster Linie symbolischen Sinn zu haben scheinen: Das besetzte Haus als Symbol für eine neue, noch undeutliche Form des Zusammenlebens; die gesperrte Militärzufahrt als Symbol für den falschen Weg usw. Derartige Symbole und einprägsame Slogans sind anschaulich genug, um potentielle Anhänger zu solidarisieren, sie sind offen genug, um im übrigen verschiedene Positionen unter einen Hut bringen zu können, und sie zeigen zudem, daß das Ziel noch unklar ist, sich sozusagen noch nicht in präzise Texte fassen läßt.
Anhängerschaft für politischen Protest und Widerstand erwächst also nicht mehr in erster Linie aus einer bestimmten
110
Interessenlage - wie etwa beim früheren Klassenkampf - und auch nicht aus dem Potential einer bedrohten Teilgemeinschaft, vielmehr kann sie sich nur über den Anspruch der moralischen Überlegenheit konstituieren.
Genau das ist aber das Problem: So richtig es ist, daß ohne moralisches Fundament zumindest demokratische Politik in der Luft hängt, so problematisch war immer schon die Moralisierung der Politik im ganzen; denn Moralismus neigt zum "Entweder-Oder", praktische Politik aber bedarf des "Sowohl-als-auch".
Die irrationalen Elemente vieler gegenwärtiger Protestformen - die Sehnsucht nach neuen Gemeinschaften, nach der Geborgenheit einfacher Lebensverhältnisse, nach Selbstdarstellung, nach Kompensation für eine permissive Erziehung, nach unmittelbarer Erfüllung der eigenen Wünsche - sind auch eine Gefahr für das Funktionieren hochkomplexer gesellschaftlicher Mechanismen. Diese vertragen weder falsche Gefühle noch bloße Wünsche, deren Realisierbarkeit nicht überprüft wurde. Für die Sehnsucht nach Gemeinschaft und nach verläßlichen menschlichen Beziehungen ist nicht die Politik zuständig; die Trennung von öffentlicher und privater Sphäre ist vielmehr eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren komplexer Gesellschaften. Die gegenwärtigen Protest- und Widerstandsbewegungen sind also keine im eigentlichen Sinne politischen Bewegungen, sondern kulturelle. Es geht nicht in erster Linie um die Korrektur politischer Entscheidungen, sondern um eine grundlegende kulturelle "Umkehr", um die Neudefinition von privaten und gesamtgesellschaftlichen Werten. Die breite Friedensbewegung wurde nicht ausgelöst durch die politisch-technische Frage, ob die neuen Raketen den Frieden wirklich mehr gefährden als die zahllosen schon vorhandenen; vielmehr war die Neuaufstellung ein Auslöser für die grundsätzliche Frage, welchen Sinn eigentlich ein Leben haben soll, in dem solche gewaltigen Ressourcen nicht zu seiner Verbesserung, sondern zu seiner ständigen Bedrohung verbraucht werden.
111
Auch die Startbahn West war weniger konkreter Gegenstand einer politischen Kontroverse, als vielmehr Anlaß für den breiten Ausbruch einer Stimmung gegen Überzivilisation und Ausbeutung der wenigen noch verbliebenen ökologischen Reserven.
Die Frage des Protestes ist nicht, ob diese oder jene politische Entscheidung richtig war, sondern wie man heute und in Zukunft leben will oder kann. Es geht um eine Kritik der leitenden Werte unseres politisch-gesellschaftlichen Systems, z. B. Arbeitszentriertheit des menschlichen Lebens, Wirtschaftswachstum und Technologieeinsatz um jeden Preis. Derartige Maximen für politisches Protestverhalten setzen die massenhafte Erfahrung von Wohlstand voraus, und sie wären noch vor zwanzig bis dreißig Jahren gar nicht denkbar gewesen; denn der Protest richtet sich ja gerade gegen jene gesellschaftlichen Wertvorstellungen, die den Massenwohlstand erst ermöglicht haben und von denen man befürchtet, daß sie ihn in Zukunft gefährden würden.
Die Erziehung der heute Lebenden und eben auch der Protestierenden hat jene Werte vertreten, die heute fragwürdig geworden sind. Insofern richtet sich der gegenwärtige Protest auch gegen die Erziehung, aber er unterstreicht eben auch noch einmal unsere These, daß die Pädagogik keine Macht über Loyalität und Widerstand hat.
Gleichwohl hat die Schule in diesem Zusammenhang eine wichtige Aufgabe. Ihre Funktion kann nicht sein, für die Regierungsmeinung oder für die Meinung des Protestes Partei zu ergreifen. Das verbietet schon die Tatsache, daß die staatlich monopolisierte Schule für alle Kinder da ist, nicht nur für die Kinder der einen oder anderen politischen Richtung, und daß sie insofern Konsens anzustreben hat. Sie hat ein Ort der Besinnung zu sein, in dem über politische Streitfragen sachlich nachgedacht werden kann. Sie vertritt keine politischen Positionen, sie läßt sie überprüfen - auch die der Lehrer und der Schüler. In ihr lernt man nicht politisches Handeln, sondern bestenfalls politisches Denken. Sie kann politischen Widerstand nicht initiieren
112
oder forcieren, aber sie kann ihn, wenn er manifest wird, zum Thema des Unterrichts machen. Sie kann die Welt außerhalb ihrer Mauern nicht besser machen, keine neuen kulturellen Milieus oder Gemeinschaften stiften, sie kann höchstens angemessene Vorstellungen über die gesellschaftliche Realität vermitteln. "Aufklärung" muß ihr Metier bleiben, auch wenn dadurch die Ausbildung von Gesinnungsgemeinden erschwert wird - sie könnten ja auch die falschen sein.
Das Ergebnis der Aufklärung aber bleibt unverfügbar: Sie kann Terroristen und Parlamentarier produzieren, Hausbesetzer und Polizisten, Befürworter und Gegner der "Startbahn West" - denn sie haben alle dieselben Schulen besucht.
113

139. Skeptische und engagierte Notizen über Pädagogik (1984)
(In: Deutsche Pädagogen der Gegenwart. Ihre Erziehungs- , Schul- und Bildungskonzeptionen. Bd 1, hrsg. v. Rainer Winkel, Düsseldorf 1984, S. 65-86)
Die Aufforderung, meine Vorstellungen zu wichtigen Problemen der Erziehungswissenschaft und Bildungspolitik zu formulieren, könnte zu rein additiven Thesen und Argumentationen führen. Um dies zu verhindern, muß ich einen übergeordneten Gesichtspunkt finden, der nach meiner eigenen Einschätzung konstitutiv für meine Vorstellungen ist, von dem her diese sich dann auch ordnen lassen. Dabei spielen natürlich auch biographische Erfahrungen eine Rolle, wie ich sie in den anschließenden "Biographischen Hinweisen" notiert habe. Das entscheidende Leitmotiv für meine pädagogische Arbeit ist - so glaube ich - einerseits eine gewisse Skepsis gegenüber aller planmäßigen pädagogischen Professionalität und gegenüber solchen erziehungswissenschaftlichen Konzepten und Theorien, die diese fördern. Andererseits geht von den Sachverhalten und Problemen der Pädagogik eine eigentümliche Faszination aus, die mich immer noch beeindruckt und motiviert. Von beiden Aspekten möchte ich sprechen, wobei mir Subjektivität gestattet sei - einmal, weil es sich dabei durchweg um unvollendete Überlegungen handelt, zum anderen, weil Subjektivität notwendigerweise ein Moment jeder Selbstdarstellung ist. Ich beginne mit den skeptischen Hinweisen.
Alle sogenannten "Bildungserlebnisse", an die ich mich erinnere, also jene Szenen, die einem rückblickend als für die eigene Identität fachlich oder symbolisch von Bedeutung erscheinen, haben nichts mit pädagogischer Professionalität zu tun, sondern nur mit Menschen, die etwas authentisch vertraten oder deren Haltung überzeugte. Damit will ich ausdrücken, daß ich mißtrauisch bin gegen die Pädagogik, insofern sie auf die Machbarkeit des menschlichen Geistes und der Persönlichkeit spekuliert. Ich kann mir nicht vorstellen, daß auch nur eine einzige wichtige menschliche Qualität - sei es ein Motiv, ein Gedanke, ein Gefühl - das Ergebnis der Planung anderer Leute ist. Viel eher sind es "ungewollte Nebenwirkungen" derartiger Absichten. Was wir pädagogisch planen, ist immer nur ein mehr oder weniger notwendiger Rahmen, gleichsam eine Bedingung der Möglichkeit dafür, daß sich etwas für die Entwicklung der Persönlichkeit Wichtiges ereignen kann. Aber die wirklich tiefergehenden Dimensionen, wie Sinnhaftigkeit und Wertbezug oder gar Identität, ergeben sich eher trotz dieses Rahmens als seinetwegen. Wenn ich zum Beispiel den Aufwand und die Subtilität betrachte, mit der heute sogenannte "didaktische Analysen" gemacht werden, dann frage ich mich, ob es nicht besser wäre, diesen Aufwand in das Studium der Sachverhalte zu stecken, so daß man mit diesen alle möglichen Strukturvariationen durchspielen kann, ein gutes Schulbuch zu benutzen und den Kindern gegenüber einfach ein normales Maß an freundlicher Zuwendung aufzubringen. Jede unnötige Pädagogisierung entfremdet uns den Sachverhalten und Realitäten wie den Menschen, vor allem trennt sie die Generationen, indem sie sachliche und menschliche Authentizität beseitigt oder behindert. Alle grundlegenden
66 (S. 65 ist Deckblatt, H. G.)
pädagogischen Probleme sind ja Sonderfälle allgemeiner menschlicher Probleme. Didaktisch zum Beispiel verhalte ich mich schon, wenn ich einem Fremden den Weg erkläre. Ich mache mir eine Vorstellung von seinen Vorkenntnissen (daß er zum Beispiel "rechts" und "links" unterscheiden kann) und versuche, mit meinen Informationen daran anzuknüpfen. Und wenn ich über ein didaktisches Problem in einer Anfängervorlesung spreche, dann mache ich das anders - in der sachlichen Struktur wie in der Vortragsweise - als wenn ich es zum Beispiel einem Experten erläutern möchte. Ich sage es in beiden Fällen nicht nur anders, ich sage auch etwas anderes. Indem ich dialogisiere, also das vermutete Vorverständnis des anderen in meinen Text einbeziehe, strukturiere ich ihn auch entsprechend. Didaktik ist nichts anderes als die Reflexion derart alltäglicher Vorgänge, sicher auch zu dem Zweck, sie zu verbessern. Aber ich sehe nicht, wie man daraus den Unterschied von "Fachwissenschaft" und "Fachdidaktik" konstruieren kann, es sei denn, man versteht zum Beispiel unter "Fachdidaktik Politik" "Politik für das Vorverständnis von Kindern". Nun will ja die "Fachdidaktik" den Kindern gar nicht nur etwas erklären, sondern sie tut dies von einem bestimmten Zweck her, nach dem das zu Erklärende ausgewählt und gedeutet wird. Je mehr die Pädagogik beziehungsweise die Didaktik an Bedeutung gewinnt, um so mehr treten diese Zwecke in den Vordergrund, nur über die Zwecke, nicht über die Sachverhalte kann sich die Pädagogik legitimieren. Das ist der entscheidende Unterschied: Jeder, der anderen etwas erklären will, handelt didaktisch, ob er das weiß oder nicht. Aber nicht jeder will dabei mehr oder anderes, als daß es lediglich verstanden wird. In der Pädagogik muß das zu Verstehende zum Beispiel erzieherisch wertvoll sein oder bildend wirken oder "Qualifikationen" hervorrufen. Allerdings gibt es hier wichtige Abstufungen.
Im alten Konzept der "Bildung" waren Sache und Zweck noch halbwegs miteinander versöhnt, der "Bildungswert" wurde in der Sache selbst gesucht, war Ergebnis einer eigentümlichen Form der Sachanalyse. In den Begriffen "Qualifikation" und "Lernziel" sowie in der curricularen Vorstellung, kognitives Lernen solle einem bestimmten Verhalten in bestimmten Situationen dienen, sind Sachverhalt und Zweck vollends auseinandergetreten, wird der Sachverhalt für die Zwecke unverhohlen verwertet. Natürlich wissen wir alle, daß es "die Sache" als solche nicht gibt, daß wir sie definieren müssen und daß diese Definitionen nicht zweckfrei sind, sonst würde Wissen unbrauchbar für die Meisterung des Lebens. Aber es ist ein Unterschied, ob dies je individuell geschieht oder in politischen Zusammenhängen, wo spezifische Legitimationen anzutreffen sind, oder in der Pädagogik beziehungsweise Didaktik. Ich glaube, die Pädagogik braucht als regulative Idee die Vorstellung von kultureller Objektivität, die sie zu vermitteln, aber in ihrer Substanz nicht anzutasten hat. Sonst wird sie, da sie Zwecke nicht selbst setzen kann, abhängig von politischen Moden und Mächten,
67
denen sie sich selbst bis in ihre wissenschaftliche Struktur hinein unterwerfen muß; denn "Praxis" ist ja nicht nur ein Tätigkeitsfeld, sondern auch ein politisches Entscheidungsfeld. Wenn pädagogische Berufspraxis der zentrale Inhalt des Studiums ist, dann folgt daraus zwingend, daß die für diese Praxis Verantwortlichen auch das Sagen über die Inhalte bekommen müssen. Dieser Prozeß ist längst im Gange, er wird nur noch gebremst durch die Maximen des "Karlsruher Urteils", und ich verstehe heute sehr viel besser als früher den Widerstand der Universitätsfächer gegen die Pädagogisierung. Der Prozeß der Pädagogisierung der Kultur, er wird zum Motor einer allgemeinen "Halbbildung" (Adorno). In der alten "Lehrerbildung" zum Beispiel ging es darum, daß der angehende Lehrer sich selbst bildet - unter anderem dadurch, daß er sich mit pädagogischen Problemen beschäftigt. Heute soll er schon "pädagogische Handlungskompetenz" erwerben, bevor er noch einen pädagogischen Gedanken durchbuchstabiert hat. Er wird zum Träger, zum Transporteur von Lernzielen und Kommunikationstechniken. Verräterisch ist da der Topos von der "Integration von Theorie und Praxis". Theorie - was immer das sein mag - soll nur so weit gelten, wie sie in einer bestimmten Praxis verwertet werden kann, wie sie in diesem Sinne integrationsfähig ist. Von "Integration" läßt sich aber nicht reden, wenn man auch das Widerspenstige und Utopische an Theorien ernstnehmen, sie zum Beispiel als regulative Ideen sehen würde. Einleuchtend an diesem Topos ist die Tatsache, daß im Akt des pädagogischen Handelns Zweck, Ziel, Mittel, Erfahrung und Wissen so kombiniert - nicht "integriert" - werden müssen, daß dieser Akt selbst als sinnvoll erscheinen kann. Das setzt aber gerade einen Reichtum an Vorstellungen und Wissen voraus, der als Potential für künftige Handlungen zur Verfügung bleiben muß und gerade deshalb vorweg nicht verwertet und integriert werden darf. Da zudem pädagogisches Handeln je individuelles Handeln ist, können die darauf konzentrierten geistigen Akte ebenfalls nur individuell geleistet werden, sie können also nicht "veranstaltet" werden oder als planmäßiges Ergebnis pädagogischen oder wissenschaftlichen Veranstaltungen entspringen. Genau dies aber wird suggeriert, wenn jene "Integration" zum Programm von Studienordnungen wird. Wird dies ernsthaft versucht, dann können nur pädagogische und politische Ideologien dabei herauskommen. Es gibt Dinge, die kann man lernen, aber nicht lehren, dazu gehört der Komplex des pädagogischen Handelns. Abgesehen davon gibt es "pädagogische Praxis" nicht nur an Schulen, sondern auch an Hochschulen und im Alltagsleben der Studenten. Wer im Seminar ein Referat hält, ist didaktisch tätig. Die Hochschule kann die künftige Berufspraxis nur sehr bedingt antizipieren. Je mehr sie dies versucht, um so mehr ignoriert sie sich selbst als pädagogische Praxis, es gibt an der Hochschule keine andere Praxis als ihre eigene. Das pädagogische Studium kann der künftigen Berufspraxis nur insofern zugute kommen, als es - die bisheri-
68
gen Erfahrungen der Studenten aufgreifend und ansprechend - ein Mindestmaß an sachbezogenen Vorstellungen und an sozialer Phantasie zu entwickeln vermag. Im übrigen sind transferierbar die beim Studium erworbenen formalen Fähigkeiten. Die Wende von der Lehrerbildung zur Lehrer-"Berufsausbildung" hat das Studium zwar nicht "praxisnäher" gemacht, aber seine Inhalte reglementiert und funktionalisiert. Gibt es aber wirklich irgend etwas in den Humanwissenschaften, das zu wissen einem Lehrer schadet? Und was nützt ihm wirklich und wer will das wissen? Meine Beispiele zum Komplex der Didaktik haben allerdings das Kernproblem unterschlagen. Sie haben unterstellt, daß im Normalfalle jemand etwas wissen will, daß er das Thema nennt, über das er informiert werden möchte. Das Problem der Didaktik ist aber in sehr vielen Fällen im Schulalltag, wie man Leuten etwas beibringt, was sie eben nicht wissen wollen, wofür sie sich zumindest in diesem Augenblick gar nicht interessieren. In dem Maße, wie Drohungen mit Züchtigung, Arbeitslosigkeit, Statusverlust oder Aufstiegssperre immer weniger fruchten, muß motiviert, etwas "in den Fragehorizont gebracht" und ein Arsenal von methodischen Einfällen in Anschlag gebracht werden. Didaktik wird hier zum massenhaft organisierten Versuch, Fragen zu beantworten, die nicht gestellt wurden - eine auch dann nicht sehr überzeugende Vorstellung, wenn man wie ich auch von der Notwendigkeit ausgeht, wenigstens einen Grundkanon an Wissen und Bildung jedem Kind zu vermitteln. Das kann ich hier im einzelnen nicht erörtern, aber ganz offensichtlich ist das "Zuckerbrot" der Didaktik, nämlich das Umschmeicheln der Motive, Interessen und Bedürfnisse des Kindes, in dem Maße gewachsen, wie die "Peitsche" des Lebenskampfes, also z. B. der sozialen Folgen von Lernunlust, zurückgenommen wurde. Man kann diesen Prozeß für einen Fortschritt an Humanisierung halten, aber wenn wir heute schon Studenten zum Studium motivieren wollen, die schließlich dazu nicht gezwungen sind, dann frage ich mich, ob dieser Prozeß der Pädagogisierung die Menschen wirklich glücklicher macht oder nur auf neue Weise wieder entmündigt.
Der Skepsis gegenüber einer allzu extensiven Pädagogisierung des Lebens - auch und gerade des Lebens in pädagogischen Institutionen - entspricht meine Distanz gegenüber "Verwissenschaftlichung" des pädagogischen Denkens. Die wissenschaftstheoretische Diskussion der letzten fünfzehn Jahre hat mich wenig berührt. Ihre einzig erkennbare Relevanz war die ideologische Polarisierung wissenschaftlicher Argumentationen. Ich konnte einfach nicht erkennen, welchen Nutzen diese Debatte für die Pädagogik als Wissenschaft, für ihr Studium sowie vor allem auch für die Lehrer und Sozialpädagogen haben sollte. Mein Ausgangspunkt ist, daß wir es in der Pädagogik mit einer Reihe von grundlegenden Problemen zu tun haben, die sich dem Handeln in pädagogischen Institutionen wie auch zumindest teilweise im übrigen Lebenszusammenhang stellen; diese gilt es zu erkennen
69
und zu beschreiben, wobei die benachbarten Wissenschaften - Psychologie, Soziologie, Politik - mit ihren einschlägigen Erkenntnissen als "Hilfswissenschaften" in Anspruch zu nehmen sind. Die Zahl dieser Probleme ist begrenzt, und sie lassen sich grob durch die zentralen Begriffe unserer Disziplin kennzeichnen: Sozialisation, Erziehung, Bildung, Didaktik und Methodik u. a. m.
Da der pädagogische Handlungszusammenhang, der da aufgeklärt werden soll, komplex ist, muß auch die pädagogische Theoriebildung bis zu einem gewissen Grade komplex bleiben. Was nützt es zum Beispiel dem Lehrer, wenn er viel über Lernmotive weiß, aber dabei die Wirkung von Gruppenstrukturen oder die Bedeutung der sozialen Herkunft seiner Schüler übersieht? Die Notwendigkeit einer "ganzheitlichen" Sicht des pädagogischen Handlungszusammenhangs ist das Ärgernis der Pädagogik in ihrem Verhältnis zu den anderen Wissenschaften, denn sie kann so dem Idealbild moderner Sozialwissenschaften nicht entsprechen. Vieles, was diese Wissenschaften erforschen, ist - auch wenn es sich um einschlägige Gegenstände handelt - für sich genommen gar nicht pädagogisch brauchbar, weil es entweder zu spezialistisch ist und damit einen zu kleinen Teil des komplexen Handlungsfeldes beleuchten würde, oder weil ganz einfach ein normaler Lehrerkopf nur eine begrenzte Aufnahmefähigkeit für Detailinformationen hat, wenn er sein Handlungsfeld im ganzen im Blick behalten will. Notwendigerweise ist pädagogisches Handeln letztendlich dezisionistisch, das heißt es gibt für eine konkrete pädagogische Entscheidung in einer bestimmten Situation, auch wenn man Einverständnis über das Ziel unterstellt, keine allgemein überzeugenden Gründe, mit denen etwa alle anderen möglichen Entscheidungen verworfen werden könnten. Man denke nur daran, wie viele gleich sinnvolle Möglichkeiten es gibt, ein Thema im Unterricht zu gestalten. Didaktik ist nicht die Wissenschaft von "richtigen" Lösungen, sondern vom Reichtum der Möglichkeiten. Weitgehend dezisionistisch geregelt sind auch die bürokratischen Rahmenbedingungen von Institutionen, wenn man die dafür gegebenen Begründungen unter die Lupe nimmt. Die wissenschaftliche pädagogische Reflexion kann nur in Extremfällen, wenn es zum Beispiel eindeutig um die Würde des Kindes geht, aber nicht im Normalbereich überzeugend zu eindeutig "richtigen" Entscheidungen führen, sondern nur die Wahrscheinlichkeit erhöhen, falsche zu vermeiden. Das gilt schon unter der Voraussetzung, daß es jeweils nur um ein bestimmtes Ziel geht. Tatsächlich jedoch geht es meist darum, mehrere Ziele zu berücksichtigen, die sich sogar widersprechen können und zwischen denen deshalb balanciert werden muß: In der Schule etwa um die Ziele Benoten und Fördern, Schülerinteressen aufgreifen und Lehrplan erfüllen. In solchen Fällen - und das sind die Normalfälle in der pädagogischen Berufspraxis - ist der Begriff der "richtigen" pädagogischen Entscheidung gegenstandslos, weil es für eine ausgewogene Balance von Zielen keinen
70
eindeutigen Maßstab geben kann. In unserer heutigen "berufsbezogenen" Lehrerausbildung wecken wir vielfach falsche Erwartungen, insofern wir den Studenten suggerieren, sie könnten bei uns "richtiges" pädagogisches Handeln lernen. Viel sinnvoller schiene es mir, eine pädagogische Handlungstheorie zu entwickeln, in der nicht die "richtige" Planung, sondern die angemessene Korrektur von Lernprozessen im Vordergrund steht.
Ich kann dieses Problem hier nicht vertiefen, sondern führe es nur zur Begründung meiner These an, daß weder eine Vermehrung des humanwissenschaftlichen Wissens noch auch schon eine Wissenschaftsstruktur, die der praktischen Denkstruktur des professionellen Pädagogen entfremdet ist, der Verbesserung der pädagogischen Praxis dienen können. Der Lebenszusammenhang selbst, in dem sich pädagogisches Handeln abspielt - wozu unter anderem die Nichtvermehrbarkeit von Zeit gehört - und die Tatsache, daß jeder Lehrer nur einen Kopf hat - was durch Teamarbeit nur sehr begrenzt kompensiert werden kann - setzt der pädagogischen Reflexion qualitativ wie quantitativ unüberschreitbare und relativ enge Grenzen. Die wissenschaftliche Pädagogik kann nur innerhalb dieser Grenzen wirken, so daß Bescheidenheit in den Ansprüchen angezeigt ist.
Die erwähnten Grundprobleme der pädagogischen Praxis lassen sich systematisch und historisch darstellen. Die historische Darstellung hat den Vorteil, daß sie Veränderungen deutlich machen kann, also zum Beispiel: Wie haben sich die Konzepte des pädagogischen Verhältnisses geändert und was drückt sich in diesen Veränderungen aus? Einmal läßt sich daran zeigen, wie unterschiedlich scheinbar gleichbleibende praktische Probleme definiert werden können, daß dies aus unterschiedlichen Begründungszusammenhängen erfolgen kann und daß der jeweilige Handlungsspielraum begrenzt ist durch politisch-gesellschaftliche Faktoren, durch allgemeine Verhaltens- und Denkerwartungen zum Beispiel oder durch regelrechte Tabus. Zeichnet man solche Entwicklungen nach, dann wird deutlich, wie sehr pädagogische Vorstellungen und Praktiken mit dem übrigen Alltagsleben verbunden sind, von der jeweils herrschenden "öffentlichen Meinung" mehr bestimmt sind als von den pädagogischen Klassikern. Zum andern vermag sich die Vorstellungskraft von der Unmittelbarkeit der Gegenwart und ihrer wissenschaftlichen Moden zu distanzieren, sie wird reicher und differenzierter.
Skepsis ist angebracht nicht nur wegen der instrumentellen Dimension der Pädagogik, nicht nur wegen der Überschätzung des Wissenschaftsbedarfs der außeruniversitären Praxis, sondern auch aus sozial-emotionalen Gründen. Wie alle Wissenschaften und Berufe, die auf der Hilfsbedürftigkeit der Mitmenschen basieren, steht auch die Pädagogik in der Gefahr, diese ihre Basis auszubeuten. Über das, was man früher einfach das "Diakonie-Syndrom" nannte, sind inzwischen subtile psychologische Untersuchungen entstanden, die etwa den "hilflosen Helfer" thematisieren. Das Problem ist klar: Wer beruflich mit Abhängigen und Schwächeren zu tun hat, neigt
71
dazu, eigene emotionale Bedürfnisse dabei zu realisieren, ja, möglicherweise ist dies oft sogar das (unbewußte) Motiv, um einen solchen Beruf zu wählen. Bis zu einem gewissen Grade ist die sozial-emotionale Dimension zweifellos nötig für ein pädagogisches Verhältnis. Man muß Kinder schon mögen und auch an ihren Gedanken und Gefühlen Gefallen finden können, man muß aus dem Umgang mit ihnen auch Befriedigung ziehen können. Problematisch wird es erst dann, wenn der professionelle Umgang mit Kindern und Jugendlichen solche Bedürfnisse kompensieren oder gar ersetzen soll, die nur an anderer sozialer Stelle zu befriedigen sind. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde viel über den "Eros" im pädagogischen Verhältnis diskutiert. Heute sind wohl andere Probleme wichtiger. Frustrationen zum Beispiel in der Partnerbeziehung und Kontaktschwierigkeiten in der Gleichaltrigengruppe sind problematische Hypotheken für den pädagogischen Bezug. Gerade heute, wo zumal in der jungen Generation das Fehlen menschlicher Wärme in den Alltagsbeziehungen schmerzlich empfunden wird, scheint der Wunsch nach befriedigenden menschlichen Alternativen nicht wenige zum pädagogischen Studium zu drängen. Kinder und Jugendliche lassen sich aber auch als Vehikel, ja sogar als Legitimation für politische und gesellschaftliche Interessen verwenden. Die gegenwärtige Jugenddiskussion ist voll von Beispielen.
Die darin liegenden Gefahren mögen so lange gering bleiben, wie sie Einzelfälle sind und als solche korrigierbar beziehungsweise aufklärbar bleiben. Erheblich größer wird die Gefahr, wenn solche Fehler sich gleichsam institutionell verfestigen können, beziehungsweise in Institutionen zur positiven Norm erhoben werden. Das geschieht zum Beispiel dann, wenn in unseren Schulen und Hochschulen "Beratung" aus dem übrigen Zusammenhang ausgegliedert wird, sei es, weil es auf diese Weise zusätzliche Personalstellen gibt, sei es, weil Studienregelungen so kompliziert sind, daß sie ohne ständige Beratungen nicht erfüllt werden können. Hier wird der pädagogische Akt der Beratung erzwungen und dem Berater ein weites Feld für seine sozial-emotionalen Bedürfnisse eröffnet. Ähnlich zu bewerten sind solche didaktischen Konzepte, die weniger auf der sachorientierten Beziehung zwischen Schüler und Lehrer basieren als vielmehr auf der kommunikativen Dimension im allgemeinen. Aber die Frage der "institutionellen Verfestigung" gerade auch der problematischen Aspekte der Pädagogik, stellt sich noch grundsätzlicher.
Unsere pädagogischen Klassiker waren ganz überwiegend "Einzelkämpfer", nämlich institutionell wenig abgesichert. Ihre pädagogischen Theorien entstanden aus ihrer praktischen pädagogischen Arbeit und zu deren öffentlicher Rechtfertigung, um zum Beispiel weiterhin Geld und das Wohlwollen der öffentlichen Meinung zu bekommen. Ihre bedeutendsten Texte waren im allgemeinen die "subjektiven", aus der unmittelbaren Arbeit heraus entstandenen. Sie ermöglichen uns, aus ihren Stärken wie aus ihren Fehlern
72
zu lernen. Solche Texte gibt es auch heute noch, zum Beispiel von Lehrern. Auch meine "Didaktik der politischen Bildung" ist noch so entstanden: als Resümee einer jahrelangen Tätigkeit in der außerschulischen Jugendbildung. Heute könnten "Klassiker" sich bei uns kaum noch entfalten. Die pädagogische Theorie wird an den Hochschulen gemacht und zwar nach deren Regeln, das heißt ohne daß ihr eine eigene pädagogische Praxis zugrunde liegt - obwohl die Hochschullehre selbst ja als eine solche gelten könnte. Nun werden die Probleme nicht mehr aus der pädagogischen Praxis heraus definiert, sondern von außen für sie. Früher wurden viele pädagogische Dissertationen von Lehrern oder Sozialpädagogen verfaßt, also aus der außeruniversitären Praxis heraus. Heute entstehen sie meist von vornherein im Rahmen der Universität, verfaßt von jungen Kollegen, die meist vom Abitur an auf der Hochschule geblieben sind und die nun pädagogische Felder als "Material" suchen. Sehr gut läßt sich diese Entwicklung und ihre Problematik an der Didaktik der Politik zeigen. Die ersten einigermaßen brauchbaren Konzepte entstanden Anfang der sechziger Jahre, verfaßt von Kollegen, die sie in Schule, Erwachsenenbildung oder Jugendarbeit auch selbst erprobt hatten. Inzwischen ist die politische Didaktik an den Hochschulen etabliert. In den siebziger Jahren entstanden zahlreiche Arbeiten über sie, denen anzumerken war, daß Didaktik nun ein "Gegenstand" war, der für die Produktionszwecke der Universität - zum Beispiel Dissertationen herzustellen - zu bearbeiten war. Viele solche Arbeiten waren für das, was sich praktisch im Begriff der Didaktik ausdrückt, ziemlich bedeutungslos, andere förderten lediglich die Politisierung beziehungsweise politisch-ideologische Klassifizierung der Didaktik. Nun wird wissenschaftliche Pädagogik in erster Linie für das System der Hochschule produziert, für den internen Wettbewerb der Fachkollegen. Und was wird aus der pädagogischen Praxis außerhalb der Hochschule? Hier spielen offensichtlich drei Sorten von Texten eine Rolle. Da sind einmal die Rechtstexte, die den Handlungsspielraum konstituieren und begrenzen - Gesetze, Richtlinien, Erlasse. In sie sind eingegangen erziehungswissenschaftliche und didaktische Fragmente sowie sogenannte "Erfahrungen" aus der Praxis selbst. Dann gibt es die offiziellen erziehungswissenschaftlichen Texte, die an den Hochschulen produziert werden und mit denen sich die angehenden Lehrer und Sozialpädagogen einlassen müssen. Aber in ihrer eigenen pädagogischen Praxis, in der Schule, im Kindergarten, im Erziehungsheim, da machen sie ihre eigenen Texte, in die manches aus der offiziellen wissenschaftlichen Pädagogik einfließen mag - vor allem das, was dem Ansehen des Berufes und seiner materiellen Anerkennung zugute kommt - die aber im übrigen von anderen Autoren bestimmt sind, von den Anforderungen des Alltags zum Beispiel oder von den Traditionen der Institution oder einfach auch von den anderen Kollegen. Diese "Texte" werden in der Regel nicht zu Papier gebracht und der Öffentlichkeit übergeben, und sie entziehen sich
75
auch wegen ihrer Komplexität weitgehend einer empirischen Erschließung. Praxis, das ist eine Fülle ungeschriebener Texte, wir wissen kaum etwas darüber, in welchem Maße diese ungeschriebenen, aber handlungsstiftenden Texte der pädagogischen Praktiker von der erziehungswissenschaftlichen Diskussion, die an den Hochschulen stattfindet, tangiert werden. Je mehr die pädagogischen Fachbereiche an den Universitäten gegenüber den Kollegen außerhalb der Universität zur "geschlossenen Gesellschaft" werden - auch in dem Sinne, daß der wissenschaftliche Nachwuchs immer mehr aus den eigenen Reihen kommt und immer weniger zum Beispiel aus den Schulen - wird die Entfremdung zwischen beiden pädagogischen Handlungsräumen fortschreiten. Auch das neue Wundermittel "Kommunikation" wird da nicht helfen, denn die Entfremdung ist keine persönliche, sondern eine wissenschaftsdidaktische.
Das Problem hatte die geisteswissenschaftliche Pädagogik schon gesehen, und sie versuchte ihre Texte vom Standpunkt des pädagogisch verantwortlichen Handelns aus zu schreiben, beziehungsweise aus der Bildungsperspektive des Kindes. Diesen Standpunkt kann eine sich sozialwissenschaftlich verstehende Erziehungswissenschaft nicht einnehmen, pädagogisches Handeln ist für sie lediglich ein Objekt der Forschung, und eine Kategorie wie "Verantwortung" ist kaum operationalisierbar.
Die "institutionelle Verfestigung" des pädagogischen Denkens führt unter anderem dazu, daß die Kritik am eigenen System ausgeblendet wird. Das gilt weniger im Hinblick auf die fachliche wissenschaftliche Diskussion, wohl aber bildungspolitisch.
Was in dieser Hinsicht richtig oder falsch ist, was "fortschrittlich" oder "reaktionär", wird immer weniger durch die Qualität der wissenschaftlichen pädagogischen Diskussion entschieden und immer mehr durch Resolutionen erziehungswissenschaftlicher Fachverbände beziehungsweise entsprechender Gewerkschaften, kurz: durch Politik. Diese enge Verflechtung von wissenschaftlicher Pädagogik und gesellschaftlicher Interessenvertretung ist höchst problematisch, weil damit die pädagogische Argumentation öffentlich unglaubwürdig wird, als Ausdruck einer Art von intellektueller Gewerkschaft für partielle Interessen erscheinen muß. Für die Zukunft müßte wieder sorgfältig zwischen den pädagogischen und den bildungspolitischen Perspektiven unterschieden werden. Die Pädagogik als Wissenschaft kann keine politische Verantwortung übernehmen, wohl kann und soll sie bildungspolitische Gegebenheiten und Konzepte unter Offenlegung des Maßstabs kritisieren. Verschwindet diese Trennung, dann wird die wissenschaftliche pädagogische Argumentation und Kritik zur bildungspolitischen Illoyalität innerhalb des eigenen Betriebes, beziehungsweise umgekehrt vermag der Gruppendruck Konformität zu erzwingen. Was wäre zum Beispiel, wenn die institutionell etablierte "Fachdidaktik" sich in dieser Form als Irrtum herausstellen sollte, daß die Prämissen, auf denen sie beruht, sich als nicht haltbar erweisen? Sie gründet sich ja
74
wesentlich auf die Zwecke, denen die sachliche Erschließung dienen soll. Wie nun, wenn diese Zwecke nicht mehr legitimierbar wären? Eine daran anknüpfende Grundlagendiskussion würde im Hagel von Resolutionen und Beschlüssen ersticken. Wenn Fachdidaktik und Fachwissenschaft sich gegeneinander abgrenzen, und wenn dies durch institutionelle Maßnahmen, zum Beispiel durch Prüfungsordnungen, auch noch untermauert wird, dann droht die Gefahr, daß die Fachdidaktik sich eine problematische Profilierung suchen muß. Schon heute sind Erklärungen zu Ausbildungsfragen voll von Leerformeln wie "pädagogische Handlungskompetenz" oder "Integration von Theorie und Praxis", die der Diskussion im Grunde entzogen sind und unter deren Schutz sich gleichwohl berufliche Partialinteressen, als plausible Zwecke getarnt, durchsetzen, die Sinn und Form des Studiums in erheblichem Maße bestimmen und Variationen kaum noch zulassen. Sie sind gleichsam institutionspolitisch vor wissenschaftlichen Diskussionen geschützt. Ähnlich problematisch können Studienordnungen sein. Um ihre Formulierungen wird ja zäh zwischen den hochschulpolitischen Gruppen gerungen, weil jede so viel von den eigenen Vorstellungen wie möglich durchsetzen möchte. Aber man muß sich darüber im klaren sein, daß jede inhaltliche Festlegung ein Studierverbot für anderes bedeutet - unter der Voraussetzung, daß die Studienzeit nicht vermehrt werden kann - und daß die Zwecke und Ziele des Studiums und die daraus abgeleiteten wissenschaftsdidaktischen Konsequenzen nicht der wissenschaftlichen Diskussion und Kritik entzogen werden dürfen.
In den letzten fünfzehn Jahren ist die Pädagogik von der Soziologie und Psychologie geradezu überwältigt worden, und sie hat versucht, sich dagegen zu behaupten, indem sie sich in eine als Sozialwissenschaft zu verstehende Erziehungswissenschaft umtaufte. Der ursprüngliche Gedanke war wohl, daß die anderen Grundwissenschaften zur empirischen und systematischen Aufhellung der pädagogischen Probleme beitragen sollten, wie sie sich aus der Sicht des Handelns stellen. Herausgekommen ist dabei eine je eigentümliche Definition des pädagogischen Handelns. Unter soziologischem Aspekt, so, wie er sich durchgesetzt hat, ist pädagogisches Handeln entweder politisches Handeln, insofern die je ablaufende "Sozialisation" nur durch Veränderung der diese beeinflussenden Bedingungen gebessert werden kann, oder Reproduktion und Verstärkung der gegebenen Sozialisationswirkungen; "Bildung" wird zur "Qualifikation", also ihres Anteils an Innerlichkeit, Nutzlosigkeit und Sinnhaftigkeit beraubt zugunsten präzis beschreibbarer Leistungsfähigkeiten an Sachen und Menschen. Von den an sich möglichen psychologischen Einflüssen hat sich weitgehend durchgesetzt die Vorstellung eines pädagogischen Handelns, das für vorgegebene Ziele die sozial-emotionalen und unbewußten Widerstände zu überwinden beziehungsweise zu nutzen weiß.
Es ist eben diese Umdefinition des pädagogischen Handlungsbegriffes, die
75
das Kernproblem ausmacht, aus dem die meisten anderen geradezu zwangsläufig sich ergeben. Die anderen Grundwissenschaften sind nicht zu "Hilfswissenschaften" für pädagogische Fragestellungen geworden, sondern umgekehrt hat sich die Pädagogik in Soziologie und Psychologie weitgehend aufgelöst.
Dagegen möchte ich gern festhalten, was mich nach wie vor an "meiner" Pädagogik fasziniert.
1. Pädagogische Probleme sind für jeden Menschen existentielle Fragen von hoher persönlicher Bedeutung. Sie betreffen unseren Alltag, den Umgang der Generationen, das Leben der Eltern, das Heranwachsen unserer Kinder, und sie sind verbunden mit tiefgehenden Erfahrungen der Freude, der Trauer, der Angst und der Hoffnung. In der Pädagogik sind wir Opfer und Täter zugleich. Wer sich mit diesen Fragen beruflich beschäftigen darf, kann dabei ständig an seiner Identität arbeiten, er wird selbst unweigerlich zum Gegenstand seiner Studien.
2. Pädagogik ist jedermanns Alltagshandeln. Jeder bringt also Erfahrungen darüber mit. Pädagogik zu lehren heißt also nicht, in Neuland einzuführen, sondern eher: Bekanntes bewußtmachen, ordnen, erweitern, vertiefen, differenzieren, es mit systematischen Überlegungen, mit empirischen Forschungsergebnissen oder historischen Varianten konfrontieren, so daß zur bisherigen Erfahrung eine produktive Distanz entsteht. Mit anderen Worten: Pädagogik ist ein Bildungsfach par excellence, sie sollte allgemeines Schulfach werden - schon deshalb, weil es kaum ein anderes Schulfach geben dürfte, das derart zur Reflexion des Alltagslebens zwingt. Pädagogische Handlungen sind - auch bei unseren Klassikern - keine große Taten, die Geschichte machen könnten - Geschichte macht nur das, was Politiker daraus machen - sondern relativ alltägliche, die immer gleich an menschliche Grenzen stoßen: Da ist etwa das Kind, das der Macht oder der besseren Einsicht der Erwachsenen ausgeliefert ist, der Vater, der seiner Erziehungsfunktion in der "vaterlosen Gesellschaft" ratlos gegenüber steht, der Sozialpädagoge, der bemerkt, daß er seine Fürsorgefälle weniger heilt als verwaltet, der Lehrer, der entdeckt, daß er seine Aufmerksamkeit und seine Förderung nie allen Schülern gleichermaßen zuteil werden lassen kann. So gesehen ist Pädagogik eine sehr menschliche Wissenschaft und Praxis, eher eine Sache des leisen Nachdenkens als der lauten Polemik.
3. Für die Pädagogik ist die didaktische Dimension konstitutiv, das heißt sie ist ihrem eigenen Sinn nach auf eine möglichst weite Verbreitung ihrer Einsichten und Erkenntnisse angewiesen. Was wären ihre Erkenntnisse wert, wenn sie nicht für Lehrer, Sozialpädagogen und Eltern formuliert würden? Sie konstituiert sich durch diese Aufgabe des "Zwischenhandels". Verbannt in den Produktionskreislauf der Universität wäre sie nichts als Philosophie, Soziologie oder Psychologie "aus zweiter Hand". Auch die Hochschullehre selbst ist von dieser didaktischen Dimension bestimmt, und
76
es ist schon faszinierend zu erleben, wie dieselben Texte (zum Beispiel über das "pädagogische Verhältnis") nicht nur individuell, sondern auch generationentypisch auf gänzlich verschiedene Vorerfahrungen treffen. Was zum Beispiel die 68er Generation interessierte beziehungsweise betroffen machte - zum Beispiel die politisch-ideologischen Implikationen - interessiert heute kaum noch jemanden. Heute stehen die menschlich-elementaren, die vitalen und emotionalen, also die eher irrationalen Momente im Mittelpunkt des Interesses. Hält man es didaktisch für geboten, jeweils alle wichtigen Aspekte des Themas zur Geltung zu bringen, so muß man bei jeder Generation andere Akzente setzen. Derartige Veränderungen in den pädagogischen Vorerfahrungen signalisieren zugleich Wandlungen in der pädagogisch-politischen Kultur überhaupt. Der Umgang mit jüngeren Generationen in der Schule wie in der Hochschule enthält eine wichtige geistige und menschliche Chance zur Überprüfung von Positionen und Intentionen, eine Chance, ständig dazuzulernen. Wie groß immer der Wissensvorsprung des Lehrenden sein mag, über die Erfahrung des Jüngeren kann er nicht verfügen, und die gibt ihm eine relativ selbständige Position auch in der wissenschaftlichen Diskussion. Das läßt, auch wenn die Gegenstände sich ständig wiederholen, die wissenschaftliche Arbeit interessant bleiben.
77

140. Wozu noch Jugendarbeit? (1984)
(In: deutsche jugend, H. 10/1984, S. 443-449)
(Der folgende Text ist die leicht überarbeitete Fassung eines Vortrags, gehalten am 8. September 1984 in der Evangelischen Akademie Loccum.)
Auf den ersten Blick scheint die Titelfrage geradezu abwegig zu sein. Haben wir nicht genug Probleme in und mit der jungen Generation, zum Beispiel Jugendarbeitslosigkeit, mangelhafte Integration ausländischer Jugendlicher, abweichende jugendliche Subkulturen von der Drogenszene bis zum Neonazismus?
Niemand wird dies bestreiten; aber es bleibt die Frage, ob dies Aufgaben der Jugendarbeit sind, jedenfalls wenn man sich an den herkömmlichen Maßstäben orientiert. Die sozialpädagogische Versorgung von Randgruppen war niemals zentrale Aufgabe der Träger der Jugendarbeit, sondern der Wohlfahrtsverbände. Das schließt nicht aus, daß zum Beispiel Jugendverbände auch in Notsituationen sozialpädagogische Aufgaben zeitweilig übernahmen (zum Beispiel in den Jahren vor 1933), aber ihre eigentliche Aufgabe war das nicht. Sie bestand vielmehr darin, sogenannten "normalen" Jugendlichen ein "jugendgemäßen Leben" zu ermöglichen, ihnen in der Freizeit interessante Lernangebote zu machen, sie an einen Erwachsenenverband politisch und ideell zu binden.
Gewiß gibt es dies alles auch heute noch, aber doch wohl mit abnehmender Tendenz. Vor allem aber: die neuen Bewegungen in der jungen Generation (Friedensbewegung, ökologische Bewegung, Alternativen) artikulieren sich außerhalb der etablierten Jugendarbeit, scheinen ihrer nicht zu bedürfen; eine Ausnahme ist hier vielleicht die Evangelische Kirche, aber wenn ich recht sehe, öffnet sich die Kirche im ganzen diesen neuen Bewegungen, ohne daß dies ein zentraler Kern ihrer Jugendarbeit wäre. Die etablierte Jugendarbeit scheint randständig geworden zu sein, wie zumindest ein Teil der jungen Generation überhaupt; Grund genug, sich einige Veränderungen in der Jugendarbeit bewußt zu machen, bevor wir nach ihrer Zukunft fragen.
443
Funktionswandel jugendlicher Freizeit
Die erste Veränderung betrifft den gesellschaftlichen Status der Jugendlichen überhaupt. Vom Anfang der bürgerlichen Jugendbewegung an bis etwa Mitte/Ende der fünfziger Jahre war der Jugendstatus als Präludium des Erwachsenenstatus gesellschaftlich verankert. Wichtige Erwachsenenprivilegien (Sexualität; Freizeitautonomie) blieben Kindern und Jugendlichen vorenthalten und diese galten nicht als selbständige öffentliche Subjekte (zum Beispiel mit eigenen politischen Interessen), sondern als vor den vollen Ansprüchen der Erwachsenen (Berufsarbeit) und vor den Zumutungen der Erwachsenenwelt (Jugendschutz) zu schützende Personen, deren Beaufsichtigung, Kontrolle und gesellschaftliche Vertretung im wesentlichen die Familie übernahm. Die Angebote der Jugendarbeit waren hier ein Spielraum, dessen Grenzen kontrolliert blieben, der aber doch ein gewisses Maß an autonomer Sphäre bedeutete. Jugendarbeit hatte also in dieser Struktur durchaus eine emanzipatorische Funktion. Gerade dies war vielfach die Attraktivität der Jugendarbeit, daß sie nämlich einen relativen Auszug aus dem Alltag von Familie, Schule und Beruf bedeutete mit eigentümlichen Erfahrungs- und Erlebnismöglichkeiten wie jugendlicher Gemeinschaft, Experimente mit dem anderen Geschlecht usw.
Diese Kombination von Schutz und produktiven Entwicklungsangeboten ist heute weitgehend entfallen. Unsere Kultur ist generationsunspezifisch geworden (Beispiel Fernsehen) und die Erwachsenenprivilegien Sexualität und Freizeitautonomie werden heute vielfach "kampflos" schon in der späten Kindheit selbstverständlich. In dem Maße aber, wie dieser Prozeß fortschreitet, entfallen auch die traditionellen Motive und Voraussetzungen für Jugendarbeit: die traditionelle Jugendarbeit hatte zur Voraussetzung eine relativ starke Integration des Jugendalters, seine gesellschaftliche Kontrolle und seine Definition als Objekt pädagogischer Bemühungen.
Diese Vergesellschaftung des Jugendalters - so möchte ich diesen Prozeß nennen - wird unterstützt und forciert durch eine Egalisierung der traditionellen kulturellen Milieus im Rahmen der Freizeitkultur. Die alten kulturellen Milieus (Bildungsbürgertum; Kirchen; Arbeiterbewegung) haben demgegenüber ihre Bedeutung verloren, vermögen keine kulturellen Maßstäbe mehr zu setzen, an denen sich junge Menschen orientieren, mit denen sie sich identifizieren könnten. Die weltanschaulichen "Grundrichtungen" der Erziehung, die als erzieherisch unverzichtbar in den fünfziger Jahren galten und lange zur Diskriminierung der "offenen", eben weltanschaulich nicht gebundenen Jugendarbeit führten, sind weitgehend wirkungslos geworden. Die Jugendlichen wie auch die Erwachsenen sind als Individuen gleichsam "gesamtgesellschaftlich unmittelbar" geworden: die kulturellen Einheitswirkungen der Massenmedien treffen nicht mehr auf kollektiv verbindliche Deutungsmuster, die die Informationen und Normen zu interpretieren und ihnen damit Sinn zu geben vermögen. Jugendarbeit war ja von Anfang an eine spezifische Form der Freizeitgestaltung, die sich deutlich und nicht selten auch polemisch gegen gesellschaftliche Konventionen abgrenzte: Volkslied statt Schlager, Wandern statt Touristik, Volkstanz statt Tanzstunden-Tanz, Theater statt Kino, Selbermachen statt Kaufen usw. Die Geschichte der Jugendarbeit als eines spezifischen Freizeitangebotes ist aber die Geschichte zahlloser Niederlagen gegen die Erwartungen und Angebote jener egalisierenden Massen- und Konsumkultur. Die Angebote der Jugendarbeit wurden immer weniger konkurrenzfähig, sie können sich teilweise nur dadurch noch halten, daß sie es billiger machen: Disco im Jugendheim, subventionierter Sozialtourismus usw. Seit spätestens Mitte der fünfziger Jahre findet sich die Klage, daß die Jugendlichen, die sich nun auch etwas leisten können, eine Konsumhaltung an den Tag legten und die Angebote der Jugendarbeit an dem maßen, was ihnen der kommerzielle Sektor bot. Ein wichtiges Datum in diesem Zusammenhang ist die Erfindung und Verbreitung der Rock'n'Roll Musik Mitte der fünfziger Jahre. Mit ihr und den entsprechenden Folgewirkungen - Tänze, Moden usw. - begann die kommerzielle
444
Ausbeutung des Jugendalters, der die Jugendarbeit mehr oder weniger erliegen mußte - sei es durch Anpassung, sei es durch Untergang. Neu daran war, daß zum ersten Mal eine Unterhaltungsmusik für ein jugendliches Publikum gemacht wurde, während bis dahin Unterhaltungsmusik und Tanzschlager nicht für eine bestimmte Generation angeboten wurden.
Fazit: Die Jugendarbeit hat im Freizeitsystem keinen eigenen Fundus mehr, von dem her sie ihre besondere Bedeutung gewinnen könnte.
Herkömmliche Legitimationen sind ausgereizt
Das erklärt auch ihre eigentümliche Theorielosigkeit in der Gegenwart, ihren Praktizismus. Nun muß "Theorie" nicht unbedingt erziehungswissenschaftliche Theorie sein. Die entstand erst Anfang der sechziger Jahre und hatte einen durchaus partikularen, um nicht zu sagen berufspolitischen Hintergrund. Erziehungswissenschaftliche Theorien brauchten diejenigen, die - akademisch gebildet - als Hauptamtliche tätig wurden und ihre vom Herkömmlichen abweichenden Konzepte und Maßnahmen gegenüber Trägern und Geldgebern rechtfertigen mußten. Dies war auch ein Grund für die zeitweilige Beliebtheit antikapitalistischer Theorien in der Jugendarbeit; denn diese eigneten sich vorzüglich dazu, den eigenen beruflichen Status politisch wie pädagogisch gegenüber konkurrierenden Ansprüchen wie Schule und Politik abzugrenzen und herauszuheben.
Abgesehen von derartigen wissenschaftsorientierten Theorien fehlt der Jugendarbeit auch inzwischen eine "Theorie" im Sinne einer von der Öffentlichkeit zugeschriebenen allgemeinen Bedeutung. Nach 1918 zum Beispiel wurde trotz der finanziellen Notlage der Jugendarbeit große öffentliche Aufmerksamkeit geschenkt, einfach weil der nachwachsenden Generation eine solche Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Das hatte im wesentlichen zwei Gründe: Einmal sollte die Jugend geschützt werden vor den als negativ eingestuften Einflüssen der kommerziellen Freizeitangebote (Kino, Vergnügungsgewerbe) und demgegenüber zu einem positiven, nämlich "jugendgemäßen" Freizeitverhalten animiert werden. Der zweite Grund war prinzipieller: Nach dem verlorenen Krieg setzte man die Hoffnung auf eine nationale Erneuerung in hohem Maße auf die Jugend, deren "Pflege" deshalb im besonderen nationalen Interesse liegen mußte. Diese Hochschätzung des Jugendalters führten die Nationalsozialisten auf ihre Weise bekanntlich fort.
Nach 1945 fürchtete man die Jugend und setzte zugleich erneut Hoffnungen auf sie. Die Furcht galt dem Weiterleben der Naziideologie in der jungen Generation, die Hoffnung der Vorstellung, daß gerade die junge Generation fähig und bereit sein möge, den neuen demokratischen Prinzipien und Verhaltungsweisen zu folgen. Dieser politische Impetus war das entscheidende Motiv für die relativ zügige Wiederbelebung der Jugendarbeit nach 1945. Als dieses Motiv Ende der fünfziger/Anfang der sechziger Jahre mehr und mehr gegenstandslos wurde - die "skeptische Generation" (Schelsky) hatte mit der Naziideologie nichts mehr im Sinn, sondern genoß die Vorteile der demokratischen Staats- und Gesellschaftsordnung, ohne sich besonders dafür zu engagieren - verlegte sich die Legitimation der Jugendarbeit auf den Bildungsaspekt, keineswegs nur auf den politischen. Dabei spielte bereits die schon erwähnte Professionalisierung eine Rolle, denn abgesehen von den sozialistischen Jugendverbänden, bei denen "Bildung" im Sinne von Vorbereitung auf das sozialistische Leben und Handeln von Anfang an eine bedeutende Rolle spielte, ging es in der bürgerlich-kleinbürgerlichen Tradition der Jugendarbeit nie um Bildung, sondern um die erzieherische Bedeutung einer bestimmten Form des Gemeinschaftslebens, also eher um so etwas wie "funktionale Erziehung", die nur am Rande verbalisiert und so gut wie gar nicht theoretisiert wurde. Nun - Anfang bis Mitte der sechziger Jahre - entstand die Vorstellung von Jugendarbeit als einer "dritten Erziehungs- und Bildungsinstitution", neben Familie und Schule. In der Tat schienen die Felder der Jugendarbeit hier große
445
Chancen zu enthalten, waren sie doch - im Unterschied zur Schule - gekennzeichnet durch Freiwilligkeit der Teilnahme, einen offenen "pädagogischen Bezug" und minimale Reglementierungen im Hinblick auf Inhalte und Methoden. Der Selbst- und Mitbestimmung im Lehren und Lernen schien ein weiter Spielraum offenzustehen.
Daß dieses Konzept dennoch nur begrenzten Erfolg hatte, hatte sicher eine ganze Reihe von Gründen, von denen einige schon erwähnt wurden (Egalisierung des Jugendstatus mit dem Erwachsenenstatus; der Sieg der massenmedial verbreiteten Freizeit- und Konsumkultur). Hinzu kommt, daß die Schule sich veränderte, Methoden und Kommunikationsformen der Jugendarbeit aufnahm und ihren didaktischen Blick von den Sachdimensionen auf die Beziehungsdimensionen lenkte.
Wenn diese Tendenz anhält, könnte die paradoxe Situation entstehen, daß die Jugendarbeit morgen mit Bildungsformen Erfolg hat, die sie gestern noch an der Schule kritisiert hat: Wer in der Schule die Beziehungsfaxen dicke hat und ohne solche Umschweife zur Sache kommen möchte, findet sich vielleicht demnächst in entsprechenden Bildungsangeboten der Jugendarbeit wieder.
Fazit: Die Jugendarbeit hat gegenwärtig keine überzeugende "Theorie", weder im wissenschaftlichen noch im gesellschaftlichen Sinne, kein tragfähiges Selbstverständnis, wozu sie eigentlich da und nütze sein könne.
Und das hat wesentlich damit zu tun, daß unsere Gesellschaft für ihre Zukunft - im Unterschied zu früheren Zeiten - des jugendlichen Potentials nicht mehr zu bedürfen glaubt. Jugend erscheint heute eher als ein lästiger kollektiver Sozialfall, als eine randständige Gruppe, die irgendwie mit durchgefüttert werden muß. Das sieht man deutlich am gegenwärtigen Umgang mit der Jugendarbeitslosigkeit: Früher galt sie nicht nur als arbeitsmarktpolitisches statistisches Problem, sondern als eine entwicklungspsychologische, also pädagogische Katastrophe in jedem Einzelfall.
Verlust an kreativer Vielfalt
In diese Theorielücke ist die Pädagogisierung, vielleicht genauer: die Sozialpädagogisierung der Jugendarbeit gestoßen. Die zunehmende Professionalisierung der Jugendarbeit hat einige Probleme verursacht, die wir uns klarmachen sollten. Wie schon gesagt, wurde sie nötig in dem Maße, wie die Jugendarbeit sich als eigentümliche Erziehungs- und Bildungsinstitution verstand. Mit einer solchen Zielsetzung waren die herkömmlichen ehren- und nebenamtlichen Helfer, sofern sie nicht ausgebildete Pädagogen waren, überfordert. Ein wichtiger Vorteil der Professionalisierung ist zweifellos die damit verbundene Institutionalisierung, die immerhin eine finanzielle Mindestausstattung garantiert. Die Nachteile dieser Entwicklung sind vor allem folgende:
- Die professionellen Pädagogen sind in ganz anderem Maße abhängig von ihren Trägern und Geldgebern als ehren- und nebenamtliche Mitarbeiter; insofern ist die Professionalisierung der Jugendarbeit das Vehikel ihrer Bürokratisierung, die wiederum den ursprünglichen Freiraum der Jugendarbeit erheblich beschnitten hat. Die Rechnungshöfe sind inzwischen die heimlichen Direktoren der Jugendarbeit geworden.
- Früher war die Jugendarbeit für die meisten professionellen Pädagogen ein Durchgangsstadium, in dem man einige Jahre tätig war, in dem man eine Menge Erfahrung sammeln konnte, die man dann in den eigentlichen pädagogischen Berufen (Sozialarbeit, Schularbeit, aber auch in der Verwaltung) verwenden konnte. Jedenfalls war klar, daß man Jugendarbeit nur für eine relativ kurze Zeit seines Berufslebens betreiben konnte. Die gegenwärtige Arbeitsmarktlage zwingt jedoch dazu, den einmal erworbenen Arbeitsplatz möglichst lange festzuhalten, was ganz unausweichlich zur Verringerung von Spontaneität und Kreativität und zu einer Arbeitnehmer-Mentalität - striktere Trennung von Arbeit und Freizeit - und somit im Endergebnis zu einer Verschulung führt.
- Die Jugendarbeit bietet das an, was die dort tätigen Profis können. Sind die Profis Pädago-
446
gen, so heißt das, daß sie ihre Qualifikationen weniger von bestimmten Sachkenntnissen her einschätzen als von ihrer Beziehungsfähigkeit zu den Jugendlichen her. Ihr Selbstbewußtsein resultiert nicht daraus, daß sie etwas können, was andere nicht können, zum Beispiel ein Motorrad reparieren, ein Gedicht interpretieren, einen Fernsehfilm analysieren, Gitarre spielen, das Grundgesetz oder Hitlers Machtergreifung erklären. Vielmehr beruht das professionelle Selbstbewußtsein darauf, daß man nach bestimmten psychologisch-pädagogischen Regeln und Maximen mit anderen, zum Beispiel mit den Jugendlichen umgehen kann, zum Beispiel Konfliktlösungsverfahren einbringen und menschlich verständnisvolle Gespräche führen kann. Ich halte diese Fähigkeiten gerade in der Jugendarbeit für ungemein wichtig, aber wenn sich dieser sozialpädagogische Typus einseitig durchsetzt, dann wird die Vielfalt der Möglichkeiten ungemein reduziert. Es liegt nahe, daß dieser Typus den Erwartungen der Sozialpolitik, randständige Gruppen möglichst zu beschäftigen und sie möglichst unauffällig zu halten, durchaus entgegenkommt. Andererseits ist dieser Typus besonders anfällig für eine Überidentifikation mit den Meinungen, Wünschen, Interessen und Bedürfnissen seiner Partner, eben weil sein berufliches Selbstbewußtsein in hohem Maße auf Anerkennung durch die Partner, auf deren positive Rückmeldungen angewiesen ist.
- Damit ist ein letzter Aspekt der pädagogischen Professionalität bereits angesprochen: nämlich die Tendenz zur ständigen Expansion der Pädagogisierung. Wer als Student bzw. als Lehrer in seiner eigenen Freizeit zum Beispiel eine Kinderfreizeit leitet, verhält sich bis zu einem gewissen Grade defensiv, d. h. er ist froh, wenn vieles ohne ihn von selbst läuft. Wer dagegen so etwas im Rahmen einer hauptamtlichen Tätigkeit macht, neigt viel eher dazu, sich für überflüssig zu halten oder ein schlechtes Gewissen zu bekommen, wenn die Kinder sich auch ganz gut ohne ihn amüsieren.
Verallgemeinert gesagt: Die pädagogische Profession drängt dazu, zu planen, zu organisieren, Freiräume durchzugestalten, anstatt sich auf das Arrangement von Bedingungen und Voraussetzungen zu beschränken, im Rahmen derer die anderen ihr gemeinsames Leben selbst gestalten können. Die Sozialpädagogisierung der Jugendarbeit führt fast unausweichlich dazu, die jugendlichen Partner von vornherein als defizient zu definieren, als mit Mängel behaftet, die man beseitigen müsse; das aber hat Folgen für das "pädagogische Verhältnis": Die Pädagogen bekommen eine Dominanz, die nicht aus ihrer fachlichen oder sonstigen Qualifikation resultiert, sondern eben aus der vorgängigen Definition ihrer Partner, was insofern die Chancen des pädagogischen Feldes Jugendarbeit gefährden muß.
Teilweise reagiert das sozialpädagogische Selbstverständnis darauf mit der These, daß "Normalität" und "Unnormalität" nicht mehr klar zu unterscheiden seien, daß vielmehr angesichts der bedrohlichen gesellschaftlichen Verhältnisse und Entwicklungen mehr oder weniger alle Menschen zu einer defizienten Existenz gezwungen seien. Abgesehen davon, daß diese These eine Totalisierung des sozialpädagogischen Denkens und Handelns zur logischen Folge hat - ähnlich sind gewisse psychoanalytische Deutungen einzuschätzen, nach denen wir alle in unserer frühen Kindheit mehr oder weniger kaputtgemacht worden seien - kann keine Gesellschaft und keine soziale Gruppe bei Strafe ihrer Identität und Handlungsfähigkeit ohne die Vorstellung existieren, sie sei alles in allem "normal", was einschließt, ein gewisses Maß an persönlicher wie gesellschaftlicher Problematik ebenfalls als "normal" zu erklären.
Ist Jugendarbeit anachronistisch?
Fazit: Die gesellschaftlichen Voraussetzungen für die überlieferte Jugendarbeit sind weitgehend entfallen, die Jugendarbeit, wie wir sie seit den Erfindungen der bürgerlichen Jugendbewegung kennen, ist historisch gegenstandslos geworden.
Weitgehend aufgehoben sind vor allem der spezifische Jugendstatus und die spezifischen kulturellen Normen; die Folge ist eine große Verunsi-
447
cherung hinsichtlich des Selbstverständnisses und eine theorielose, wenn auch keineswegs folgenlose Professionalisierung. Dies muß nun keineswegs heißen, daß eine Jugendarbeit, die sich nicht von vornherein als Randständigen-Arbeit versteht, künftig keine Chance mehr hätte. Zunächst einmal werden die Erwachsenenorganisationen fortfahren, auf dem Markt des vergesellschafteten Jugendalters um ihren Nachwuchs zu werben. Und sie werden dabei - wie bei jeder anderen Werbung auch - sich ihrem Publikum anpassen müssen.
Von den Jugendlichen aus gesehen wird jedes Nachdenken über die künftige Jugendarbeit wohl von folgenden Fragen ausgehen müssen: Gibt es Bedürfnisse und Erwartungen, die vom alltäglichen Freizeitsystem nicht oder nur ungenügend befriedigt werden? Gibt es pädagogische oder politische Gründe dafür, diese Bedürfnisse und Erwartungen ernst zu nehmen? Und wie, auf welchem Wege und mit welchen Mitteln kann man das tun?
Eine hinreichende pädagogische Begründung ist schon, wenn Menschen etwas lernen wollen - das ist nicht nur kognitiv gemeint - das ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten steigert.
Aber so simpel diese Fragen erscheinen mögen, so sind sie doch sehr schwer für die Zukunft zu beantworten. So scheint die gegenwärtige Technik- und Zivilisationsfeindschaft alte Ideen der Jugendarbeit wieder lebendig zu machen: Selbermachen statt Kaufen, das Erlebnis emotionaler Gleichgestimmtheit statt individualisierender und in diesem Sinne entfremdender analytischer Rationalität. Aber niemand weiß, ob nicht die nächste junge Generation in einigen Jahren wieder ganz andere Bedürfnisse artikuliert. Die Orientierung an den jeweils geäußerten Bedürfnissen und Erwartungen allein kann kein stabiles Selbstbewußtsein für die Jugendarbeit begründen.
Vielleicht kommen wir weiter, wenn wir das Problem der Identität angesichts kultureller Mehrdeutigkeit zum Zentrum der Überlegungen machen. Dieses Problem ist ein epochales und tritt uns beim alten Wandervogel ebenso entgegen wie in der Gegenwart. Den Begriff Identität meine ich hier in einem umgangssprachlichen, erfahrungsorientierten Sinne: Identität hat ein Mensch, der sich befriedigend die Fragen beantworten kann: Wer bin ich? Was kann ich? Wozu bin ich da? Dies schließt die Beantwortung des Gegenteils mit ein: Wer bin ich nicht bzw. will ich nicht sein? Was kann ich nicht? Wozu bin ich nicht da? Und das epochale Problem besteht darin, daß die Beantwortung dieser Fragen nicht mehr einfach durch die Identifikation mit einem Kollektiv - zum Beispiel Kirche oder Arbeiterbewegung - zu finden ist, sondern weitgehend aus der eigenen Innerlichkeit heraus erfolgen muß. Unsere klassischen Jugendtheorien gingen davon aus, daß das Jugendalter mit diesem Problem seine besonderen Schwierigkeiten habe. Aber auch das hat sich geändert: Stichworte wie Midlife-crises und die Zahl der Scheidungen zeigen an, daß es in der Biographie Erwachsener zumindest Phasen gibt, die ähnlich problematisch sind.
Daraus mag sich der Hinweis ergeben, daß die Jugendarbeit vielleicht gut daran tut, wenigstens gelegentlich das Getto der Gleichaltrigkeit zu durchbrechen und generationsübergreifende Angebote der Bildung, der Besinnung, des Gesprächs zu machen. Vermutlich ist es kein Zufall, daß die großen gegenwärtigen politisch-kulturellen Bewegungen (Friedensbewegung, ökologische Bewegung) generationsübergreifend sind. Mit scheint, daß die Grenzen zwischen Jugendarbeit und Erwachsenenbildung immer fließender geworden sind und noch werden müssen, und manches spricht dafür, die Gettoisierung des Jugendalters nicht noch pädagogisch zu verschärfen. Die kulturelle "Gleichschaltung" der Generationen enthält auch neue Chancen für ihre Beziehungen.
Die Geschichte der Jugendarbeit zeigt, daß Prognosen über Erfolge oder Mißerfolge und damit über künftige Bedürfnisse und Erwartungen Jugendlicher immer problematisch waren. Das gilt auch für die Gegenwart. Die Jugendarbeit bleibt Teil der Freizeit- und Konsumkultur, und sie kann nur durch Probieren und Experimentieren herausfinden, wo ihre Chancen, wo
448
ihre Nischen im künftigen kulturellen Milieu liegen könnten. Der Hinweis auf die Identitätsproblematik kann dafür nur ein allgemeines Leitmotiv sein.
Aber es legt doch zwei Perspektiven nahe: Einmal die Chancen, die auch heute noch im Charakter der "experimentellen Gesellungsform" liegen - möglicherweise generationsübergreifend; es gibt in der gegenwärtigen jungen Generation ein unübersehbares Bedürfnis nach menschlich verbindlichen, sozusagen "authentischen" Gesprächen und Auseinandersetzungen mit Älteren - ohne Status- und Rollenbegrenzung, ohne Sieger und Verlierer, ohne "Lernziele" usw. Die Jugendarbeit kann Situationen anbieten, in denen das wirklich möglich ist.
Zum anderen erscheint mir die Jugendarbeit als Ort der außerschulischen "Freizeitbildung" nach wie vor plausibel, wo man zusammen mit anderen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben kann, die sich schlicht dadurch rechtfertigen, daß sie Spaß machen. Ich möchte schließen mit vier Warnungen an die künftige Jugendarbeit:
- Ich warne vor der weiteren Sozialpädagogisierung der Aufgaben der Jugendarbeit. Die Arbeit mit Benachteiligten oder sozial abweichenden Gruppen ist nicht Aufgabe der Jugendarbeit, sondern sozialpädagogischer Berufe und Träger; sie hat eine spezifische Organisations- und Finanzierungsform und eine spezifische Definition der Klientel zur Voraussetzung, die, auf die Jugendarbeit übertragen, deren Untergang zur Folge hätte.
- Ich warne vor der weiteren Sozialpädagogisierung der Mitarbeiter in der Jugendarbeit. Die Jugendarbeit braucht ein ausgewogenes Verhältnis von Haupt- , Neben- und Ehrenamtlichen und eine entsprechende Aufteilung der Personalkosten. Dies ist kein Plädoyer für Stellenstreichungen, sondern für einen überlegten Einsatz der Mittel wie der hauptamtlichen Mitarbeiter. Nur über die nebenamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter, die etwas von Sachen verstehen - Handwerker, Künstler, Wissenschaftler (Studenten) - kann die Jugendarbeit ihre Flexibilität und Innovationsfähigkeit behalten; sonst besteht auf Dauer die Gefahr einer Verschulung und Bürokratisierung der Jugendarbeit mit dem Ergebnis, daß sie die kreativen, innovativen, sensiblen und insofern auch immer rebellischen Teile der Jugend nicht erreicht.
- Ich warne vor der weiteren sozialpädagogischen Expansion der Jugendarbeit, dem Schielen auf die großen Zahlen. Im Blick bleiben müssen vielmehr auch die sachlich qualifizierten Angebote für solche Minderheiten, von denen ich eben sprach, die zu klug und zu phantasievoll sind für das, was ihnen Schule und Hochschule heute zu bieten haben.
- Ich warne vor den schon immer gescheiterten Versuchen, die kommerzielle Freizeit- und Konsumkultur auf ihrem eigenen Feld schlagen zu wollen. Es ist nichts damit gewonnen, die Disco ins Jugendheim zu holen. solange damit nicht ein Angebot - zum Beispiel an experimenteller Geselligkeit - verbunden ist, das die Disco nicht bietet. Im übrigen darf man nicht vergessen: Immer schon war die große Mehrheit der Jugendlichen nicht an Angeboten der Jugendarbeit beteiligt bzw. daran interessiert, und ich sehe keinen Grund, daß sich daran etwas ändern sollte.
449
141. Zum Gedenken an Jürgen Henningsen (1984)
(In: Herwig Blankertz und Jürgen Henningsen zum Gedenken. = Schriftenreihe der westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Neue Folge, H.3, Münster 1984, S. 31-44)
(Es handelt sich um eine Gedenkrede für den am 14.10.1983 verstorbenen Jürgen Henningsen, Professor für Erziehungswissenschaft an der Universität Münster, die am 27.1.1984 im Rahmen einer Akademischen Gedenkfeier an der Universität Münster gehalten wurde; die Feier gedachte zugleich des am 26.8.1983 verstorbenen Herwig Blankertz, Professor für Philosophie und Pädagogik an der Universität Münster, H. G.)
Die Zeit der Trauer ist nicht die rechte Zeit für eine objektive, abgewogene oder gar abschließende Würdigung dessen, der uns Anlaß zu trauern gibt. Zudem ist Befangenheit unvermeidlich: Jürgen Henningsen war nicht nur mein Kollege, sondern auch ein Freund, dem ich viel für die Entwicklung meines eigenen Berufsverständnisses zu verdanken habe.
Als ich ihn 1963 am Kieler Institut für Pädagogik kennenlernte, war ich nicht nur beeindruckt von seiner Liebenswürdigkeit und spontanen Kollegialität, sondern auch fasziniert von seiner Art zu denken, zu argumentieren, und vor allem: zu schreiben. Diese Faszination ist ungebrochen.
Damals war er - als Assistent - bereits ein bekannter junger Erziehungswissenschaftler. Geboren am 1. Juni 1933 in Kiel, ging er nach dem Abitur auf der Internatsschule in Plön von 1952 bis 1954 an die Pädagogische Hochschule in Kiel, wo er Fritz Blättner kennenlernte, dessen Schüler er dann wurde. Blättner war damals Ordinarius an der Universität Kiel und hielt außerdem Vorlesungen an der Pädagogischen Hochschule. Im Anschluß an sein Lehrerexamen studierte Jürgen Henningsen an der Universität Kiel außer Pädagogik Philosophie, Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft und Anglistik. Promoviert wurde er 1957 mit einer vielbeachteten Arbeit über den "Hohenrodter Bund" (1), also über ein Kapitel der Erwachsenenbildung in der Weimarer Zeit. 1960 wurde er Assistent am Institut für Pädagogik in Kiel, nachdem er zwischenzeitlich an verschiedenen Volksschulen und Heimvolkshochschulen unterrichtet hatte. Von 1964 bis 1967 lehrte er an den Pädagogischen Hochschulen Hannover und Kettwig, 1967 berief ihn der damalige Kultusminister Fritz Holthoff als "Referent für Grundsatzfragen und Koordinierung der Lehrerbildung und für politische Bildung" in sein Ministerium nach Düsseldorf. 1963 wurde er Professor an der Pädagogischen Hochschule Braunschweig, seit 1972 war er Lehrstuhlinhaber am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Münster. Er war auch ein enthusiastischer und guter Schachspieler und erreichte einmal das Deutsche Pokalfinale. "Schach war und ist die ewige Droge", sagte er
31
von sich selbst (2). Nicht weniger engagiert beschäftigte er sich mit Sprachen, in den letzten Jahren lernte er noch Chinesisch. Und schließlich war er Kabarettist. Er textete und führte Regie zunächst für sein Kettwiger Studentenkabarett, seit 1976 für die Gruppe "Fortschrott" in Münster.
Jürgen Henningsen war nicht nur ein erziehungswissenschaftlicher Autor, sondern auch und zunehmend in erster Linie ein pädagogischer Schriftsteller, oder wie er selbst sagte: ein staatlich bezahlter pädagogischer Literat. Er hat eine Fülle von Texten hinterlassen: Bücher, Aufsätze, Rezensionen, Glossen, Gedichte, Chansons und Kriminalromane. Nur einiges davon kann an dieser Stelle in Erinnerung gebracht werden.
Die Differenz zwischen einem erziehungswissenschaftlichen Autor und einem pädagogischen Literaten ist keine, die einer prinzipiellen Bewertung bedürfte. Sie ist eine der Darstellungsform - aber mit inhaltlichen Konsequenzen. Der erziehungswissenschaftliche Autor ist an die strengen Regeln seines Metiers gebunden: präzise Definition des Gegenstandes, Entwicklung der Fragestellung, Offenlegung der Methoden. Der erziehungswissenschaftliche Autor wird zu Recht danach beurteilt, ob und in welchem Maße er diese Regeln eingehalten hat. Ob er darüber hinaus auch ein guter Stilist ist, ob er überhaupt Leser außerhalb eines begrenzten Kollegenkreises findet, gilt daran gemessen als zweitrangig. Von diesem soliden Handwerk, das auch Jürgen Henningsen vorzüglich beherrschte, lebt jede Wissenschaft, also auch die Erziehungswissenschaft. Von dem auf diese Weise entstandenen Wissen und von den Kategorien und Strukturen der Darstellung dieses Wissens lebt auch der pädagogische Literat, dies alles ist die intellektuelle Voraussetzung seiner Tätigkeit. Aber er kann, falls er die entsprechenden Formen beherrscht, was der Autor so nicht darf: Wissen in erfundene, aber plausible Geschichten übersetzen; durch Montagen das scheinbar sicher Gewußte verfremden; im strengen Sinne unbeweisbare Zusammenhänge suggerieren, mit dem Ziel, das Urteil darüber der Erfahrung des Lesers zu überlassen. Pädagogische Schriftstellerei, wie sie Jürgen Henningsen betrieben hat, ist weniger an der Produktion des Wissens interessiert als an seiner Verbreitung. Das Interesse ist primär ein didaktisches, aber es setzt eine profunde Kenntnis der Sachverhalte voraus, sonst wird die schriftstellerische Form zum Selbstzweck. Jürgen Henningsen beherrschte beides souverän: das schriftstellerische Handwerk und das, worüber er schrieb. Als ein Beispiel dafür mag die 1980 erschienene Schrift "Sprachen und Signale der Erziehungswissen-
32
schaft" (3) gelten. Hier werden auf weniger als hundert Seiten die wichtigsten wissenschaftstheoretischen Positionen vom Positivismus über die Kritische Theorie bis zur Spieltheorie unter der Leitfrage behandelt: Was muß ein Student der Erziehungswissenschaft von dieser Diskussion wissen?
Er muß wissen, daß solche unterschiedlichen methodologischen Konstruktionen aus dem wissenschaftlichen Denken selbst entstehen, nämlich aus der schlichten Tatsache, daß man viele vernünftige Fragen stellen, viele vernünftige Wege zu ihrer Beantwortung gehen kann, und daß diese Antworten in einer plausiblen, dem menschlichen Denken auch zugänglichen Form dargestellt werden müssen; also hat es keinen Sinn, damit Glaubenskriege zu verbinden, es gibt keine per se unsinnige Position, aber jede hat auch ihre Grenze, wenn wir darauf aus sind, das Ganze der Erziehungswirklichkeit zu verstehen.
Eine solche didaktische Reduktion setzt eine profunde Kenntnis der Sache voraus, aber sie zeigt auch ein Dilemma an: Wie weit darf man Sachverhalte - hier: methodologische Konzeptionen - reduzieren, ohne daß dies an die Substanz geht, ja den Vorwurf der allzu groben Vereinfachung auf sich ziehen muß? Henningsens Gegenfrage wäre gewesen: Was nützt uns komplexe Wißbarkeit, wenn wir sie niemandem mehr beibringen können? "Wer lehrt, popularisiert" heißt der bezeichnende Titel eines Aufsatzes (4), dessen Kernthese ist, daß das, was vermittelt werden soll, im Akt der Vermittlung seinen Charakter ändert, weil es auf einen "erworbenen Wissenszusammenhang" des Lesers oder Hörers trifft. Der Angesprochene tritt nun dem, was ihm vermittelt wird, mit seinen eigenen Erfahrungen entgegen, baut es in diesen Erfahrungszusammenhang "sinnvoll" ein. Jeder Versuch zu lehren steht vor diesem Dilemma, ob an der Universität oder in der Grundschule. Pädagogische Schriftstellerei war für Jürgen Henningsen der immer erneute Versuch, mit der Erfahrung des Lesers zu spielen, ihn auf diese Weise zum Nachdenken über Pädagogisches zu bewegen. Seine schriftstellerische Arbeit war gleichsam gedacht als Hilfe zum Selbstdenken. Diesem Ziel zuliebe, nämlich zu allererst aus der Perspektive des Lernenden und nicht aus der Perspektive des Lehrstoffes zu denken, muß Komplexität reduziert werden, sowohl in qualitativer wie in quantitativer Hinsicht. Dazu berechtigte ihn sein
33
Selbstverständnis als pädagogisch Handelnder: die Gegenstände sind nicht an und für sich wichtig, sondern nur insofern, als sie einem Lernenden zugänglich gemacht werden können, wobei die Hoffnung mitspielt, daß dabei gleichsam der Appetit wächst, mehr von den Sachverhalten zu erfahren, noch genauer zu denken. Lernen besteht nicht in lauter einzelnen Konfrontationen des Subjekts mit dem Objektiven, sondern ist ein in sich verschlungener biographischer Prozeß.
Die Bücher, die Jürgen Henningsen geschrieben hat, sind auffällig schmal, um die hundert Seiten. Das war Absicht. Als ich ihm mein erstes eigenes Buch überreichte, nahm er es in die Hand und sagte, ohne auch nur eine Zeile gelesen zu haben: "Es ist noch zu dick!" Und er fügte hinzu: "Die Leute, die das lesen sollen, haben nicht so viel Zeit, die müssen auch noch anderes lesen."
Der für Jürgen Henningsen zentrale Begriff "erworbener Wissenszusammenhang" wird erstmals entwickelt in einem Aufsatz mit dem Titel "Die Idee des Glasperlenspiels", den der damals davon begeisterte Herman Nohl 1960 in der "Sammlung" abdruckte (5). Jürgen Henningsen hat zehn Jahre später diese Arbeit als das Wichtigste bezeichnet, das er je geschrieben habe (6). In der Tat deutet alles darauf hin, daß er bereits hier seine Wende vom erziehungswissenschaftlichen Autor zum pädagogischen Literaten vollzog. Bis dahin hatte er neben zahlreichen kleinen Beiträgen seine Dissertation, eine Textedition zur Geschichte der Erwachsenenbildung (7) und Aufsätze "zur Theorie der Volksbildung" (8) veröffentlicht - sehr solide, aber durchaus konventionelle Arbeiten.
An der Idee des Glasperlenspiels bei Hermann Hesse interessierte ihn nun das Problem des Zufalls in der Erkenntnis. Auch das zufällig Zusammengewürfelte oder Zusammenmontierte - viele Spiele leben ja davon - vermögen wir mit Sinn auszustatten. Nicht nur das, was logisch-systematisch entfaltet ist, sondern auch das, was anarchisch unverbunden uns entgegentritt, können wir sinnvoll ordnen. Diese Fähigkeit verdanken wir der Sprache. Was wir in Sprache fassen können, beziehungsweise was uns in Form von Sprache entgegentritt, ist eine Sinneinheit, die mit jeder anderen beliebigen Sinneinheit
34
kombiniert werden kann und doch wieder Sinn ergibt. Unsere Sprache artikuliert und konstituiert einerseits unseren jeweils erworbenen Wissenszusammenhang, weist aber andererseits darüber hinaus und begründet deshalb unsere Fähigkeit, neue Sinneinheiten in die Erfahrung einzubauen, also zu verstehen und dazuzulernen. Lernen ist nichts anderes, als Neues in den erworbenen Wissenszusammenhang zu integrieren und diesen dabei umzustrukturieren, Lernen ist also nicht nur ein additiver Vorgang. Wissenschafts- und erkenntnistheoretisch gesehen - darum ging es in dem Aufsatz eigentlich - sind dann die unterschiedlichen Methoden der Wissenschaft "Vorblickbahnen", auf denen der Forscher weiter sucht. Das Konzept vom erworbenen Wissenszusammenhang und seiner Veränderung sah Jürgen Henningsen also als eine Modifikation der Diltheyschen Verstehenslehre an, Diltheys Zusammenhang des Seelenlebens wird faßbar nur insoweit, als er sprachlich artikuliert wird.
Diese Idee läßt ihn nun nicht mehr los. Viele der künftigen Arbeiten variieren dieses Thema und bauen es aus. Diese Idee hat bedeutsame Konsequenzen. Zunächst wird der Blick gerichtet auf die überragende Bedeutung der Sprache. "Erziehungswissenschaft ist Einübung im sinnvollen Sprechen über Pädagogisches, ist Ermöglichung der Kommunikation unter pädagogisch verantwortlich Tätigen" (9), heißt es 1965 in "Erziehungswissenschaft leicht gemacht". Pädagogisches, Erziehungswirklichkeit ist keine "Sache", sondern ein Handeln, es wird erst im Sprechen darüber konstituiert, wobei alle an diesem Sprechen Beteiligten ihren jeweiligen erworbenen Wissenszusammenhang einbringen.
"Die Erziehungswissenschaft hat es in erster Linie und fast ausschließlich nicht mit Sachen zu tun, sondern mit Meinungen über Sachen" (10) schreibt er 1968. Trifft dies aber zu, dann wird das pädagogische Bewußtsein nicht nur dort angereichert, wo institutionalisiertes pädagogisches Handeln anzutreffen ist - wie in der Schule - oder wo Menschen für pädagogische Berufe ausgebildet werden - wie an der Universität - vielmehr hat das menschliche Leben überall eine pädagogische Dimension beziehungsweise Implikation. Der erworbene Wissenszusammenhang, von dem aus jemand - ob Laie oder Berufspädagoge - über Pädagogisches nachdenkt und urteilt, ist mitbestimmt durch alle Erfahrungen, die er bis zum Zeitpunkt seines Sprechens in seinem Bewußtsein integriert hat. Niemand ist in pädagogicis eine tabula rasa, erziehungswissenschaftliche Ausbildung
35
hat die Aufgabe, das immer schon vorhandene pädagogische Bewußtsein über das Sprechen zu präzisieren, zu differenzieren und zu erweitern.
Für dieses Konzept war der Literat Jürgen Henningsen nun geradezu prädestiniert. Wenn es nämlich so ist, daß alle Erfahrungen des Menschen, sofern sie sprachlich erschlossen werden, sein Reden über Pädagogisches mitbestimmen, dann muß es nicht nur möglich, sondern auch sinnvoll sein, den erworbenen Wissenszusammenhang mit literarischen Mitteln in Bewegung zu bringen, also zum Beispiel mit erfundenen Geschichten, mit ungewohnten Interpretationen, mit Verfremdungen, mit Paradoxien, mit Witz und Ironie. Der Leser soll geworben werden, man muß es ihm interessant machen, über Pädagogisches nachzudenken, das Interessante ist keineswegs der Feind des Wesentlichen. "Ich beweise mit dem, was der Zuhörer weiß" (11), heißt es an einer Stelle. Es sei nicht einzusehen, warum die Interpretation einer pädagogischen Situation nicht genauso interessant sein könne wie die Interpretation eines Gedichtes, oder eine Reportage über eine Schulstunde des Comenius nicht genauso zu interessieren vermöge wie eine solche über die Ausgrabung aztekischer Ruinen (12).
Dem Bemühen Jürgen Henningsens, diesem Anspruch zu folgen, verdanken wir eine eigentümliche und unverwechselbare pädagogische Prosa, gerade auch über Gegenstände, die herkömmlicherweise mit pädagogischen Fragen gar nicht in einen Zusammenhang gebracht wurden. Dazu gehört zum Beispiel seine "Theorie des Kabaretts" (1967) (13). Jürgen Henningsen hat viele Jahre selbst Kabarett gemacht - nicht nur zu seinem und des Publikums Vergnügen, obwohl das Rechtfertigung genug gewesen wäre, sondern weil das Kabarett eine Praxis war, an der sich seine erziehungswissenschaftliche Grundposition beweisen mußte. Der Kabarettist - so Jürgen Henningsen - handelt ähnlich wie der Lehrer. Der Lehrer muß die Sache, die dem Unterricht zugrunde liegt, umformen, um sie mit der Erfahrung der Schüler in Verbindung zu bringen. So auch der Kabarettist, aber mit einem entscheidenden Unterschied: Der Kabarettist spielt mit der Erfahrung des Publikums. Die Pointe kommt nur an, wenn der Kabarettist Bruchstellen im erworbenen Wissenszusammenhang des Zuhörers trifft. Er zwingt einen Zusammenstoß nichtintegrierter Vorstellungsbereiche beim Publikum herbei. Das ist etwas grundsätzlich anderes als Lehren. "Der Schüler lernt mit dem Lehrer,
36
das Kabarettpublikum muß sozusagen gegen den Kabarettisten lernen, das heißt integrieren, es ist also dabei auf sich selbst zurückgeworfen (14).
Der erworbene Wissenszusammenhang ist nämlich nur teilweise integriert, nur der Heilige oder der Weise kann sein Bewußtsein widerspruchsfrei strukturieren. Wir Normalmenschen müssen Bruchstellen oder Ausgrenzungen in unserem Bewußtsein zulassen. Dazu gehören zum Beispiel Tabus oder normative Widersprüche etwa zwischen der christlichen Ethik und der tatsächlichen Moral des modernen Erwerbs- und Geschäftslebens. Von diesen Bruchstellen lebt der Kabarettist.
Aus dem Konzept des erworbenen Wissenszusammenhangs, das Jürgen Henningsen übrigens immer als ein heuristisches Prinzip, nicht als eine fertige pädagogisch-psychologische Theorie verstanden hat, folgt, daß das, was sich auf der Ebene des Bewußtseins abspielt, wenn in diesem Sinne gelernt wird, unverfügbar ist für jede Art von Planung. Das hatte Jürgen Henningsen schon in seinem Aufsatz "Autobiographie und Erziehungswissenschaft" (1963) (15) unterstrichen.
Im bürgerlichen Zeitalter ist Autobiographie die sprachlich erschlossene Rekonstruktion der Bildungsgeschichte, der Versuch, die bisherige Lebensgeschichte erzählend zu interpretieren unter der Frage, wie der Autor der geworden ist, der er ist. Das, was davon in pädagogischen Institutionen veranstaltet wurde, hat dabei eine relativ geringe Bedeutung. Auch unglückliche Erlebnisse und leidvolle Phasen, die die Pädagogik ja nicht organisieren darf, tragen nicht unwesentlich zur Bildungsgeschichte bei, können sogar zentrale Bedeutung erlangen. Auch Unglück kann bilden (16). Jürgen Henningsen sah seine These, daß pädagogische Wirklichkeit als solche unfaßbar sei, sondern nur sich im Dialog, in der Kommunikation der daran Beteiligten konstituieren könne, in der Autobiographie bestätigt. Die empirischen Tatsachen des Lebens haben für sich genommen keine Bedeutung, sondern nur insofern, als der Autor eine Bedeutung durch sprachliche Erschließung und Interpretation definiert. Deshalb ist auch eine empirische Abbildung der pädagogischen Wirklichkeit weniger ergiebig - weil sie stumm ist - als die Interpretation dieser Wirklichkeit zum Beispiel durch einen autobiographischen Autor oder auch durch mündliche Deutungen der in einer solchen Wirklich-
37
keit Handelnden - obwohl, oder besser: weil diese Aussagen alle subjektiv gefärbt sind.
Im Jahre 1963, in dem der Aufsatz über "Autobiographie und Erziehungswissenschaft" erschien, erschien auch die kleine Streitschrift "Test, Experiment, Befragung" (17). Sie setzt sich auseinander mit der damals einsetzenden sogenannten realistischen Wende in der Erziehungswissenschaft, als die geisteswissenschaftliche Pädagogik sich anschickte, sich stärker an den quantifizierend-empirischen Sozialwissenschaften zu orientieren. Die Auseinandersetzung, die er mit dieser Schrift heraufbeschwor, blieb einerseits nicht ohne Einfluß auf seinen weiteren Werdegang, andererseits offenbarte sie aber auch wichtige Züge seiner Persönlichkeit. Die Schrift vertrat im wesentlichen zwei Thesen: Es sei unmoralisch und verstoße gegen die Menschenwürde, wenn man Kinder und Heranwachsende - wie Menschen überhaupt - Versuchs- und Testsituationen aussetze; bloß um dabei irgend etwas Erziehungswissenschaftliches herauszufinden, indem man zum Beispiel mit der einen Gruppe pädagogisch arbeite, mit der anderen nicht, nur um letztere als Kontrollgruppe verwerten zu können. Zweitens könne das Ziel, auf empirische Weise pädagogische Wirklichkeit zu erfassen, grundsätzlich nicht erreicht werden, weil die Forscher, sofern sie nicht pädagogisch handeln, durch ihre Intervention die Situation verändern, in eine nichtpädagogische verwandeln, und somit nicht die pädagogische, sondern eine von ihnen selbst erst hergestellte Wirklichkeit untersuchen. Zudem beruhe - und dies war als sachlicher wie moralischer Einwand gemeint - die empirische Forschung auf einer grundlegenden Täuschung: Um ihren Untersuchungsgegenstand herstellen zu können, müsse sie die Befragten im Unklaren lassen über die Ziele der Untersuchung. Mit teilweise bissiger Ironie spielte Jürgen Henningsen hier eine Zukunftsvision von Orwellschem Zuschnitt durch: Irgendwann weiß jeder, was es mit solchen Befragungen auf sich hat, lernt das Befragtwerden als eine Art von öffentlicher Rolle, täuscht nun wieder die Befrager über seine wahre Meinung, und das Ergebnis ist eine Welt, die einerseits nach empirisch-wissenschaftlichen Fiktionen konstruiert wird, in der die Menschen andererseits sich nicht mehr über den Weg trauen.
Die moralische Leidenschaft, mit der er diese Thesen vertrat, und auch der polemische Ton waren für Jürgen Henningsen eigentlich ungewöhnlich. Später und auch in seiner ebenfalls 1963 erschienenen Schrift "Bildsamkeit, Sprache und Nationalsozialismus" (18) hat er moralische Fragen eher unterkühlt behandelt und an die Stelle von
38
Polemik eher Witz und Ironie gesetzt. Die Streitschrift rief damals heftigen Widerstand der noch in den ersten Anfängen steckenden empirischen Pädagogik hervor, so daß diese Schrift, um einen Rechtsstreit zu vermeiden, vom Verlag zurückgezogen wurde und in einer zweiten Auflage - in der Substanz unverändert - erschien.
Dieser Konflikt, von dem Jürgen Henningsen lange annahm, daß er seiner beruflichen Karriere zumindest nicht genützt habe, war insofern nicht ohne Tragik, als die Positionen einander viel näher waren, als beide Seiten dies damals zu sehen vermochten. Jürgen Henningsen hatte gar nichts gegen empirische Forschungen, er bestritt nur, daß dadurch die Erziehungswirklichkeit, wie er sie verstand - nicht als Sache, sondern als Ensemble von Meinungen - besser aufzuklären sei. Andererseits war empirische pädagogische Forschung - wie immer man ihre Ergebnisse bewerten mochte - mühelos in die Vorstellung vom erworbenen Wissenszusammenhang zu übernehmen. Es kann dem gemeinsamen Sprechen über Erziehungswirklichkeit nur nützen, wenn dabei auch Kenntnisse aus empirischen Untersuchungen eingebracht werden.
Jürgen Henningsen zeigte sich hier als unbeugsamer Vertreter seiner Gedanken, zur Unterwerfung nur dem besseren Argument gegenüber bereit. Die Folgen dafür nahm er in Kauf.
Ähnlich verhielt er sich zur gleichen Zeit - 1963/64 - im Hinblick auf sein Habilitationsverfahren, wo er nicht bereit war, Kompromisse mit der Kieler Philosophischen Fakultät zu schließen, das Verfahren schließlich einschlafen ließ und einige Ergebnisse seiner Arbeiten unter dem Stichwort "Enzyklopädie" im "Archiv für Begriffsgeschichte" 1966 veröffentlichte (19). Jürgen Henningsen lernte in diesen Auseinandersetzungen, daß es auch in der institutionell verfaßten Wissenschaft so etwas wie Macht gibt, die nicht auf dem Wort allein beruht, sondern auch auf kalkulierter öffentlicher Selbstdarstellung und auf schlichter Hierarchie. Mit seiner Polemik hatte er, ohne es zu wollen und ohne es zunächst zu bemerken, auch die Machtfrage angerührt.
Er hat deshalb so hartnäckig an der These festgehalten, in der Erziehungswissenschaft gehe es um Meinungen und um Interpretationen und nicht in erster Linie um Sachen, weil er genau darin das Abgrenzungskriterium der Erziehungswissenschaft gegenüber den anderen Humanwissenschaften sah. Er ließ durchaus gelten, daß andere Wissenschaften in erster Linie sich um die Aufklärung ihrer Gegenstände, also ihrer "Sachen" bemühten. Die erziehungswissen-
39
schaftliche Leitperspektive ist jedoch pädagogisches Handeln, und wer dieses Handeln zur Sache macht - wie er den Empirikern damals vorwarf - der mag alles mögliche dabei herausfinden, nur wird er nichts Pädagogisches finden. Von daher wird auch verständlich, daß Jürgen Henningsen die Erziehungswissenschaft nicht für eine Bereichswissenschaft hielt, deren eigentümliche Gegenstände zum Beispiel pädagogische Institutionen sind, sondern für eine Aspektwissenschaft: Wo immer jemand pädagogisch handelt - und das tut zum Beispiel jeder, der lehrt, auch zum Beispiel der Journalist - hat diese erziehungswissenschaftliche Fragestellung ihre Berechtigung. Pädagogik ist eine Implikation des ganzen menschlichen und gesellschaftlichen Lebens. Erziehungswissenschaftliche Theorie fiel also für Jürgen Henningsen weitgehend mit pädagogischer Handlungstheorie zusammen. Pädagogisches Handeln ist demnach interpretierendes Interagieren in pädagogischen Situationen. Jürgen Henningsen ging davon aus, daß pädagogisches Handeln als mehr oder weniger aufgeklärte Tätigkeit unentwegt stattfindet, daß es für "richtiges" Handeln in einer bestimmten Situation weder eine Theorie noch eine allgemein anerkannte Begründung geben könne. "Richtiges" pädagogisches Handeln kann man nicht lehren und lernen, wohl aber kann man lernen, "besser", nämlich reflektierter zu handeln. Pädagogisches Handeln vollzieht sich in einem Spielraum mit einer mehr oder weniger großen Variation gleich vernünftiger Entscheidungsmöglichkeiten - ein Problem übrigens, das sein Interesse für die Spieltheorie weckte. "Verbesserung" des pädagogischen Handelns hieß also für Jürgen Henningsen, den Spielraum vernünftiger Entscheidungen abgrenzen zu lernen von jener anderen Fülle von Möglichkeiten, die entweder dem Leitziel widersprechen - Menschen mündig werden zu lassen -. oder die nicht machbar sind. "Machbarkeit" war dabei für ihn ein sehr wichtiger Gesichtspunkt, er hielt nichts vom Wehklagen darüber, daß die reinen Ziele leider an der Realität scheitern, so, wie sie ist.
Diese durch die sprachliche Erschließung und Kontrolle konstituierte Erziehungswissenschaft als Handlungstheorie hat allerdings mindestens drei Voraussetzungen. Einmal, daß die Beteiligten auch tatsächlich bereit sind, ihren erworbenen Wissenszusammenhang umzustrukturieren, also dazuzulernen. Das ist nach aller Erfahrung keineswegs selbstverständlich. Die zweite Voraussetzung ist, daß der Pädagoge weiterhin Texte liest, nicht nur pädagogische, sondern überhaupt Texte, die neue Wirklichkeiten sprachlich erschließen können. Angesichts der Bedeutung, die Jürgen Henningsen der Sprache beimaß, kann die bloß mündliche Kommunikation keineswegs ausreichen, sie würde ohne ständige neue Impulse von außen nicht vernünftig fortschreiten können. Er hielt also Lehrer, die keine Texte
40
mehr lesen - und zwar für sich selbst, nicht nur im Hinblick auf ihre Schüler - und Studenten, die nicht ernsthaft wissenschaftlich, und das heißt: an und mit Literatur arbeiten, für pädagogisch inkompetent.
Die dritte Voraussetzung schließlich ist Lebenspraxis, nicht nur die im engeren Sinne pädagogische. Jürgen Henningsen wußte genau, daß seine pädagogische Schriftstellerei angewiesen war auf alles, was er in seinem Leben tat: eine Familie haben, Unterrichten, Hochschullehrer sein, Schachspielen, Kabarett machen, in einem Ministerium arbeiten, politisch tätig sein, ein akademisches Amt ausüben - all dies war Voraussetzung seiner pädagogisch-literarischen Produktivität. Lehrer, die das Schulehalten abkoppeln von ihrem sonstigen Leben und ihren erworbenen Wissenszusammenhang entsprechend parzellieren, und Studenten, deren Lebenserfahrung auf das Seminar und auf die politische Gesinnungsgemeinde reduziert ist, können nicht kompetent über Pädagogisches sprechen.
Jürgen Henningsen war bis zuletzt ein rastlos tätiger Mensch, kein Stubengelehrter, der sein Weltbild lediglich aus Lektüre bezog. Tätigsein und Schreiben hat er auf eine unverwechselbare Weise miteinander verschmolzen. Er war tätig, um schreiben zu können, und er schrieb, um vernünftiger tätig sein zu können.
Es ist unverkennbar, daß die historisch-philologisch-philosophisch orientierte geisteswissenschaftliche Tradition, in die ihn Fritz Blättner eingeführt hatte und die seinen Begriff von Erziehungswissenschaft prägte, ein wichtiges Fundament seines Denkens blieb. Ebenso offensichtlich ist aber auch, daß er diese Tradition an entscheidenden Punkten modifizierte und sogar korrigierte.
Festgehalten hat er zum Beispiel nicht am romantisch-verklärten und idealisierten "pädagogischen Bezug" und dem damit verbundenen Vorstellungskreis der "pädagogischen Provinz", des "zubereiteten Erfahrungsraumes". Vielmehr nahm er das Kind als geistigen Partner des Erwachsenen ernst, traute ihm verhältnismäßig große Fähigkeiten des Denkens und der Einsicht zu. Die Geschichten, die er geschrieben hat und in denen Kinder vorkommen, zeigen selbst kleine Kinder schon als denkend mitagierende Wesen. Wieviel er Kindern schon an Verstand und Einsicht zutraute, zeigt etwa die Schrift "Lüge und Freiheit" (1966) (20), ein "Plädoyer zur politischen Bildung". Die Schule lehre nicht, worauf es ankommt. Sie lehre Politisches (und anderes) so, als ob in der gesellschaftlichen Wirklichkeit die Menschen einander immer die Wahrheit sagten. Aber das tun sie oft selbst dann nicht, wenn sie es wollen; vor allem aber: wie kann man wissen, ob der andere die Wahrheit sagt? Das Subjekt ist nicht als Subjekt,
41
sondern nur als Objekt der Erkenntnis zugänglich. Oder anders: die Freiheit ist nicht ohne deren Mißbrauch zu haben. Ist Aufklärung als Bedingung der Möglichkeit von Mündigkeit das pädagogische Ziel, dann muß die Schule auch lehren, mit der Lüge leben zu lernen.
"Die Pädagogik möge nicht mit erhobenem Zeigefinger (und dito Rohrstock) das Subjekt auf die Wahrheit zu verpflichten suchen, sondern es befähigen, vernünftig mit der Lüge umzugehen - oder, nüchterner gesagt: Kann ich den Sprecher nicht dazu bewegen, die Wahrheit zu sagen (ich kann es nicht, wie zweitausend Jahre Pädagogik zeigen), so muß ich den Angesprochenen anders ausrüsten als bisher" (21).
Die Pädagogik soll also weniger moralisch und viel mehr intellektuell vorgehen. Man kann zum Beispiel in einer Fotoarbeitsgemeinschaft Menschen sympathisch oder unsymphatisch porträtieren, eine werbende und eine abwertende Reportage über den eigenen Wohnort verfassen, Lobreden und Hetzreden über ein und dieselbe Person halten lassen, damit die Schüler lernen, daß so etwas technisch machbar ist, wie es machbar ist und worauf die Wirkung jeweils beruht. Um Lügen durchschauen zu können, muß man die Techniken des Lügens selbst lernen.
Diese Schrift markiert insofern eine Wende im pädagogischen Denken von Jürgen Henningsen, als die moralische Perspektive, die in der Streitschrift noch vorherrschte, nun zugunsten der intellektuellen zurücktritt. Die moralisch aufgeladenen Begriffe der geisteswissenschaftlichen Pädagogik wie "Verantwortung" benutzt er künftig kaum noch, er spricht zum Beispiel lieber von "Zuständigkeit". Der Blick wird politischer und richtet sich auf die Möglichkeiten, die vorhandenen Spielräume zu nutzen. In seiner, wie er sie nannte "persönlichsten" (22) Schrift, "Die zweite Prüfung" (1967) (23), bietet er dem Leser neben scharfsinnigen und sensiblen Analysen auch Tricks und Manipulationen an: Man muß auch heulen können mit den Wölfen; manche Spiele muß man einfach mitspielen, Spielraum hat nur der, der die Regeln kennt und sie in seinem Sinne zu handhaben weiß. Nun treten einige Züge des politisch engagierten Jürgen Henningsen deutlicher hervor. Er strebte nie persönliche Macht an, wo sie ihm - zum Beispiel als Professor - zufiel, versuchte er sie möglichst gleichmäßig auf seine Umgebung zu verteilen. Sein Interesse galt auch nicht in erster Linie den großen Gesellschaftstheorien. Vielmehr nahm er politische und gesellschaftliche Realitäten als zunächst einmal gegeben hin und plädierte dafür, die konkreten Freiheitsräume so weit
42
wie möglich auszufüllen durch ein Wechselspiel von Tätigsein und Aufklärung des Handelns. So gesehen war seine politische Handlungsperspektive eine Variation seiner pädagogischen.
In den siebziger Jahren richtete sich folgerichtig sein Interesse stärker auf das, was er den "gesellschaftlichen Lernprozeß" (24) nannte, also auf jene Sozialisationswirkungen, die außerhalb der pädagogischen Institutionen wirksam sind. Daran gemessen nehme die Bedeutung der geplanten und organisierten Pädagogik immer mehr ab. Die Schule zum Beispiel habe eine überwiegend custodiale Funktion bekommen: Sie schütze stundenweise die Gesellschaft, also die Straßen, die Maschinen und die Büros, vor Störfaktoren, sie "kaserniert fummelnde Finger", wie er es ausdrückte (25). Das Konzept vom "gesellschaftlichen Lernprozeß" - Sozialisation betrachtet aus der Perspektive der Subjekte - ist leider weitgehend Programm geblieben. Jürgen Henningsen ist nicht mehr dazu gekommen, dafür eine ähnlich konsequente Theorie zu formulieren wie für den Standpunkt des pädagogischen Handelns. Wäre es möglich, die Sozialisationsprozesse ebenfalls als interpretierendes Handeln zu beschreiben, und dies nicht nur im formalen Sinne wie etwa beim symbolischen Interaktionismus, sondern so, daß daraus Bildungsgeschichten verständlich werden? Manches spricht dafür, daß Jürgen Henningsen in dieser Richtung weiterdenken wollte.
Trotz aller Resignation, die in den letzten Jahren in seinen Arbeiten erkennbar ist und mit der er auch die Wirkung seines literarischen Schaffens beurteilte, blieb er der Überzeugung, daß Pädagogik die Aufklärung aller Menschen weiter befördern könne. Das sei zwar ein langwieriger und mühsamer Prozeß, aber die Entwicklung des gesellschaftlichen Bewußtseins seit der Aufklärung beweise, daß sich etwas verändert habe. Allerdings sah Jürgen Henningsen gerade in den letzten Jahren auch die Schattenseiten des allgemeinen Aufklärungsprozesses deutlicher. Es sei eine Illusion anzunehmen, durch die Aufklärung aller würden die Menschen gleichsam automatisch glücklicher und friedlicher, sei die Gesellschaft besser zu regieren.
Dieses Dilemma, für das er keine Lösung parat hatte, nannte er den Grundwiderspruch der Pädagogik, daß sie nämlich einerseits die Aufklärung der Individuen betreibt, andererseits aber auch durch Lehren und Lernen die Welt entzaubert, die Menschen ihren Gesinnungsgemeinden entfremdet, mit der individuellen Rationalität kei-
43
neswegs auch die kollektive unbedingt fördert. Regierbarkeit wird nicht leichter, sondern schwerer. Dieser Widerspruch kann auch dunkle Kräfte freisetzen, die den Prozeß der Aufklärung und der Humanisierung rückgängig zu machen trachten. Der linke Terrorismus erschien ihm da als ein erstes Signal (26).
Jürgen Henningsen hinterläßt ein Werk, dessen Reichtum an Fragestellungen, Einsichten, Einfällen, an experimentellem Denken im Augenblick noch nicht annähernd gewürdigt werden kann. Da er ein Feind aller großen oder gar pathetischen Worte war, seien ihm solche Worte auch an dieser Stelle nicht angetan. Aber zum Ausdruck bringen müssen wir schon, daß wir ihm zu danken haben für seine menschliche Integrität und für seinen unermüdlichen Einsatz für andere, der bis zur Selbstausbeutung reichen konnte. Als Kollegen trauern wir um ihn, weil wir noch viel mehr von ihm hätten lernen können. Seine hartnäckigen Einsprüche gegen scheinbar gesicherte Erkenntnisse und gegen sogenannte "herrschende Meinungen" und seine produktive Phantasie bei der Neuformulierung pädagogischer Probleme werden uns sehr fehlen.
44
Anmerkungen:
(1) Jürgen Henningsen: Der Hohenrodter Bund. Zur Erwachsenenbildung in der Weimarer Zeit. Heidelberg 1958.
(2) Jürgen Henningsen: Die linke Lüge und ein paar gewöhnliche Widersprüche. In: R. Winkel (Hrsg.): Deutsche Pädagogen der Gegenwart, Bd. 1. Düsseldorf 1984, S. 87-110, hier: S. 109.
(3) Jürgen Henningsen: Sprachen und Signale der Erziehungswissenschaft, Stuttgart 1980
(4) Jürgen Henningsen: Wer lehrt, popularisiert. In: Die Herausforderung der Schule
durch die Wissenschaften. Beiträge zur Lehrplangestaltung. Festgabe für Fritz Blättner zum 75. Geburtstag. Hrsg. von Th. Wilhelm, Weinheim 1966, S. 99-106. Wieder abgedruckt in Jürgen Henningsen: Kommunikation zwischen Fußnote und Feuilleton. Weinheim 1972, S. 66-73.(5) Jürgen Henningsen: Die Idee des Glasperlenspiels. In: Die Sammlung 1960, S. 116-126. Wieder abgedruckt in: Jürgen Henningsen: Kinder, Kommunikation und Vokabeln. Heidelberg 1966, S. 145-166.
(7) Jürgen Henningsen: Die Neue Richtung in der Weimarer Zeit. Dokumente und Texte von Robert von Erdberg, Wilhelm Flitner, Walter Hofmann, Eugen Rosenstock Huessy. Stuttgart 1960.
(8) Jürgen Henningsen: Zur Theorie der Volksbildung. Historisch-kritische Studien zur Weimarer Zeit. = Schriften zu Volkshochschulfragen, hrsg. von Jean Hartmann, H. 20 (Reihe C, Nr. 4) Berlin o.J. (1959).
(9) Jürgen Henningsen: Erziehungswissenschaft leichtgemacht. Essen 1965, S. 2.
(10) Jürgen Henningsen: Was ist Erziehungswissenschaft? In: Die Deutsche Schule 1963, S. 26-35. Wieder abgedruckt in: Jürgen Henningsen: Kinder, Kommunikation und Vokabeln. Heidelberg 1969, S. 71-86, hier: S. 85.
(11) Jürgen Henningsen: Test, Experiment, Befragung. Ein kritisches Plädoyer, 2. veränderte Aufl. 1964, S. 56.
(12) Jürgen Henningsen: Erziehungswissenschaft leichtgemacht. Essen 1965, S. 3.
(13) Jürgen Henningsen: Theorie des Kabaretts. Ratingen 1967.
(15) Jürgen Henningsen: Autobiographie und Erziehungswissenschaft. Eine methodologische Erörterung. In: Neue Sammlung 1962, S. 450-461. Wieder abgedruckt in: Jürgen Henningsen: Autobiographie und Erziehungswissenschaft. Fünf Studien, Essen 1981, S. 9-27.
(16) Jürgen Henningsen: Unglück bildet. In: ders.: Autobiographie und Erziehungswissenschaft. Essen 1981, S. 89-107.
(17) Jürgen Henningsen: Test, Experiment, Befragung. Ein kritisches Plädoyer. Essen 1963.
(18) Jürgen Henningsen: Bildsamkeit, Sprache und Nationalsozialismus. Essen 1963
(19) Jürgen Henningsen: "Enzyklopädie". Zur Sprach- und Bedeutungsgeschichte eines pädagogischen Begriffs. In: Archiv für Begriffsgeschichte. Bausteine zu einem historischen Wörterbuch der Philosophie. Hrsg. von Erich Rothacker, Bd. 10, Bonn 1966, S. 271-362.
(20) Jürgen Henningsen: Lüge und Freiheit. Ein Plädoyer zur politischen Bildung. Wuppertal 1966.
(22) Jürgen Henningsen: Die linke Lüge ... S. 110.
(23) Jürgen Henningsen: Die zweite Prüfung. Bochum 1967.
(24) Jürgen Henningsen: Die Impotenz der Schule. in: G. Groth (Hrsg.): Horizonte der Erziehung. Zu aktuellen Problemen von Bildung, Erziehung und Unterricht. Festgabe für Th. Wilhelm zum 75. Geburtstag. Stuttgart 1981, S. 96-110
(25) Jürgen Henningsen: Lernen, was Verwaltung ist. In: H. Schrey (Hrsg.): Impulse für morgen. Festschrift für Fritz Holthoff. Ratingen 1975, S. 10-31, hier: S. 27.
(26) Vgl. Jürgen Henningsen: Die linke Lüge ... , S. 102ff.

142. Wozu noch "Politische Bildung" (1985)?
Anmerkungen zum 40. Geburtstag einer nach wie vor umstrittenen Bildungsaufgabe
(In: Neue Sammlung, H. 4/1985, S. 465-474)
Die politischen und publizistischen Peinlichkeiten angesichts der Frage, wie wir mit dem 40. Jahrestag der deutschen Kapitulation umgehen sollen, haben deutlich gemacht, daß es keinen moralischen und politischen Konsens über dieses Ereignis und seine Hintergründe gibt. Da aber die Kapitulation und nicht die Verabschiedung des Grundgesetzes - sie war nur eine zunächst noch keineswegs sichere Folge davon - die eigentliche Geburtsstunde dieser Republik war, hat dieser Dissens bis heute Folgen für unsere politische Identität.
Daran hat offensichtlich auch die politische Bildung nichts ändern können. Sie ist deshalb in diesem Zusammenhang erwähnenswert, weil sie in diesem Jahr sozusagen ihren 40. Geburtstag feiert, denn sie ist ein Kind der deutschen Kapitulation. Sie geht nämlich zurück auf die Umerziehungs-Bemühungen der Besatzungsmächte. Umerziehung war ja ein wesentlicher Zweck der Besetzung. Die Deutschen sollten einsehen, daß nur die Kapitulation ihnen die Chance verschaffte, demokratische Tugenden, Regeln und Verhaltensweisen zu lernen. Wir wissen, daß diese Bemühungen bald abgebrochen beziehungsweise in deutsche Hände übergeben wurden, wobei sich vor allem die amerikanische Besatzungsmacht beratend und mit umfangreichen Austauschprogrammen zur Verfügung stellte. Aber der "Geruch" der Umerziehung haftet der politischen Bildung bis heute an. Immerhin unterstellte sie ja eine prinzipielle politisch-kulturelle Defizienz des ganzen deutschen Volkes und ließ folgerichtig diejenigen, die sich in ihr engagierten, als anmaßend und überheblich erscheinen. In der Tat ist ja bis heute die Versuchung groß, politische Bildung mit einem besonderen moralischen Anspruch auszustatten: daß Auschwitz nicht wieder sein dürfe, daß mit der "Verdrängung" der Vergangenheit aufgeräumt werden müsse, daß dem Nazismus vergleichbare Bestrebungen in der Gegenwart "entlarvt" werden müßten, usw. Die ohnehin latent vorhandene Versuchung pädagogischer Berufe, sich durch Identifikation mit der "schwachen" Klientel professionelle Identität zu verschaffen, ist im Falle der politischen Bildung besonders groß.
Das seit der Umerziehung unseren Bemühungen um politische Bildung anhaftende Problem ist, daß mit pädagogischen Mitteln - Lernen, Bildung - eine bestimmte politische Wirkung erreicht werden sollte. Immer wieder wurde ihr Versagen vorgeworfen, wenn politisch Mißliebiges zu verzeichnen war. Ende der 50er Jahre zum Beispiel drohten Hakenkreuzschmierereien auf jüdischen Gräbern das Ansehen der Republik zu gefährden. Zudem gab es eine "ideologische Offensive" der DDR, die
465
sich einmal dadurch ausdrückte, daß "Enthüllungen" über die Nazi-Vergangenheit führender westdeutscher Politiker verbreitet wurden und vor allem die FDJ die Diskussionen mit westdeutschen Jugendlichen suchte, in denen sie sich durchweg als ideologisch überlegen erwies. Bis dahin hatte die Umerziehung im wesentlichen das Ergebnis, daß es in der Bevölkerung einen breiten Konsens darüber gab, daß der "Totalitarismus" der Hitlerei in der DDR unter anderer Flagge fortlebe, während die BRD sich im Glanz freiheitlich-demokratischer Tugenden und Institutionen sonnen könne. Wichtig in unserem Zusammenhang ist, daß die nun vor allem auch im außerschulischen Bereich geförderte politische Bildung wiederum einen politischen Anspruch bekam, insofern sie "immunisieren" sollte gegen die ideologische Bedrohung aus dem Osten. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie schwierig und verpönt es damals war, sich sachlich-differenziert mit dem Komplex Sozialismus - Kommunismus in der außerschulischen Jugendbildung zu befassen; dafür würden die öffentlichen Mittel nicht zur Verfügung gestellt, hieß es gelegentlich unverblümt. Wissenschaftliche Auseinandersetzung gehöre an die Universität, in der politischen Bildung komme es darauf an, die Vorzüge des freiheitlichen Rechtsstaates ins rechte Licht zu rücken. Darin lag insofern ein verständliches Kalkül, als Sachlichkeit ja in der Tat blinde Loyalität aushöhlen kann und die staatsbürgerliche Identität des Einzelnen ein neues Fundament finden mußte.
Der unselige "Radikalenerlaß" und die politisch lächerliche Hexenjagd auf eine Handvoll DKP-Mitglieder im öffentlichen Schulwesen - und anderswo - denen man im übrigen professionelle Souveränität - zum Beispiel Verzicht auf Agitation und Indoktrination - auch in rechtlichen Verfahren meist nicht absprechen konnte, ist noch ein Abklatsch dieser Einstellung und beweist eigentlich nur, daß vom Unterricht - nicht nur vom politischen - eine bestimmte politische Beeinflussung erwartet wird, daß man der pädagogischen Professionalität als solcher nicht über den Weg traut, ja, sie im Grunde auch nicht wünscht, weil sie die Legitimation bürokratischer Zugriffe begrenzen würde (1). Denken wir weiter an die erbitterten Auseinandersetzungen um neue Rahmenrichtlinien, die sich an Problemen von gestern entzündeten, die uns Richtlinien-Wälzer bescherten und deren Lernziel-Akrobatik nur zur Machtergreifung der Administration im Unterricht führte, ganz abgesehen davon, daß, was selten gesehen wird, auf diese Weise wieder "heimliche Erziehungsansprüche" des Staates in den Unterricht eingeschmuggelt wurden und dies zu einem historischen Zeitpunkt, als solche Ansprüche nicht einmal in Fürsorgeheimen mehr legitimiert werden konnten. Als letztes Beispiel sei der Streit über die "richtige" Wehr- und Friedenserziehung in den Schulen erwähnt, dessen Ergebnis bekanntlich war, daß die CDU-regierten Länder einerseits und die SPD-regierten Länder andererseits zu unterschiedlichen Formulierungen kamen, was im Unterricht über diese Frage "herauskommen" solle. Nicht zu vergessen die Praxis der Schulbuchgenehmigungen.
466
Bedingt durch seine Herkunft aus der Umerziehung hat der politische Unterricht bei uns eine eigenartige Sonderstellung unter den Unterrichtsfächern gefunden, die sich bei anderen westlichen Ländern nicht feststellen läßt. Nicht wenige Politiklehrer - im schulischen wie außerschulischen Bereich - haben diese Besonderheit insofern verinnerlicht, als sie eingestanden oder uneingestanden ebenfalls dem politischen Unterricht politische Ziele setzen (für die Friedensbewegung, gegen die Nachrüstung, für oder gegen die Bundeswehr usw.). Dabei denke ich nicht an sogenannte "Tendenzbetriebe", also zum Beispiel an Bildungseinrichtungen der politischen Parteien, der Kirchen oder Gewerkschaften, weil in diesen Fällen jeder Besucher ja damit rechnet, daß die jeweilige partikulare politische Position besonders zur Geltung gebracht wird.
Ich halte es nach 40 Jahren für an der Zeit, die politische Bildung sozusagen erwachsen werden zu lassen, d. h. sie ebenso professionell zu betreiben wie andere Bildungsaufgaben auch, und ihr eine von ihrer Entstehungsgeschichte her unabhängige Legitimation zu geben.
Politische Bildung rechtfertigt sich nicht dadurch mehr, daß bestimmte politische Ergebnisse dabei herauskommen - so vernünftig sie auch sein mögen - und sie verliert ihre Legitimation nicht dadurch, daß solche Ergebnisse fehlen, sondern sie begründet sich als "Bürgerrecht". Die Bürger haben einen Anspruch darauf, daß ihnen möglichst schon in der Kindheit und im Jugendalter zumindest das Angebot gemacht wird, die politische Welt, in der sie leben, verstehen zu lernen, damit sie an ihr partizipieren können. Und die Profession, bei der man so etwas planmäßig und systematisch lernen kann, ist die entsprechende pädagogische.
Ich plädiere also dafür, daß die politische Bildung nach 40 Jahren sich emanzipiert von ihrer Herkunftssituation, der Umerziehung nach 1945, und damit auch von dem, was vorausging: von der politischen Kriminalität des Nationalsozialismus. Das soll nicht heißen, die NS-Vergangenheit zu leugnen oder zu verdrängen oder gar zu vergessen. Sie bleibt ein zentrales Thema der politischen Bildung, aber sie hört auf, deren einzige oder auch nur besondere politisch-moralische Legitimation zu sein.
Die Zahl der Bürger, die vor 1945 geboren wurde, nimmt ständig ab, und die Zahl der danach geborenen entsprechend zu. In absehbarer Zeit wird es kaum noch jemanden geben, der eine persönliche Erinnerung an jene Zeit hat. Andererseits leben die heutigen Kinder und Jugendlichen in einer Welt, die mit der von 1933 bis 1945 unter kaum einem wesentlichen Gesichtspunkt mehr etwas gemein hat. Für diese Jüngeren gehört inzwischen eine immense soziale Phantasie dazu, sich das Alltagsleben der Menschen damals überhaupt noch vorstellen zu können. Gewiß muß zwischen den heute lebenden Generationen eine Verständigung über die mit der Nazizeit aufgeworfenen Fragen versucht werden, aber diese Notwendigkeit nimmt ab und nicht zu. Die politische Kriminalität des Nationalsozialismus, realisiert und symbolisiert vor allem im Namen "Auschwitz", droht inzwischen zum bloßen Zweck für ganz andere Bedürfnisse zu werden: für Generationskonflikte wie schon bei der 68er Generation; für soziale Geborgenheit und Selbstbegrenzung der als unerträglich empfundenen gesellschaftlichen Freiheit wie bei den jungen Neona-
467
zis, die statt der von ihnen verbreiteten "Auschwitzlüge" für die Sicherung ihrer eigentlichen Bedürfnisse auch ganz andere Tabus brechen würden (ob jemand zu den Neonazis stößt oder zum Beispiel zu einer Jugendsekte, ist oft Zufall), und schließlich für politische Tagesauseinandersetzungen.
Die Instrumentalisierung dessen, was mit dem Namen "Auschwitz" verbunden bleibt, ist nicht nur ein moralisches Problem gegenüber den Opfern - und wertet eher die Mentalität der Täter auf, insofern die besinnungslose Instrumentalisierung von vergangenen und damals gegenwärtigen menschlichen Schicksalen ihr folgenreichstes Denkmuster war - , sie blockiert auch den Blick in die Zukunft. Liest man heute, nach 20 Jahren, noch einmal Adornos Aufsatz "Erziehung nach Auschwitz" (2), in dem er aller Erziehung und besonders der politischen die Aufgabe zuwies, künftig so etwas wie Auschwitz zu verhindern, so wird das deutlich. Seine an Freud orientierten Analysen der Täterpersönlichkeit sind heute umstrittener denn je (was z. B. die Bedeutung der frühen Kindheit angeht oder den sogenannten "sadomasochistischen Charakter"). Die "Erziehung zur Härte", zur Mißachtung des eigenen und fremden körperlichen Schmerzes, von Adorno mit Recht als das Kernstück der Tätererziehung bezeichnet, ist als Leitbild öffentlicher Erziehung längst aus der Mode gekommen, und daß man Angst nicht verdrängen solle, pfeift das Fernsehen inzwischen aus allen Kanälen. Der "manipulative Charakter" mit seinem "verdinglichten Bewußtsein" beherrscht inzwischen jede öffentliche Organisation von den Parlamenten bis hin zu den Hochschulen, und keine ihrer öffentlichen Äußerungen ist mehr verständlich ohne Analyse der interessengerichteten Manipulationen. So ärgerlich dies sein mag, aber gerade seine Verallgemeinerung entschärft seine Gefährlichkeit. Jedermann mißt heute, was ihm öffentlich angesonnen wird, an seinem Interesse, so daß Adornos Hinweis auf das egoistische Interesse (jeder Täter könne jederzeit auch Opfer sein) sozusagen fruchtbar geworden ist. Es ist nur so, daß die drohende Steigerung von Auschwitz - nämlich die atomare Auseinandersetzung - von ganz anderen Täter-Typen ausgehen wird, als sie sich in Auschwitz fanden, und daß das egoistische Einzelinteresse deren Entscheidungsebene gar nicht mehr erreicht.
Die politischen Zukunftsprobleme schon der heutigen und erst recht jeder weiteren jungen Generation haben mit dem Nationalsozialismus wenig zu tun. Massenarbeitslosigkeit kann zwar wieder zu Rassismus und Fremdenhaß führen, aber die damit verbundenen Gefahren antidemokratischer Bestrebungen kann man nicht als Wiederholung des Nationalsozialismus verstehen, weil dieser den damaligen "Modernitätsrückstand" der Gesellschaft zur notwendigen Voraussetzung hatte. In einer hochmodernen Gesellschaft wie der unseren müßte man die demokratische Struktur auf ganz andere Weise aus den Angeln heben als zur Hitlerzeit. Der Blick auf die Vergangenheit könnte also eher blind machen für die wirklichen Gefahren von morgen. Auch das Problem von Krieg und Frieden stellt sich heute, im Atomzeitalter, qualitativ anders, sowohl in politischer wie in strategischer Hinsicht, und
468
das Problem der Umweltzerstörung ist gerade eines der Modernität, der ungehemmten Entfaltung aller technischen Möglichkeiten. Für diese Zukunftsfragen:
- Wie kann man die demokratische Struktur von Staat und Gesellschaft unter den gegenwärtigen Bedingungen erhalten?
- Wie kann man die gesellschaftliche Arbeit gerecht verteilen und damit das System der sozialen Sicherung bewahren beziehungsweise reformieren?
- Wie kann man den Frieden wahren und vor allem eine atomare Auseinandersetzung verhindern ?
- Wie können wir unsere Umwelt retten?
Dafür gibt der Blick in die NS-Vergangenheit wenig oder gar nichts her.
Die politische Bildung braucht also eine neue Legitimation, nämlich als Bürgerrecht und als professionelle pädagogische Tätigkeit. Wird das akzeptiert, dann ergeben sich daraus unter anderem folgende Konsequenzen:
1. Der Staat als Schulmonopolist hat keine Legitimation mehr zu irgendeiner Art von politischer "Erziehung" im engeren Sinne des Wortes, also dazu, das Verhalten seiner (jungen) Bürger in einer bestimmten Weise langfristig und dauerhaft zu prägen. Auch von Schülern kann der Staat nur dasjenige Verhalten erwarten, daß er von allen seinen Bürgern verlangen darf, nämlich Legalität, beziehungsweise überhaupt die Respektierung der jeweils gültigen institutionellen Regeln - zum Beispiel in der Schule. (Was Änderungsversuche auf den dafür vorgesehenen Wegen selbstverständlich einschließt). Wünschenswert wäre darüber hinaus ein bestimmter politisch-kultureller Stil etwa in politischen Auseinandersetzungen und ein "kritischer Respekt" gegenüber staatlichen Institutionen und deren Repräsentanten - und die Schulen sollten dies einüben. Das aber ist in dem Augenblick vergeblich, wo die politische Kultur außerhalb der Schulmauern dem nicht entspricht. Abgesehen davon bleibt das aktuelle und spätere politische Verhalten der Lernenden gleichsam ihr Eigentum, steht also weder dem Staat noch der pädagogischen Profession zur Disposition. Er muß dabei das Risiko eingehen, daß aus denselben Schulen sowohl gesetzestreue Staatsbürger wie Terroristen hervorgehen können, zumal er dieses Risiko auch durch keine denkbare pädagogische Intervention ausschließen könnte. Es haftet jeder Aufklärung an. Allerdings hat der Staat als Schulmonopolist das Recht und die Pflicht, Agitation ( = Aufforderung zu einem bestimmten Handeln) und Indoktrination ( = einseitige Information zu demselben Zweck) zu verhindern und durch seine Lehrer diejenigen Bedingungen in den Schulen durchzusetzen, die für einen geordneten Unterricht notwendig sind. Stellungnahmen pädagogischer Funktionsträger oder politischer Gremien (z. B. KMK) sind für den politischen Unterricht nur Material, das sich von anderen Materialien zum Beispiel aus Wissenschaft und Publizistik lediglich durch seinen besonderen "Quellenwert" unterscheidet (wenn der Bundespräsident sich zu etwas politisch äußert, dann ist das etwas anderes, als wenn sich irgendein anderer Bürger ebenso äußert. Dies nicht zu sehen, ist unprofessionell und wirklichkeitsfremd). Folgerichtig sind Lernzielvorgaben
469
unzulässig, die das gegenwärtige und/oder künftige politische Verhalten der Schüler dauerhaft beeinflussen wollen und die nicht aus der Sache selbst resultierende Wissens- und Erkenntnisziele sind.
2. Dieser staatlichen Distanz muß auf der anderen Seite eine politisch-pädagogische Professionalität entsprechen, die ebenfalls nicht über die Lernergebnisse verfügen will. Die Aufgabe dieser Profession ist, Lernen zu ermöglichen. Das setzt voraus, daß es von ihr auch etwas zu lernen gibt, also Sachkunde. Ohne sie wird didaktisch-methodisches Geschick zum Selbstzweck. In ihrem Selbstverständnis ist kein Platz für Agitation und Indoktrination, vielmehr sind "Wahrheit" und "Richtigkeit" die leitenden Ideen. "Richtigkeit" bezieht sich auf Tatsachen, "Wahrheit" kann nur interpretatorisch angestrebt werden, gemeinsam mit anderen, gerade auch mit dem politischen Gegner, und ist wegen des immer offenen Interpretationsspielraumes nur annäherungsweise erreichbar. Aber ohne diese leitende Idee würde politische Bildung in der Unmittelbarkeit der Existenz, der unaufgeklärten Interessen und Bedürfnisse und des bloßen Meinens befangen bleiben.
Das Geschäft der pädagogischen Profession ist also "Aufklärung", Aufklärung über die (politische) Welt, aber auch zumindest mittelbar über die je individuellen Interessen, Bedürfnisse, Vorurteile und Gegnerschaften, insofern diese dazu angehalten werden, sich an außersubjektiven Realitäten abzuarbeiten. "Aufklärung" heißt zum Beispiel, daß der Lehrer die substantiellen Fragen stellt, die die Schüler nicht stellen, und daß er dies gerade auch dann tut, wenn ihm die politische Meinung des Schülers sympathisch ist. Einseitiges politisches Denken beruht ja im wesentlichen darauf, daß zu wenig substantielle Fragen (etwa im Sinne meiner "didaktischen Kategorien") (3) gestellt werden, beziehungsweise die Antworten nicht nach den Maßstäben von "Richtigkeit" und "Wahrheit" gesucht werden.
3. Stellt man nun die didaktische Grundfrage, was warum im Rahmen der politischen Bildung gelernt werden soll, dann muß man wichtige Veränderungen berücksichtigen, die in den letzten vierzig Jahren zu verzeichnen sind und die sich in der Geschichte der didaktischen Konzeptionen wiederspiegeln. Nach dem Kriege herrschte eine humanistisch-moralische Reflexion über die privaten und öffentlichen Werte vor, die der Nationalsozialismus mißachtet hatte. In den 50er Jahren hatte sich das schon erwähnte antikommunistische "Totalitarismus-Modell" durchgesetzt. Mitte der 60er Jahre entstanden "konfliktorientierte" Ansätze, als Widerspiegelung der Tatsache, daß grundlegende innere Widersprüche unserer Gesellschaft auf die politische Tagesordnung gesetzt wurden. In den 70er Jahren schließlich wurden - neben neo-marxistischen Positionen, denen es um die "richtige" Theorie der Gesellschaft ging und die didaktisch unergiebig blieben - subjektorientierte Konzepte formuliert: Die Interessen und Erfahrungen der Schüler sollten im Mittelpunkt stehen.
470
Damit sind im Grunde alle wesentlichen Möglichkeiten des Verhältnisses von Sache und Subjekt durchgespielt, und es hat wenig Sinn, für die eine oder andere Position Partei zu ergreifen. Jede von ihnen hat wichtige Aspekte der didaktischen Problematik hervorgehoben, zum Beispiel haben die subjektorientierten - wenn auch meist unbewußt - der Tatsache Rechnung getragen, daß die frühere "politische Exterritorialität" des Jugendalters Zug um Zug verschwunden ist, die alle politische Bildung zur Propädeutik für künftige Rechte und Pflichten machte; nun sind Jugendliche, die früher von ihren Eltern politisch gegenüber der Öffentlichkeit vertreten wurden, selbst unmittelbar zu politischen Subjekten und Objekten geworden.
Es scheint mir an der Zeit zu sein, die Frage nach dem Inhalt der politischen Bildung wieder einmal "von unten" anzugehen, also aus der Perspektive der Menschen selbst und nicht im Sinne einer Fortschreibung oder Variation der vorliegenden didaktischen und currikularen Theorien, die, an den Universitäten hoffähig geworden, eher nach den Regeln des Wissenschaftsbetriebes sich weiterentwickeln als durch Orientierung an der politischen Realität. Sieht man sich also die Wirklichkeit unvoreingenommen an, so fällt auf, daß wir inzwischen eine hochentwickelte politische Publizistik haben, die zum Beispiel über das Fernsehen jede Familie täglich erreicht und von deren technischen Möglichkeiten, politische Probleme zu präsentieren, jeder Politiklehrer nur träumen kann.
Literatur verstehen lernt man durch das Lesen literarischer Werke, Politik verstehen lernt man durch Teilnahme an der politischen Publizistik. Aufgabe der politischen Bildung kann also nichts anderes sein, als zur Teilnahme an der politischen Publizistik zu befähigen; zumal in Schulen ist sie also nichts anderes als eine Dienstleistung dafür. Nimmt man diesen Grundsatz an, dann hört politische Bildung in der Schule auf, Selbstzweck zu sein, die von der Umerziehung herrührenden politischen Erwartungen an sie werden gegenstandslos, die bildungspolitischen Auseinandersetzungen über Richtlinien erweisen sich ebenso als Fiktionen, wie die dickleibigen Richtlinien lächerlich werden. Die eigentliche politische Bildung übt für die meisten Menschen heute das Fernsehen aus. Jugendliche, die sich zu Hause nicht für politische Sendungen interessieren, werden sich auch in der Schule nicht für Politik interessieren, dort zeigen jedenfalls eher die Interesse, die sich auch zu Hause dafür interessieren. Ein wichtiges Teilziel wäre also, Schüler in diesem Sinne zum Gebrauch des Fernsehens zu bewegen. Politische Bildung wäre also Vor- und Nachbereitung des Fernsehens, beziehungsweise Einüben zum Gebrauch der politischen Publizistik.
Die eigentlichen Politiklehrer der Nation sind längst die Journalisten - von BILD bis Monitor, und ihre Texte sind die eigentlichen Schulbuchtexte, deshalb haben die kulturpolitischen Auseinandersetzungen sich längst von der Schule auf das Fernsehen verlagert. Auch dies gehört zur pädagogischen Professionalität, nämlich einzusehen, daß längst nicht mehr die Schule das politische Bewußtsein prägt, sondern die Publizistik, und daraus die Konsequenzen zu ziehen. Wie immer man über die Publizistik denken mag, die Menschen bleiben ein Leben lang auf deren Informationen und Interpretationen angewiesen, und nur auf diese Weise können sie an politi-
471
schen Handlungen und Entscheidungen überhaupt teilnehmen, die außerhalb ihres unmittelbaren Horizontes stattfinden, und das sind die meisten und vor allem die wichtigsten, weil folgenreichsten. Politische Bildung als Dienstleistung für den verständigen Gebrauch der politischen Publizistik - das mag das Selbstverständnis so manchen Politiklehrers zunächst irritieren, aber andererseits ermöglicht diese Perspektive eben auch eine neue Präzisierung der spezifischen, das heißt von niemandem sonst zu leistenden Aufgabe der politischen Bildung. Es sind im wesentlichen zwei:
1. Der politische Unterricht muß das Interpretieren politischer Handlungen üben.
2. Er muß grundlegendes Orientierungswissen vermitteln.
Wenn ich morgens die Zeitungen lese, dann erfahre ich, worüber in unserem Land politisch gestritten wird. Ich nehme die unterschiedlichen Stellungnahmen der Parteien und Verbände zur Kenntnis und versuche herauszufinden, welche Wirklichkeit dabei eigentlich zur Debatte steht. Aber wie sehr ich mich auch bemühe, von den unterschiedlichen Meinungen abzusehen, die ich lese, und die Sache selbst herauszufinden, um die es geht, es will mir nicht recht gelingen. Gewiß: Meist sind bestimmte Tatsachen erkennbar, aber die ergeben für sich genommen keinen Sinn. Die Wirklichkeit, über die ich lese, ist das Handeln anderer Menschen. An diesem Handeln bin ich nicht beteiligt, aber ich muß davon ausgehen, daß seine Folgen mich treffen könnten. Daher rührt mein Interesse an Politik. Politisches Handeln ist anderen aber nur verständlich zu machen, wenn man es begründet, kommentiert und interpretiert. Ein gutes Beispiel dafür war in jüngster Zeit das umstrittene Motto des Schlesiertreffens. Ein kleiner Slogan: "Vierzig Jahre Vertreibung - Schlesien bleibt unser" löste eine heftige Diskussion aus. Sie ging im Kern darum, von wem dieser Slogan wie interpretiert werden und welche politischen Folgen dies im In- und Ausland haben könnte. Deuten ließ sich dieses Motto sowohl als aggressiver Anspruch wie auch als verinnerlichte Verbundenheit. Genau das aber war das Politische daran: daß die Formulierung einen derart großen Interpretationsspielraum zuließ.
Offensichtlich gibt es gar keine politische Wirklichkeit ohne die Meinungen darüber, die Meinungen selbst sind ein wichtiges Stück dieser Wirklichkeit. Gäbe es nicht unterschiedliche politische Meinungen über eine Sache, so gäbe es auch diese Sache als eine politische nicht. Mit anderen Worten: politische Wirklichkeit wird durch Interpretation hergestellt. Wenn zum Beispiel alle mit dem bestehenden System der Rentenversicherung einverstanden sind, ist die Rentenversicherung auch kein politisches Thema, sondern ein administratives Regelsystem. Wenn alle Frauen mit ihren Lebensverhältnissen einverstanden wären, oder wenn die Unzufriedenen ihre Unzufriedenheit zur Privatsache erklärten, gäbe es keine Frauenbewegung als politische Wirklichkeit. Politische Wirklichkeit ist also immer interessenbedingte Interpretation von Sachverhalten, und eine solche Interpretation wird dann politisch relevant, wenn sie öffentliche Aufmerksamkeit erregen kann, wenn sie also ein Mindestmaß an Macht erworben hat. Meine politische Selbstbildung bei der Zeitungslektüre besteht also darin, daß ich mich an der Interpretation der politischen Wirklichkeit beteilige.
472
Was ich hier beschreibe, ist die alltägliche Situation der Bürger, die sich überhaupt für Politik interessieren: Sie versuchen, sich ein Bild zu machen von politischen Handlungsabläufen und eventuell selbst handelnd darauf zu reagieren und sei es nur bei der nächsten Wahl. Um politische Handlungen zu interpretieren, brauche ich politische Kategorien, also Fragen, die ich prüfen und beurteilen kann. Zumindest muß ich in der Lage sein, wenigstens versuchsweise aus der Perspektive der einzelnen Positionen zu denken, diese nachzuvollziehen. In meiner "Didaktik der politischen Bildung" habe ich solche Kategorien vorgeschlagen. Die Schulbuchautoren sind hier die Journalisten, ihre Texte beziehungsweise Präsentationen sind das "Übungsmaterial". (Auch die Reden von Politikern, beziehungsweise die Stellungnahmen politischer Gremien erreichen uns ja nicht per Postwurfsendung, sondern durch journalistische Vermittlung). Im Videozeitalter können dafür auch Fernsehmitschnitte mühelos verwendet werden. Zu empfehlen ist, dieses Übungsmaterial thematisch auf die vorhin skizzierten wichtigen Zukunftsprobleme zu konzentrieren.
Wenn dieses Interpretieren nicht geübt wird - und dies können die Massenmedien nicht leisten, die müssen die Fähigkeit dazu voraussetzen - dann lernt man kaum, "kognitive Dissonanz" zu ertragen, sondern wird bei den im Rahmen der politischen Sozialisation erworbenen Meinungen bleiben und die diese bestätigenden Informationen und Meinungen weiter positiv selegieren.
Die Schule tut sich mit dieser Aufgabe deshalb schwer, weil dieses Interpretieren selbst eine Form des politischen Handelns ist, das die Schule als solches nicht bewerten kann. Der Lehrer hat hier zwar insofern einen fachlichen professionellen Vorsprung, als er die Regeln des Interpretierens geltend machen muß, aber in der politischen Gesamtbeurteilung, die dabei herauskommt, gilt seine Meinung nicht mehr als die der Schüler, so wenig, wie seine Stimme bei der Wahl mehr gelten würde.
Verständlicherweise ist das Interpretieren politischer Handlungen und der dadurch definierten Probleme in besonderem Maße anfällig für Indoktrination und Agitation. Nur eine wirklich souveräne Professionalität kann sich davor schützen. Zum anderen sind die Ergebnisse von Interpretationen offen, also nicht durch Lernziele festlegbar und insofern auch nicht durch die Administration kontrollierbar. Bewertbar - im Sinne von Zensuren - ist hier nicht das Ergebnis sondern nur das Verfahren (ob und wie Kategorien angewendet wurden).
Nun könnte man einwenden, daß das Interpretieren politischer Handlungen zwar in der Tat geübt werden müsse, daß dies aber zweckmäßiger im Rahmen des Geschichtsunterrichts geschehe, weil die zeitliche Distanz von der Unmittelbarkeit des eigenen Verwickeltseins in die politische Aktualität entlaste. Gerade unter dem Aspekt der politischen Bildung läßt sich gegen diese erneute Betonung des Geschichtsunterrichts zumal mit einer derartigen Begründung sicher nichts einwenden. Aber zwei Einwände drängen sich auf, wenn auf diese Weise der politische Unterricht ersetzt werden sollte. Es kommt weniger darauf an, daß irgendwelche politischen Handlungen interpretiert werden, sondern solche, die vom Inhalt her eine wirkliche Bedeutung für die Gegenwart und vor allem die Zukunft der heute
473
Lebenden haben. Der zweite Einwand ergibt sich mehr oder weniger daraus: Im allgemeinen dürfte die Motivation höher sein, wenn die Interpretation politischer Handlungen gegenwarts- und zukunftsorientierte und nicht vergangene, mehr oder weniger historisch "erledigte" Probleme zum Thema hat.
Eine weitere Aufgabe der politischen Bildung, wenn sie zur Teilnahme an der politischen Publizistik befähigen soll, besteht in der Vermittlung eines grundlegenden Orientierungswissens. Aufgabe der Schule ist ja allgemein, die nachwachsende Generation einzuführen in die Welt, in der sie lebt, diese Welt zugänglich und verstehbar zu machen. Zu dieser Welt gehört auch die politisch-gesellschaftliche Verfaßtheit unseres Zusammenlebens. Durch systematischen Unterricht ergibt sich die Möglichkeit, die Unmittelbarkeit unserer Existenz zu überschreiten, uns angemessene Vorstellungen auch über die Wirklichkeiten anzueignen, die jenseits unseres unmittelbaren alltäglichen Lebenshorizontes liegen. Derartige systematische Vorstellungsstrukturen zum Beispiel über das politische System, über die Arbeitswelt, über das System der sozialen Sicherung usw. können die Massenmedien ebenfalls nicht bewirken, sie müssen sie vielmehr voraussetzen; denn lernbar sind sie nur in unmittelbaren pädagogischen Situationen, wo Dialoge und damit Rückfragen und immer erneute sachorientierte Verständigungen möglich sind.
Ich verstehe diese Zielsetzung, zur Partizipation an der politischen Publizistik zu befähigen, als Mindestforderung für möglichst alle Schüler, also für die Sekundarstufe I. Selbstverständlich kann es nur begrüßt werden, wenn darüber hinaus etwa in der Sekundarstufe II oder in außerschulischen Bildungseinrichtungen mehr getan wird, etwa im Sinne der Hinführung zu wissenschaftlichen und philosophischen Texten.
Diese Zielvorstellung - Hinführung zur politischen Publizistik - hätte unter anderem folgende Konsequenzen:
1. Die politische Bildung hätte wieder eine klare und realisierbare Perspektive, die sie gegenwärtig deshalb nicht mehr hat, weil ihre politische Begründung ("Demokratie schaffen und schützen") fragwürdig geworden ist.
2. Die Richtlinienmacher und die didaktischen Autoren wären ungemein entlastet. Die ganze Legitimationsproblematik wäre gegenstandslos, weil es keine didaktische "Eigen-Welt" und keinen schulischen "Eigen-Sinn" des Politischen mehr gäbe. Man muß nicht mehr grundsätzlich darüber streiten, ob der Unterricht mehr "schülerzentriert" oder mehr "sachorientiert" sein soll. Die Richtlinien könnten sich - wie in der "vor-currikularen Zeit" - beschränken auf die Themen des Orientierungswissens und auf die kategoriale Struktur des politischen Interpretierens.
3. Die politisch-pädagogische Profession müßte sich endlich mit den Medien als Selbstzweck befassen und die Vorstellung aufgeben, diese seien nur ärgerliche Konkurrenten der Schule, die verhindern, daß die Schulweisheit an den Mann (und an die Frau) gebracht werden kann.
474
Anmerkungen:
(1) Anders O. Lafontaine, der professionelle Maßstäbe geltend macht: "Warum, bitte schön, soll ein junger Kommunist nicht Briefträger oder Lehrer sein, wenn er nur seine Arbeit richtig macht? Dies ist das einzige Kriterium - und nicht, zu welcher politischen Partei sich einer bekennt". (Der Spiegel Nr. 27/1985, S. 84)
(2) Th. W. Adorno: Erziehung nach Auschwitz. In: Ders.: Stichworte. Kritische Modelle 2. Frankfurt 1969, S. 85ff.
(3) Vgl. H. Giesecke: Didaktik der politischen Bildung. München 12. Aufl. 1982.

143. Wer braucht Freizeitpädagogen? (1985)
(In: Neue Sammlung, H. 1/1985, S. 99-101)
Christiane Müller-Wichmann: Zeitnot. Untersuchungen zum "Freizeitproblem" und seiner pädagogischen Zugänglichkeit. Beltz-Forschungsberichte. Beltz-Verlag, Weinheim/Basel 1984, 284 S., DM 43,-.
Seit die Arbeitszeit für Arbeiter und Angestellte wieder verkürzt wird - sie ist ja erst in der Neuzeit so unerträglich ausgedehnt worden - gibt es die Sorge, vor allem die Arbeiter könnten mit dem Zuwachs an Freizeit nichts oder das Falsche anfangen. Schon die gesetzliche Einführung des arbeitsfreien Sonntags im Jahre 1891 rief Pfarrer und Sozialpolitiker auf den Plan, die überlegten, wie man den Arbeitern
98
helfen könnte, ihre Freizeit "sinnvoll" zu verwenden und zum Beispiel nicht für einen unsittlichen Lebenswandel oder für politisch radikale (sprich: sozialistische) Umtriebe - nach dem Motto, Müßiggang sei aller (politischen) Laster Anfang.
Gegenwärtig wird um die 35-Stunden-Woche gekämpft. Zwar bestreitet heute kaum jemand mehr das Recht der Menschen auf Freizeit und Genuß, aber in der öffentlichen Meinung, bei den zuständigen Wissenschaften und vor allem bei den Sozialpolitikern und Freizeitpädagogen hält sich nach wie vor die Vorstellung, Arbeitszeitverkürzung sei Freizeitverlängerung und die führe zu Freizeitproblemen.
Diese Vorstellung attackiert Christiane Müller-Wichmann in ihrem Buch mit dem treffenden Titel "Zeitnot" nachdrücklich und überzeugend. Ausgehend von ihrer persönlichen Erfahrung - die ich teilen kann - , daß man immer nur auf Leute treffe, die "keine Zeit" haben, die also buchstäblich in "Zeitnot" sind, geht sie der Frage nach, was aus der Zeit eigentlich geworden ist, die wir durch die Verkürzung der Arbeitszeit über Jahrzehnte hinzugewonnen haben.
Freizeit - so das Ergebnis - im Sinne einer wirklich disponiblen Zeit, die also für Handlungsalternativen zur Verfügung stünde, ist sehr viel knapper, als die soziologischen "Zeit-Budget-Erhebungen" zunächst vermuten lassen. Ein großer Teil der arbeitsfreien Zeit wird benötigt für soziale Verpflichtungen im Rahmen der "Reproduktionsarbeit". Die Verfasserin zeigt eindrucksvoll, "daß für die Mehrzahl der Bevölkerung der Umfang zu leistender Reproduktionsarbeit zugenommen hat: sei es, daß sie aus dem Nichts erstanden ist, wie bei der Masse des ehemaligen Land- und Industrieproletariats - sei es in dem Verstande, daß ihre Delegation an Dienstboten zunehmend durch Eigenerstellung abgelöst werden mußte, wie beim gesamten Kleinbürgertum und weit ins Bürgertum hinein" (S. 112).
Zudem sind die Anforderungen für die Alltagsbewältigung erheblich gestiegen: Man braucht mehr Kenntnisse und höhere Fähigkeiten dazu, ein Teil der Lektüre und des Fernsehkonsums wird davon beansprucht. "Konsumarbeit", "Sozialisationsarbeit" und "Beziehungsarbeit" haben sich qualitativ und quantitativ ausgeweitet. Für die "Konsumarbeit" muß man heute unter Umständen mehr lebenslang lernen als im Hinblick auf technologische Umstellungen am Arbeitsplatz. Kein Wunder also, daß die meiste "disponible" Zeit Männer aus der Oberschicht haben, die wenigste Frauen aus der Unterschicht. Hinzu kommt das Problem der "Zeitautonomie".
"Da die Nutzungsmöglichkeit von Zeit von sozialen Rahmenbedingungen abhängt, erst der Kontext Zeit zum nutzbaren Gut macht, ist Zeit zur falschen Zeit wertlos. Deshalb kann über seine Zeit wirklich verfügen nur jemand, der auch über den Zeitpunkt verfügen kann, zu dem er über Zeit verfügt" (S. 173).
Entscheidend ist also, in welchem Maße man über seine Arbeitszeit disponieren kann, aber auch, ob man sich Zeit "kaufen" oder sie "sparen" kann. Die Ressource "Zeit" ist also höchst ungleich verteilt, nicht nur unter den sozialen Schichten, sondern auch unter Männern und Frauen.
"... nicht Überfluß, sondern Mangel (produziert) das sogenannte Freizeitproblem: Mangel an Zeit, Mangel an Dispositionsmöglichkeiten über Zeit, Mangel an Handlungsmöglichkeiten jenseits von Zeitreservaten" (S. 189).
99
So gesehen hat Freizeitpädagogik im Grunde nur eine Klientel in Reservaten von Jugendlichen, alten Menschen und Urlaubern, nicht in der erwachsenen Aktivbevölkerung; hier gibt es kein nennenswertes Vakuum, das auf freizeitpädagogische Erfüllung wartet.
Dieses gut geschriebene, mit Ironie und sensiblen Attacken nicht sparende Buch erscheint mir sehr wichtig für unsere Vorstellungen über Freizeitprobleme und vor allem für das Selbstverständnis unserer sogenannten "Freizeitpädagogik". Sein Verdienst liegt in erster Linie darin, daß es nicht nur der öffentlichen Meinung in dieser Sache mißtraut, sondern auch den Daten der empirischen Sozialwissenschaften, die vielmehr methodologisch überzeugend "gegen den Strich" interpretiert werden. Dabei wendet sich der Blick auf die Komplexität unserer Alltagskultur, auf den gesamten Zusammenhang der menschlichen Tätigkeiten und Verpflichtungen und macht den Weg frei für qualitative Perspektiven. Fernsehkonsum zum Beispiel erscheint dann einerseits als notwendige Information für die Gestaltung des Reproduktionsbereiches, andererseits als entspannendes "Dösen", steht also in der einen wie der anderen Form freizeitpädagogischen Alternativen kaum zu Verfügung. So lassen sich die meisten Freizeittätigkeiten als mehr oder weniger notwendige soziale, informatorische oder entspannende Aktivitäten beziehungsweise Passivitäten interpretieren.
Nun bedeutet dies allerdings zunächst nur, daß die Menschen im allgemeinen keine Freizeitpädagogen brauchen, um subjektiv "sinnvoll" ihre Zeit zu verbringen. Andererseits stellt sich aber auch die Frage, inwieweit die angestiegene Reproduktionsarbeit auch "objektiv" unausweichlich ist. Man kann ja durchaus akzeptieren, daß Freizeitpädagogen sich auf den Markt der Anbieter begeben und dabei für normative Alternativen werben; denn die Reproduktionsarbeit ist zum guten Teil ja auch das Ergebnis massenmedialer Manipulationen und durch Werbung aufgedrängter wechselnder Moden. Nützt zum Beispiel die angewachsene "Sozialisationsarbeit" den Kindern immer, oder wäre oft weniger nicht besser? Die moderne Haushaltstechnologie vermag nicht nur die Männer, sondern auch die Kinder in die notwendige Hausarbeit einzubeziehen. Die Tatsache, daß viele Menschen sich für eine bestimmte Verwendung ihrer Zeit entschieden haben, beweist noch nicht, daß sie sich nicht auch anders entscheiden könnten, daß es sich dabei also nicht um eigentlich "disponible Zeit" handelt. Soziale Verpflichtungen lassen sich auch in gewissen Grenzen reduzieren. Die Vernünftigkeit des tatsächlichen "Freizeitverhaltens" öffentlich zu erörtern ist nicht überflüssig geworden, gerade die aufgeklärten Mittelschichten hätten hier durchaus Alternativen.
Allerdings stützt auch diese Anmerkung nur die Hauptthese der Verfasserin, daß es ein "Zeitvakuum", das der freizeitpädagogischen Hilfe bedürfte, nur in sozialpädagogischen Randfeldern gibt; schon immer haben die meisten Leute gewußt, was sie mit hinzugewonnener Zeit tun sollten, und auch mehr davon würde sie keineswegs langweilen, aber sie wohl auch nicht von der "Überlast" befreien, die ihnen Produktions- und Reproduktionsarbeit aufhalsen; denn eine solche "Überlast" kann wohl nur empfinden, wer sich Alternativen zumindest wünschen kann. Das Problem aber, seinen Zeithaushalt auszugleichen, wird mit zunehmender erwerbsarbeits-
100
freier Zeit nicht geringer, sondern größer, weil auch die realisierbaren Alternativen zunehmen. Das faktische Freizeitverhalten muß also keineswegs ausschließen, daß nicht mancher auch anderes wählen würde, wenn ihm dafür ein attraktives Angebot gemacht würde, aber dann müßten "Freizeitpädagogen" Menschen sein, von denen etwas zu lernen sich lohnt. Dafür aber werden sie in der Regel nicht ausgebildet.
Nicht die "Freizeit" ist ein pädagogisches Problem - auch diese These verdient Unterstützung - sie ist auch für sozialpädagogische Randgruppen vielmehr nur die Zeitspanne, in der Probleme besonders sichtbar werden, zum Beispiel Identitätskrisen und fehlende Perspektive bei Jüngeren, soziale und emotionale Vereinsamung bei Älteren. "Freizeit" war immer nur die Bedingung der Möglichkeit für etwas, sie hatte nie von sich aus irgendeinen Sinn, deshalb plädiert die Verfasserin unter anderem mit zeit-philosophischen und sozialgeschichtlichen Begründungen, aber auch durch die Interpretation von Alltagserfahrungen überzeugend dafür, die wirklichen Menschen in ihren tatsächlichen Alltagsverpflichtungen und sozialen Beziehungen und Abhängigkeiten in den Blick zu nehmen.
Dieses Buch wird zweifellos die gegenwärtige Freizeitpädagogik zu einer Überprüfung ihres Selbstverständnisses zwingen.
101
144. Jugend in der bürgerlichen Gesellschaft (1985)
(In: W. Twellmann (Hrsg.): Handbuch Schule und Unterricht, Düsseldorf 1985, Bd.7,2, Sp. 1272-1279)
I. Die Entstehung der Jugendphase
"Jugend" als eigenständige soziale Gruppe, die sich von anderen Altersgruppen abhebt beziehungsweise von ihnen separiert wird, ist ein Produkt der modernen bürgerlichen Gesellschaft, also keine biologische Notwendigkeit. Die ständische Gesellschaft kannte solche Ausgliederungen nicht, hier waren vielmehr die jungen Menschen selbstverständlich in die unmittelbaren sozialen Zusammenhänge und damit in das Leben der Erwachsenen integriert. Die Ausgliederung des Jugendalters ist Teil jenes gesellschaftlichen Differenzierungsprozesses, der charakteristisch für die moderne bürgerliche Gesellschaft ist, in dessen Mittelpunkt die Organisation der modernen Arbeit und das kapitalistische Verwertungsinteresse traten, denen sich alle anderen Sozialitäten zuordneten: Die Familie wird Stätte der Reproduktion der Arbeitskraft und Ort ihrer Rekreation; Schule dient der Ausbildung der Arbeitskraft sowie der Erziehung zur Loyalität gegenüber den gesellschaftlichen Normen. "Unbrauchbare" beziehungsweise nur begrenzt Brauchbare werden ausgegliedert beziehungsweise marginalisiert (z. B. Arme. Alte und Irre). Die "arbeitszentrierte" Gesellschaft bestimmt nun auch die Biographie der Menschen: Kinder und Jugendliche werden auf ihre berufliche Position vorbereitet, als Erwachsene üben sie die Erwerbstätigkeit aus, als Pensionäre verlassen sie die Arbeitswelt wieder. Allerdings gibt es eine von Arbeitsverpflichtungen befreite Jugendphase zunächst und für lange Zeit nur für die Kinder und Jugendlichen des Bürgertums, während die Jugend des Proletariats und die Landjugend früh in den Arbeitsprozeß eingegliedert wurde und insofern keine eigenständige Jugendphase erleben konnte. Daß aber grundsätzlich allen Jugendlichen eine von Erwerbsarbeit entlastete Jugendphase zu gewähren sei, blieb bis in die Gegenwart hinein eine sozialpolitische und sozialpädagogische Leitvorstellung.
Je höher die Qualifikationsanforderungen vor allem für mittlere und gehobene berufliche Positionen wurden, um so länger wurde vor allem für das Bürgertum, das sich diese Positionen zu reservieren trachtete, die Ausbildungs- und damit Jugendzeit. Sie ist gekennzeichnet durch finanzielle Abhängigkeit - zunächst nur von der Familie, inzwischen auch von der öffentlichen Hand (z. B. Stipendien) - und fehlende Selbständigkeit. Die ökonomische Abhängigkeit wurde unterstützt durch die rechtliche Abhängigkeit von den Eltern, vor allem vom Vater, die bis zur Volljährigkeit galt (21 Jahre, inzwischen 18 Jahre).
1272
Das Privileg einer Jugendphase zwischen dem Status der Kindheit und dem Status des Erwachsenen gab es ferner zunächst nur für die bürgerlichen jungen Männer, nicht auch für die Mädchen. Das hängt zusammen mit der für die bürgerliche Gesellschaft typischen Arbeitsteilung der Geschlechter: Der Mann braucht die Familie als sozial-emotionalen Stützpunkt, der ihn flexibel macht für die wechselhafte und ungesicherte Existenzsicherung außerhalb des Hauses; innerhalb der Familie repräsentiert er daher das "Realitätsprinzip", die Ansprüche und Anforderungen der kapitalistischen Leistungswelt und die dafür erforderlichen Tugenden: Disziplin, Härte, Selbstverleugnung. Durch seine Arbeit garantiert er die Zukunft seiner Kinder. Die Frau hingegen blieb zuständig für das familiäre Heim, vertrat die familiären Tugenden wie Wärme, Nachsicht, Hingabe, Fürsorge. Um diese Fähigkeiten zu erwerben, benötigten die Töchter nicht im gleichen Sinne wie die Söhne eine eigenständige Jugendphase. Das änderte sich erst in dem Maße, wie die Frau Gleichberechtigung im Berufsleben erhielt - ein Prozeß, der bis heute nicht abgeschlossen ist. Der Austritt der Frau aus der Familie aber führte nicht nur dazu, daß das Mädchen ebenfalls eine von Erwerbsarbeit freie, der Erziehung und Bildung dienende Jugendphase erhielt, sondern auch zu einer Änderung der Familienstruktur im Hinblick auf die Arbeitsteilung der Geschlechter. Die "männliche" und "weibliche" Rolle, wie sie gegenüber den Kindern eingenommen wurden, glichen sich an; denn in dem Maße, wie auch die Mutter in die Realitäten außerhalb der Familie verwickelt wurde, mußte sie innerhalb der Familie folgerichtig nun ebenfalls das "Realitätsprinzip" vertreten. Folgerichtig vertrat der Vater nun auch immer mehr die früher den Müttern vorbehaltenen "weichen" Tugenden.
Das Idealbild einer für alle sozialen Schichten und für beide Geschlechter gültigen Jugendphase, in der Erziehung und Bildung zu einem höchstmöglichen Abschluß kommen können, in der Lebenspläne entworfen werden, das Bild also einer allgemeinen ",Kulturpubertät" (SPRANGER), eines "psychosozialen Moratoriums" (ERIKSON), an dessen Ende die Identität des Erwachsenen steht, ist inzwischen weitgehend Wirklichkeit geworden - allerdings mit dem Ergebnis einer "Zwangsemanzipation" der Jugendlichen von ihren Familien beziehungsweise ihrer Vergesellschaftung. Die Ausgliederung des Jugendalters nähert sich ihrem historischen Ende, Jugend erhält schon vor der Volljährigkeit faktisch Erwachsenenstatus.
Dieser Prozeß begann etwa gegen Ende des 19. Jahrhunderts und läßt sich an der bürgerlichen Jugendbewegung vor dem ersten Weltkrieg deuten. Die berühmte "Meißner-Formel" drückt dies aus, die bei dem Treffen der Gruppen der Jugendbewegung auf dem Hohen Meißner 1913 formuliert wurde: "Die freideutsche Jugend will aus eigener Bestimmung, vor eigener Verantwortung, mit innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten".
Mit diesem Satz wird zunächst einmal das Erziehungsmonopol der Familie und der Schule durchbrochen, indem ein Freiraum beansprucht wird, der der Kontrolle jener Erziehungsmächte prinzipiell entzogen ist und der "aus eigener Bestimmung" und "aus eigener Verantwortung" zu gestalten ist. Das ist aber nur möglich, weil die Familien, genauer: die Väter, die Zukunft ihrer Kinder nicht mehr (materiell)
1273
garantieren können. Die Jugend muß ihre Zukunft in eigene Verantwortung nehmen. Damit aber wird die Zukunft "offen", ist nicht mehr unbedingt die Fortschreibung der familiären Vergangenheit "nach vorne". Das Jugendalter wird zu einer Phase wichtiger persönlicher Entscheidungen, über berufliche Perspektiven ebenso wie über weltanschauliche Zugehörigkeiten. Der Maßstab für das eigene Handeln und Entscheiden kann nun aber nicht mehr einfach durch äußere Identifikationen gewonnen werden, etwa mit familiären Traditionen oder mit kirchlichen Normen, sondern muß zu einem guten Teil in die Innerlichkeit verlegt werden, in die "innere Wahrhaftigkeit". Indem aber diese Jugend den Raum der kontrollierenden Erziehungsmächte verließ und sich einen wenn auch zunächst noch so begrenzten Freiraum schuf, wurde sie auch öffentlich zugänglich für alle möglichen partikularen Ansinnen Erwachsener. Sie wurde - schon während des Meißner-Festes - umworben von politischen, lebensreformerischen und weltanschaulichen "Anbietern". Ein "Kampf um die Jugend" unter den Erwachsenen entbrannte, der in der Weimarer Zeit einen Höhepunkt erreichte und den die Nationalsozialisten durch Monopolisierung zu ihren Gunsten vorerst beendeten.
Dieser Prozeß der Vergesellschaftung des Jugendalters schlug sich nieder in der vor dem ersten Weltkrieg beginnenden, von Erwachsenenorganisationen bestimmten "Jugendarbeit" beziehungsweise "Jugendpflege". Es handelt sich dabei um Versuche, unter Aufgreifen der "Erfindungen" der bürgerlichen Jugendbewegung möglichst viele Jugendliche für die jeweils partikularen Ziele der Erwachsenenorganisation zu gewinnen. Aus innenpolitischen Gründen betrieb der Staat bis 1933 selbst keine Jugendpflege, unterstützte aber die ihm genehmen Erwachsenenorganisationen, weil ihm daran lag, auf diese Weise das Leben der jungen Menschen im Freizeitbereich, also außerhalb des Rahmens der überlieferten Erziehungsmächte, politisch wie erzieherisch unter einer gewissen Kontrolle zu behalten.
II. Das Verschwinden der Jugendphase
Überblickt man die Entwicklung des Jugendalters vom Entstehen der bürgerlichen Jugendbewegung vor dem ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart, dann läßt sich feststellen, daß die mit dem Aufkommen der bürgerlichen Gesellschaft entstandene Jugendphase wieder verschwindet; die Grenzen zwischen Jugendstatus und Erwachsenenstatus verschwimmen, auch die Kindheit als selbständige, eigentümliche Lebensphase wird kürzer. Dafür sind vor allem folgende Tendenzen beziehungsweise Veränderungen verantwortlich:
1. Die Jugendlichen erhalten Rechte, die bisher als Privilegien der Erwachsenen galten. Das betrifft etwa die Freizeitautonomie. Die traditionellen Erziehungsmächte - Familie, Schule, Kirche, Militär - verloren Zug um Zug an Einfluß auf die Lebensgestaltung jugendlicher Menschen. Das zeigt sich besonders eindrucksvoll am Beispiel des geradezu "klassischen" Erwachsenenprivilegs der Sexualität: sexuelles Verhalten wird mehr und mehr schon in der späten Kindheit, praktisch vom Beginn der Pubertät an, selbstverständlich. Das Jugendalter wird immer weniger "pädagogisch" definiert, also als eine Lebensphase, die einerseits vor
1274
"schädlichen Einflüssen" zu schützen sei (Jugendschutz) und die andererseits der Bildung im Sinne einer Vorbereitung auf das Erwerbsleben dient. Das Prinzip der bürgerlichen Gesellschaft, die Menschen als individuelle Rechts- und Vertragssubjekte zu definieren - ohne Rücksicht auf die sozialen Kontexte, in denen sie leben - hat sich inzwischen auch für Jugendliche durchgesetzt, während noch bis in die 60er Jahre die Familie davon ausgenommen war, insofern der Vater seine unmündigen Kinder gegenüber der Gesellschaft vertrat.
2. Nicht nur der Einfluß der traditionellen Erziehungsmächte ist geschwunden, sondern mit ihnen auch die Bedeutung der kulturellen Teilmilieus, deren Normen und Verhaltensstile Möglichkeiten der Identifikation anboten (z. B. Katholizismus, Protestantismus, Bildungsbürgertum, sozialistische Arbeiterbewegung). Hinzu kommt, daß auch die traditionellen Klassenschranken insofern gefallen sind, als das Bildungsprivileg des Bürgertums gebrochen ist, also jeder Jugendliche im Prinzip und weitgehend auch faktisch den seinen Fähigkeiten entsprechenden Bildungsgang wählen kann. Das bedeutet einerseits, daß die Jugendlichen als Individuen "gesamtgesellschaftlich unmittelbar" geworden sind, andererseits, daß der unmittelbare Einfluß von Erwachsenen auf das Verhalten Jugendlicher - sowohl ihr Erziehungs- wie Sozialisationseinfluß - weitgehend entschwunden ist. Abgesehen von der Familie treten Erwachsene den Jugendlichen im wesentlichen als Funktionäre gegenüber, zum Beispiel als Lehrer, Ausbilder, Politiker oder Verbandsvertreter. Das Generationsverhältnis, das traditionell als Erziehungsverhältnis verstanden wurde, hat also an Bedeutung und Wirkung erheblich verloren. Andererseits wurde der Erwachsenenstatus unklar, der ja nicht biologisch determiniert, sondern kulturell definiert ist. Gegenwärtig sind kaum noch kulturelle Differenzierungen erkennbar, die eine anschauliche und gesellschaftlich sanktionierbare Unterscheidung von Erwachsenen und Jugendlichen erkennen lassen. Aus der Perspektive von Jugendlichen folgt daraus, daß Erwachsenwerden vielfach unattraktiv wird, weil es sich kaum noch zu lohnen scheint, da kein Privileg in Sicht ist, das man im Jugendalter nicht schon hätte, zumal der Sozialstaat eine gewisse materielle Mindestversorgung garantiert. Eine solche Perspektive motiviert zum Beispiel nicht gerade zum Leistungsstreben. Zudem sind Probleme, die bisher als typisch für das Jugendalter angesehen wurden - zum Beispiel Identitätskrisen - keineswegs mehr auf diese Altersphase beschränkt. "Midlife-krisis" und die hohe Zahl der Ehescheidungen zeigen an, daß derartige Lebenskrisen auch bei Erwachsenen üblich werden.
3. In dem Maße, wie die traditionellen Erziehungsmächte, die kulturellen Teilmilieus und das Generationsverhältnis an Einfluß verlieren, übernimmt die massenmedial verbreitete, egalisierende Freizeitkultur die Aufgabe der kulturellen Steuerung und Orientierung. Die Freizeitkultur ist nicht an pädagogischen Leitbildern orientiert, sondern an den Regeln des Marktes. Deshalb haben die von ihr ausgehenden Sozialisationswirkungen eine egalisierende Tendenz gerade auch im Hinblick auf die Unterschiede zwischen Jugendlichen und Erwachsenen. Dem widerspricht nicht die Tatsache, daß die Freizeitindustrie in ihrer Werbung auf "Jugendlichkeit" setzt, weil dies lediglich zu einer "Puerilisierung der Gesamtkultur" (TENBRUCK) führt, nicht jedoch zur Aufrechterhaltung eines Jugendstatus. Das Vordringen dieser Freizeitkultur - charakterisiert durch vermehrte Freizeit, erhöhten Freizeitetat, das Angebot hochwertiger Freizeitgüter z. B. im Bereich der Elektronik - hat zu einem Wertewandel geführt, der insbesondere die traditionellen Arbeitstugenden - Fleiß, Unterordnung, Sparsamkeit usw. - schwächt zugunsten entgegengesetzter Tugenden und Verhaltensweisen des gleichberechtigten Genießens. Dieser Prozeß ist für alle Generationen, insbesondere aber für das Jugendalter deshalb problematisch, weil sowohl die organisatorische Struktur wie auch die Moral der bürgerlichen Gesellschaft und folgerichtig auch die je einzelne biographische Perspektive die Arbeit zum Zentrum hatten. Die Arbeit gab allen anderen Lebensäußerungen und Tätigkeiten Sinn, auch der Freizeit und dem Konsum, und im Augenblick ist nicht erkennbar, welche anderen Organisationen des gesellschaftlichen Lebens diesen Sinnverlust kompensieren könnten, zumal wenn durch Neuverteilung der verbleibenden Arbeit die individuelle Arbeitszeit weiter verkürzt werden sollte. Die massenmedial verbreitete und ständig reproduzierte Freizeitkultur hat also die pädagogische Definition des Jugendalters weitge-
1275
hend aufgehoben und die Unterschiede zwischen den Generationen nivelliert. Das gilt insbesondere auch für das massenmediale Informationssystem, das Kindern und Jugendlichen ebenso zugänglich ist wie Erwachsenen und damit den Erwachsenen jegliches Informationsmonopol genommen hat und damit die Möglichkeit, Wissen aus pädagogischen Gründen zu kanalisieren beziehungsweise gezielt im Bildungsprozeß einzusetzen.
4. Dem entspricht eine Veränderung der leitenden gesellschaftlichen Zeitperspektive. Die bürgerliche Gesellschaft war zukunftsorientiert, der Blick in die Vergangenheit gab das Maß des Fortschritts an, die Gegenwart war Durchgangsstadium für die Zukunft. Investieren gab Hoffnung auf künftigen Profit, Sparen diente der Zukunft der Kinder. Jugend galt als Garant für eine bessere Zukunft, im familiären wie im gesellschaftlichen Sinne. In der geglückten Zukunft der Kinder - vor allem im Hinblick auf den beruflichen Status - fanden die Eltern die Erfüllung ihres Wirkens. In der Öffentlichkeit wurde der Jugend - zunächst vor allem der bürgerlichen, spätestens seit dem ersten Weltkrieg aber allen Jugendlichen - nicht unerhebliche Aufmerksamkeit geschenkt, die sich zeitweise zu einem regelrechten "Jugendkult" auswuchs, wovon nicht zuletzt die Nationalsozialisten profitierten. Die erwähnten neuen Werte, die im Rahmen der sich ausbreitenden Freizeitkultur entstanden, sind jedoch eher gegenwartsorientiert, widersprechen jedenfalls der traditionellen bürgerlichen Zukunftseuphorie, die sich unter anderem in der Hochschätzung der Jugendphase niederschlug. Eine gegenwartsorientierte Kultur jedoch, wie sie sich in allen westlichen Industriegesellschaften durchzusetzen beginnt, muß der Jugend eine andere, vergleichsweise bedeutungslosere Rolle zuweisen als in der Vergangenheit. Diese Entwicklung läßt sich ablesen an der Art und Weise, wie heute öffentlich über Jugendarbeitslosigkeit diskutiert wird. Sie galt noch nach dem zweiten Weltkrieg als eine nationale wie biographische Katastrophe, während sie gegenwärtig in erster Linie ein arbeitsmarktstatistisches Problem zu sein scheint. Jedenfalls wird Jugend kaum noch mit "besserer Zukunft" in Verbindung gebracht, eher erscheint sie als lästige Randgruppe, die von den Arbeitsbesitzern mit durchgefüttert werden muß.
5. In diesem historischen Prozeß, der mit dem Aufkommen der bürgerlichen Jugendbewegung begann und dessen Ergebnis das Ende der Jugendphase als einer eigentümlichen Lebensphase ist, haben sich die Generationen im gesellschaftlichen Leben mehr und mehr voneinander separiert. Die erwähnte massenmediale kulturelle Steuerung der Gesellschaft im ganzen funktioniert bei den Jugendlichen in erster Linie über die Gruppen der Gleichaltrigen. Noch in der klassischen soziologischen Theorie von EISENSTADT erscheint die Gleichaltrigengruppe als notwendiges Übergangsphänomen zwischen Kindheit und Erwachsenenstatus. In der Familie könne man nur personenorientierte, emotional getönte, gleichsam die ganze Person umfassende Rollen lernen, in der arbeitsteiligen Gesellschaft (z. B. am Arbeitsplatz) aber benötige man emotional distanzierte und funktionsorientierte Rollen. Um diese zu lernen, biete die Gleichaltrigen-Gruppe gleichsam ein Versuchsfeld an: hier könne man lernen, nicht-familiäre Beziehungen einzugehen mit relativer Distanz, zugleich behalte man aber ein gewisses Maß an Emotionalität in der Solidarität mit denjenigen, die die gleichen Probleme haben.
Voraussetzung dieses Modells ist jedoch, daß der Erwachsenenstatus so klar definiert ist, daß er auch anvisiert werden kann. Wie aber die Shell-Studie "Jugend '81" zeigt, wird für viele Jugendliche vor allem in den großen Städten und vor allem unter der akademischen Jugend die Orientierung an der Gleichaltrigengruppe, die "Jugendzentriertheit" zum Dauerzustand bis weit ins Erwachsenenalter hinein. Hier hat die Gleichaltrigengruppe offenbar nicht mehr die Funktion eines Durchgangsstadiums, sondern sie signalisiert eher den Versuch, in einer Art von reduziertem Erwachsenenstatus zu leben, dessen Privilegien zu genießen ohne die traditionell damit verbundenen Leistungserwartungen zu akzeptieren. Jedenfalls dürften die von der Gleichaltrigengruppe ausgehenden Sozialisationswirkungen erheblich sein, vielfach bedeutsamer als die von Elternhaus und von der Schule ausgehenden Erziehungsintentionen.
6. Wie bereits erwähnt, war in der bürgerlichen Gesellschaft Jugend definiert als diejenige Lebensphase, die, entlastet von Arbeitsverpflichtungen, der Bildung und Ausbildung der
1276
Kenntnisse und Fähigkeiten im Hinblick auf die spätere berufliche Position diente. Erwachsen war, wer "ausgelernt" hatte. Jedoch ist dieses Privileg des Jugendalters längst durchbrochen, insofern auch Erwachsene wegen des kulturellen und technologischen Wandels ständig weiterlernen müssen - sei es durch Teilnahme an der Massenkommunikation oder an formellen Bildungsveranstaltungen. Alles spricht dafür, daß sich diese Tendenz noch verstärken wird. Die langen Ausbildungszeiten, die Jugendliche und junge Erwachsene auf die Gleichaltrigen fixieren, sind angesichts der neuen Medien weitgehend disfunktional geworden. Das Bildungsmonopol der Schule ist längst gebrochen, und vermutlich werden in Zukunft lebenslang Phasen der Arbeit und der Bildung einander abwechseln, so daß zum Beispiel auch Erwachsene der mittleren Generationen studieren werden, während die Ausbildungszeit der Jungen sich verkürzen wird.
III. Ausblick
Alle hier beschriebenen Tendenzen wirken dahingehend zusammen, daß die gesellschaftliche Notwendigkeit einer spezifischen Jugendphase mehr und mehr entfällt, Jugend in das Erwachsenenleben voll integriert wird. Von Bedeutung wird lediglich das Ende der Kindheit sein, das gegenwärtig etwa mit dem 12. Lebensjahr angesetzt werden kann, aber wohl noch weiter zurückgehen wird. Daraus folgt allerdings nicht, daß Menschen im Jugendalter nicht weiterhin Probleme und Krisen haben. Aber es ist fraglich geworden, ob sie noch so zu verstehen sind, wie sie die traditionelle Jugendforschung interpretiert hat, denn diese stützte sich ja auf eine gesellschaftliche Definition des Jugendalters, deren Voraussetzungen nunmehr entschwinden. Traditionelle Deutungen zum Beispiel des Fehlverhaltens Jugendlicher gründeten sich auf die Annahme, daß darin Lösungsversuche für innerpsychische oder sozial-emotionale Konflikte und Widersprüche zu sehen seien. Aber die Suchtforschung zum Beispiel läßt erkennen, daß auch die Umkehrung plausibel ist: Das Fehlverhalten - zum Beispiel der Gebrauch der Drogen - schafft erst die Probleme für ein bis dahin oft unauffälliges Leben, führt zum Beispiel zu Leistungsabfall in Schule und Beruf und zur Zerstörung bis dahin als befriedigend angesehener Basisbeziehungen. Aber das trifft für entsprechende Fälle bei Erwachsenen auch zu. Da Drogen - auch illegale - fast so leicht zugänglich sind wie andere Konsumgüter und Genußmittel auch, ist die Versuchung nicht nur für junge Menschen groß, sich ihrer aus einer ganzen Reihe von Gründen zu bedienen, ohne daß es sich dabei um Kompensation für ungelöste Probleme von einigem Gewicht handeln muß. Macht man sich diese Tatsache nicht klar, läuft man Gefahr, Jugendprobleme gleichsam zu "erfinden", nur um sich unliebsame Tatsachen erklären zu können, wofür von der Natur der Sache her vor allem solche schwer verifizierbaren Theorien anfällig sind, die sich mit der psychisch-emotionalen Dimension der menschlichen Existenz befassen. Viel spricht also für die Annahme, daß es keine jugendspezifischen Konflikte und Widersprüche mehr gibt beziehungsweise geben wird, sondern nur allgemeine, generationsunspezifische, die möglicherweise im Jugendalter eine mehr oder weniger große Rolle spielen. Identitätskrisen entstehen zum Beispiel dann, wenn die menschlichen Basisbeziehungen - Familie, Ehe,
1277
Freundschaft - als zerstört, bedroht oder unzuverlässig erlebt werden, aber Jugendliche haben keine geringere Chance als ein durchschnittliches Erwachsenenehepaar, sich Stabilität zu verschaffen, zum Beispiel durch die Gleichaltrigen-Beziehungen. Zu fragen ist allerdings, ob die gegenwärtigen Jugendprobleme nicht ihre wesentlichen Ursachen in dem Widerspruch haben, daß wir einerseits zum Beispiel bildungspolitisch, sozialpolitisch und arbeitsmarktpolitisch Jugend immer noch nach jenen überlieferten Leitbildern gesellschaftlich separieren und auf diese Weise pädagogisieren, während in anderen Bereichen - zum Beispiel im Freizeitbereich - die Integration längst vollzogen ist. Auf diesem Hintergrund bekommt der Jugendstatus nachgerade pathologische Züge.
Literatur
Aries, Ph. :Geschichte der Kindheit. München/Wien 1975
Ausubel, D. P.: Das Jugendalter. München 1968
Baacke, D.: Jugend und Subkultur. München 1972
Baacke, D.: Die 13 - bis 18jährigen. 3. Aufl. Weinheim/Basel 1983
Blos, P.: Adoleszenz. Stuttgart 1973
Blücher, V.: Die Generation der Unbefangenen. Düsseldorf/Köln 1966
Brake, M.: Soziologie der jugendlichen Subkultur. Frankfurt 1981
Brandenburg, H. Ch.: Die Geschichte der HJ. Köln 1968
Bühler, Ch.: Das Seelenleben des Jugendlichen. Frankfurt 1975 (zuerst 1923)
Döbert, R./ Nummer-Winkler, G. :Adoleszenzkrise und Identitätsbildung. Frankfurt 1975
Eisenstadt, S. N.: Von Generation zu Generation. München 1966
Erikson, E. H.: Kindheit und Gesellschaft. Stuttgart/Zürich 1966
Erikson, E. H.: Jugend Krise. Stuttgart 1970
Flitner, A.: Soziologische Jugendforschung. Heidelberg 1963
Friedeburg, L. von (Hrsg.): Jugend in der modernen Gesellschaft. Köln 1965
Giesecke, H.: Die Jugendarbeit. 5. Aufl. München 1980
Giesecke, H.: Vom Wandervogel bis zur Hitlerjugend. München 1981
Gillis, J. R.: Geschichte der Jugend. Weinheim/Basel 1980
Goodman, P.: Aufwachsen im Widerspruch. Darmstadt o. J.
Haefner, K.: Die neue Bildungskrise. Basel 1982
Hornstein, W.: Vom "jungen Herren" zum "hoffnungsvollen Jüngling". Heidelberg 1965
Hornstein, W.: Jugend in ihrer Zeit. Geschichte und Lebensformen des jungen Menschen in der europäischen Welt, Hamburg 1966
Hornstein, W. u. a.: Lernen im Jugendalter. Stuttgart 1975
Hornstein, W. I Bäuerle, Th. u. a.: Situation und Perspektive der Jugend. 5. Jugendbericht der Bundesregierung. Weinheim 1982
Jugendwerk der Deutschen Shell: Jugend '81. Bd. 1 - 3, Hamburg 1981
Klönne, A.: Jugend im Dritten Reich. Düsseldorf 1982
Kreutz, H.: Soziologie der Jugend. München 1974
Laqueur, W. Z.: Die deutsche Jugendbewegung. Köln 1962
Lessing, H. I Liebel, M.: Jugend in der Klassengesellschaft. München 1974
Mause, L. de (Hrsg.): Hört ihr die Kinder weinen. Eine psychogenetische Geschichte der Kindheit. Frankfurt 1977
Mead, M.: Der Konflikt der Generationen. Olten/Freiburg 1971
Neidhardt, F. u. a.: Jugend im Spektrum der Wissenschaften. München 1970
1278
Roessler, W.: Jugend im Erziehungsfeld. Düsseldorf 1975
Schelsky, H.: Die skeptische Generation. Düsseldorf 1957
Shorter, E.: Die Geburt der modernen Familie. Reinbek 1977
Spranger, E.: Psychologie des Jugendalters. Leipzig 1926
Tenbruck, F. H.: Jugend und Gesellschaft. Freiburg 1962
Ziehe. Th.: Pubertät und Narzißmus. Frankfurt/Köln 19751279

145. Vorbehalte gegen eine Sozialpädagogisierung der Schule (1985)
(In: Neue Sammlung, H. 4/1985, S. 510-517)
(Das folgende ist eine Replik auf eine ausführliche Kritik Hartmut von Hentigs an meinem Buch: Das Ende der Erziehung (Stuttgart 1985): Ende, Wandel oder Wiederherstellung der Erziehung? In: Neue Sammlung, H. 4/1985, S.475-509, H. G.)
Ich danke Hartmut von Hentig für seine ausführliche Kritik meines Buches, die zugleich die Hintergründe und Zusammenhänge skizziert, die für eine ernsthafte Diskussion über das "Ende der Erziehung" berücksichtigt werden müssen. Ich vermag in seinem Text aber keine prinzipielle Gegenposition zu erkennen, wohl aber die Mahnung zur Präzision und zur besseren Begründung. Das Unbehagen an den falschen pädagogischen Tönen habe ich ja nicht zuletzt von ihm gelernt, und neu ist vielleicht nur, daß ich die "Pädagogisierung" als eine kulturell einflußreich gewordene Ideologie angreife, zu deren Erfindern und Vertretern im übrigen Hartmut von Hentig wahrlich nicht gehört. Mancher scheinbare Dissens ist dadurch entstanden, daß von Hentigs Begriff von "Erziehung" viel umfassender ist als meiner. Vielleicht darf ich da geltend machen, daß unsere Zunft ja erst seit den 70er Jahren "Erziehungswissenschaft" und nicht mehr "Pädagogik" heißt, und ich habe für mich diesen Begriffswandel nie vollzogen. Ohne diese Umtaufe wäre das "Ende der Erziehung" sicher leichter zu akzeptieren. Vielleicht halte ich die moralische und kulturelle Revolution, die den Wandel von der arbeits- zur freizeitzentrierten Gesellschaft markiert, für bedeutsamer und pädagogisch folgenreicher als Hartmut von Hentig, aber gemeint habe ich damit nicht, daß die Menschen nun weniger moralisch seien als früher, sondern nur, daß sie einem erheblich größeren Wahl- und Entscheidungsdruck als früher unterliegen. Manches ist offensichtlich mißverständlich formuliert; so will ich keine Rousseau-Philologie betreiben, sondern aufmerksam machen auf die logische Konsequenz seines Grundgedankens und dessen Entfaltung im gesellschaftlichen Prozeß der letzten 200 Jahre. Ob er selbst das so vorausgesehen hat, kann ich ohne Nachprüfung nicht sagen.
Ich hoffe, daß es der weiteren Klärung der Sache dient, wenn ich im folgenden - angeregt und ermutigt durch Hartmut von Hentig - vor allem zum Stichwort "Schule" noch einmal einige Überlegungen zu präzisieren und weiterzuführen versuche.
1. Ich habe das "Ende der Erziehung" nicht als einen persönlichen Einfall verkündet oder wie die Anti-Pädagogen moralisch postuliert, sondern als das Ergebnis eines nicht umkehrbaren historischen Prozesses dargestellt, in dessen Verlauf die Zeitkategorie "Zukunft" immer mehr durch die Zeitkategorie "Gegenwart" verdrängt wird. Unter "Erziehung" verstehe ich dabei - und das ist vielleicht nicht deutlich genug geworden - nicht jede pädagogische Handlung, sondern nur diejenigen, die absichtsvoll und planmäßig von bestimmten Erwachsenen gegenüber bestimmten Kindern ausgeübt werden mit dem Ziel, diese Kinder langfristig in einem erwünsch-
510
ten Sinne zu beeinflussen. Das Ende der Erziehung ist also keineswegs auch das Ende der Pädagogik, sondern ermöglicht deren Neuorientierung, ja, deren "Modernisierung". Diese Begrenzung des Erziehungsbegriffes erscheint mir deshalb wichtig, weil wir sonst verschiedene Formen pädagogischen Handelns nicht sinnvoll unterscheiden können. Wenn ich meine Kinder zum Besuch eines Sinfoniekonzertes einlade, dann erziehe ich sie nicht, sondern arrangiere für sie eine Lernsituation; was sie kurz- oder langfristig daraus machen, bleibt ihre Sache. Wenn ich jedoch in ihre Freizeit eingreife, weil sie mehr Zeit für ihre Schulaufgaben verwenden sollen, damit sie ein möglichst gutes Abitur machen, damit sie dann studieren können, damit sie dann einen einträglichen Beruf ausüben können usw., dann erziehe ich. Meine These ist, daß diese auf die Zukunft der Kinder orientierte, von daher gerechtfertigte und auf die Konstituierung ihrer Persönlichkeit gerichtete pädagogische Handlung "Erziehen" immer sinnloser und faktisch immer weniger möglich wird. Diese Einsicht kann den Blick freimachen für andere, möglicherweise produktivere pädagogische Handlungsformen.
2. Wenn meine historische These stimmt, dann muß eine Besinnung darüber einsetzen, welche Chancen, welchen realistischen Spielraum pädagogisches, beziehungsweise "erzieherisches" Handeln noch hat. Das gilt insbesondere für das Selbstverständnis der pädagogischen Profession: Wozu sind angesichts dieser neuen Lage Lehrer und Sozialpädagogen noch da? Was sind die charakteristischen Merkmale, Formen und Ziele ihres beruflichen Handelns? Nach meinen Beobachtungen herrscht darüber unter den schulischen wie außerschulischen Pädagogen erhebliche, oft krankmachende Unsicherheit. Diese Verunsicherung will ich mit dem "Ende der Erziehung" zunächst einmal erklären. In einem zweiten Schritt - daran arbeite ich - muß versucht werden, das professionelle "Selbstbild" neu zu bestimmen. Nicht "Erziehung", sondern "Lernen" muß nach meiner Überzeugung zur zentralen Vorstellung des pädagogischen Selbstverständnisses werden. Pädagogen sind "Lernhelfer" und werden als solche nach wie vor dringend benötigt.
3. Das meiste, was Hartmut von Hentig über seine Vorstellungen von Schule sagt, finde ich richtig, und es könnte unter meiner Chiffre der "geistigen Arbeit" Platz finden. Aber ich bin besorgt über eine sich ausbreitende Tendenz in der Schulpädagogik, die ich "Sozialpädagogisierung" der Schule nennen möchte und mit der ich mich schon im Hinblick auf die außerschulische Jugendarbeit auseinandergesetzt habe (Wozu noch Jugendarbeit? in: deutsche Jugend H. 10/1984). Ich bin für jede mögliche Hilfe, die zum Beispiel lernschwachen oder "gestörten" Kindern als "begleitende Maßnahme" in oder außerhalb der Schule zuteil wird; ebenso bin ich für jede sinnvolle Form der Förderung. Aber ich bin ebenso entschieden dafür, daß die Forderungen unmißverständlich und klar sind, die die Schule an die Schüler stellt, sonst haben nämlich alle diese helfenden Maßnahmen keinen Sinn. Gewiß: diese Forderungen sind nicht "selbstverständlich", sondern das Ergebnis bildungstheoretischer und bildungspolitischer Diskussionen und Entscheidungen. Aber das ist eine andere Frage. Wenn das Kind die Schule betritt, sind solche Entscheidungen immer schon gefallen. Für dieses Postulat habe ich pädagogische und politische Gründe. Nur angesichts klarer und für ihn nicht zur Disposition stehender Forde-
511
rungen kann der Schüler seine Fähigkeiten einschätzen und damit so oder so zu leben lernen. Werden aber die im Unterricht zu stellenden Forderungen durch sozialpädagogische Gesichtspunkte relativiert, indem zum Beispiel Disziplinlosigkeit mit Rücksicht auf bestimmte Kinder geduldet wird, und somit für die Schüler unklar, dann wird die Schule zu einem Ort, der "Verwahrlosung" möglich macht. Dann ist sie selbst ein Teil der Krankheit, deren Heilung sie verspricht.
Bildungspolitisch gesehen haben wir lange für "Chancengleichheit" gekämpft. Obwohl in dieser Frage noch manches, nicht zuletzt in finanzieller Hinsicht zu tun ist, ist dieses Prinzip inzwischen weitgehend durchgesetzt. Jetzt, wo im Prinzip jeder die Bildung und Ausbildung erwerben kann, die seinen Wünschen und Fähigkeiten entspricht (die gegenwärtige Arbeitslosigkeit ist ein Problem, das mit solchen prinzipiellen Erörterungen nicht vermischt werden darf), muß klargestellt werden, daß nun jeder auch "mit seinem Vermögen leben lernen muß". Wir müssen dem Schüler nicht nur helfen, seine Chancen zu ergreifen, sondern auch seine Grenzen zu sehen und zu akzeptieren. Wenn der Schüler eine Chance hat, soviel zu lernen, wie es seinen Fähigkeiten entspricht, dann kann nur er auch die Verantwortung dafür übernehmen, was er aus dieser Chance macht, beziehungsweise wo die subjektiven Grenzen seiner Lernfähigkeit und Lernwilligkeit liegen. Wenn die Zahl der "gestörten" Kinder zunimmt, muß die Gesellschaft dafür entsprechende sozialpädagogische Angebote machen, aber sie darf dieses Problem nicht der Schule oder der Jugendarbeit einfach aufhalsen. Wenn die heutige Hauptschule Forderungen stellt, die die Mehrzahl der Schüler nicht erfüllen kann, dann muß man möglicherweise eine andere Schule machen, zum Beispiel eine, in deren Mittelpunkt nicht Bücher, sondern Werkbänke stehen. Aber jedem Schüler muß die Differenz klar sein zwischen dem, was er jetzt kann, und dem, was er noch lernen soll, sonst kann er keine realistische Selbsteinschätzung und keine Perspektive gewinnen.
Schule ist schließlich der Eintritt des Kindes in das öffentliche Leben, und als Institution muß die Schule ihre Forderungen ebenso geltend machen können wie das Finanzamt, die Polizei oder die Justiz gegenüber den erwachsenen Bürgern. Institutionen vermitteln zwischen staatlich-gesellschaftlichen Ansprüchen einerseits und den individuellen Lebensbestrebungen andererseits. Das gilt auch für die Schule. So richtig es ist, daß die Schule eine Dienstleistung für die Entwicklung der kindlichen Fähigkeiten ist, so richtig ist auch, daß der Maßstab dafür nicht in den jeweiligen kindlichen "Bedürfnissen" gesucht werden kann. Sonst muß das Kind ein falsches politisches Weltbild finden.
Disziplinlosigkeit in unseren Schulen ist nicht nur etwas, was die Schüler von außen in sie hineintragen, sie entsteht vielmehr auch in ihren Mauern dadurch, daß sie in der Sozialstruktur der Schule ermöglicht, wenn nicht gar herausgefordert wird. Da ist die Klassengröße zu nennen, aber auch der Zwang, ständig außerhalb des Klassenverbandes mit immer wieder anderen Schülern umgehen zu müssen. So manches, was unter dem Stichwort "soziales Lernen" abläuft, wäre daraufhin zu befragen. Ist es zum Beispiel nicht an der Zeit, Formen der sozialen Distanz im Unterricht zu ermöglichen, damit die Schüler "ausruhen" können vom Streß der permanenten Gruppen-Vergesellschaftung? Nicht Disziplin "als solche", also als abstrakte
512
Tugend, wohl aber Disziplin im Hinblick auf den konkreten Zweck eines menschlichen Miteinanders (zum Beispiel Unterricht) ist unabdingbar für jede menschliche Sozialität. Sicher ist es pädagogisch wünschenswert, wenn Schüler diese Disziplin freiwillig, als Selbstdisziplin aufbringen, aber im allgemeinen entsteht diese Fähigkeit nicht aus der spontanen kindlichen Seele, sondern in Auseinandersetzung mit entsprechenden Forderungen, die nicht zur Disposition stehen. Wenn man - wie das offenbar vielfach geschieht - so banale und jedem Schüler im Grunde einsichtige Selbstverständlichkeiten, wie daß zum gemeinsamen Arbeiten ein Mindestmaß an Disziplin gehört oder daß Dinge, die mutwillig zerstört werden ("Vandalismus") immerhin anderer Leute Arbeit gekostet haben, mit Schülern immer wieder "problematisiert", anstatt sie durchzusetzen, dann muß man sich fragen, ob die Wut der Schüler nicht auch aus diesem ständigen Zwang zur Selbstneurotisierung zu erklären ist.
4. Unsere Schulpädagogik krankt vor allem daran, daß sie die Schulziele nie in einem positiven Zusammenhang mit der Gesamtsozialisation des Kindes entwickelt hat. Sie hat so getan, als ob Schule der einzige wichtige öffentliche Faktor für ein "richtiges" Aufwachsen von Kindern sei, die anderen Sozialisationsfaktoren wurden immer nur als ,,negativ", als "erziehungswidrig" angesehen; ein besonderer Intimfeind der Schulpädagogik war von Anfang an das Fernsehen. Das sehe ich anders, gerade unter pädagogischem Aspekt. Die "Gefährdungen" von Kindern und Jugendlichen gehen heute weder vom Fernsehen (so, wie wir es noch haben) noch vom "Gewalt-Video" aus, sondern von den Gleichaltrigengruppen und ihren sozialen Orten. In solchen Gruppen (selbstverständlich nur in relativ wenigen) wird der Zugang zu Drogen eröffnet, entsteht die Neigung zum Randalieren und Vandalieren, entstehen Kriminalität und Terrorismus. "Verwahrlosung", das hatte schon Makarenko erkannt, ist ein Prozeß sozialer Desorganisation, kein primär psychischer Prozeß. Die Psychologie ist hier nur ein "postmortaler Klugscheißer" - wie manche Mediziner ihre Kollegen von der Anatomie ironisieren. Ich betone den sozialen Ursachenzusammenhang deshalb, weil es zur Grundüberzeugung der "Pädagogisierung" gehört, "abweichende" oder "gestörte" Kinder seien das Opfer irgendwelcher "gesellschaftlicher Verhältnisse". Das ist falsch, wenn man dabei an irgendwelche "Täter" denkt (Eltern, Kapitalisten, Militärs, Polizei), abgesehen davon, was ein Heranwachsender schon davon haben könnte, wenn man ihm solche Geschichten als "Ausreden" auftischt. Richtig ist der Hinweis auf die "gesellschaftlichen Verhältnisse", wenn man sich klar macht, daß auch für junge Menschen die Last der Verantwortung, der "Preis der Freiheit" also, um so größer geworden ist, je weniger soziale Zwänge das Handeln einerseits determinieren, je größer andererseits zum Beispiel (aber nicht nur) durch den Wegfall von Bildungsprivilegien die Optionsmöglichkeiten geworden sind. Wenn nun also auch die Schule irgendwelche Banalitäten ins Reich der Optionen befördert - und dies entgegen ihrer institutionellen Funktion - dann hilft sie den Schülern nicht, sondern verstärkt das ohnehin vorhandene Problem, das im Kern heißt: Übernahme der Selbstverantwortung mit allen Konsequenzen.
Nicht wenige Drogenforscher präsentieren uns heute folgende "typische Karriere":
513
Die jungen Leute haben keine erkennbaren Probleme, bevor sie in die Drogenszene rutschen (weil Eltern, Lehrer und Sozialpädagogen sie ihnen viel zu lange abnehmen), und sie bekommen Probleme (mit der Arbeit, mit der Schule), weil und nachdem sie Zugang zu Drogen bekommen haben. In der Drogentherapie scheint die einzige wirkliche Chance in einer rigorosen "Umerziehung" im Rahmen einer monatelangen Kasernierung zu liegen. Dabei geht es im wesentlichen um eines: zu lernen, die Verantwortung für sein Leben selbst zu übernehmen, und die Ausreden, nicht zuletzt die der Pädagogisierung, als Hemmnis dafür zu erkennen. Wenn es uns nicht gelingt, den Kindern und Jugendlichen die Verantwortung für sich selbst so früh wie möglich nicht nur zu übertragen, sondern auch abzuverlangen (und ihnen damit Probleme zu machen, damit sie sich nicht selbst welche erfinden müssen, denn ohne Probleme kann ein Mensch nicht leben), dann werden wir in absehbarer Zeit eine Menge "Umerziehungslager" brauchen.
5. Hartmut von Hentig befürchtet, daß ich in das Lager der "Anti-Pädagogen" überwechseln könnte. Von den Anti-Pädagogen trennen mich zwei, wie ich glaube, unüberbrückbare Differenzen. Einmal die ausschließlich moralistische Begründung ihrer Position; zum anderen die Einstellung zum "Kind als König" (das Kind selbst setzt fest, wann es welche Verantwortung übernehmen will), und beides macht sie in meinen Augen zu bedeutsamen "Pädagogisierern". Die Anti-Pädagogen übersehen dabei eine fundamentale gesellschaftliche Tatsache, daß nämlich jeder Mensch lernen muß, für seine materielle Subsistenz zu sorgen, also sein "tägliches Brot" selbst zu verdienen. Die Idee des "Generationenvertrages" besagt zwar, daß irgendwelche zuständigen Erwachsenen (in der Regel die Eltern) die materielle Sorge für Kinder zu übernehmen haben, aber nur zu dem Zweck, damit diese Kinder möglichst bald - entsprechend ihren Fähigkeiten - die Verantwortung dafür selbst übernehmen können. Die Kinder erfüllen ihre Seite des Vertrages dadurch, daß sie im Rahmen der Schule und der Berufsausbildung ihre Fähigkeiten so gut wie möglich entwickeln. Verweigert ein Kind dies - ist es zum Beispiel dauerhaft "faul" - so bricht es nicht nur diesen ideellen Vertrag, es wird auch zum Parasiten, der ungebührlich lange auf Kosten anderer Leute Arbeit zu leben wünscht. Eine "sozialpädagogisierte Schule" hilft mit, diese fundamentale Tatsache zu verschleiern.
6. Hartmut von Hentig vermißt bei mir eine Erklärung für den Erfolg der "Pädagogisierung". Ich meine, eine solche Erklärung angeboten zu haben, die sicherlich nicht ausreicht, aber doch wohl eine gewisse Plausibilität hat: Die "Pädagogisierung" erlaubt uns allen, auf persönliche Verantwortung zugunsten ihrer mehr oder weniger anonymen Kollektivierung zu verzichten. Das ist eine ungeheure, massenwirksame Versuchung! Zudem vermag sie sich mit dem Schein des "Fortschrittlichen", "Modernen" zu umgeben, verhilft den Menschen zum mühelosen Selbstbewußtsein, weil das, was sie tun, "in" und jeweils "auf der Höhe der Zeit" zu sein scheint. Gleichwohl wäre die Pädagogisierung als bloße Ideologie kaum derart erfolgreich, wenn sie nicht innerlich verbunden wäre mit dem vielleicht wichtigsten gesellschaftlichen Prozeß unserer Zeit: der Bürokratisierung; denn wie uns die politischen Skandale zeigen, ist Eliminierung persönlicher Verantwortlichkeit ein Grundgesetz bürokratischen Handelns und bürokratischer Organisationen. "Päd-
514
agogisierung" legitimiert die Bürokratisierung, obwohl manche ihrer Vertreter sich oft über sie beklagen - dann durchschauen sie ihre eigene Position nicht - und die Bürokratisierung ermöglicht der "Pädagogisierung" ein dauerhaftes Dasein.
"Bürokratisierung" ist nicht nur etwas, was den pädagogischen Einrichtungen von außen entgegentritt; es gibt auch eine "innere Bürokratisierung" zum Beispiel in den Schulen selbst als unmittelbarer Ausdruck der kollektivierten Pädagogisierung. Ich denke dabei an die "Gremialisierung" des Schullebens, die ständigen Konferenzen, Teilkonferenzen, Ausschüsse, Team-Sitzungen, teils mit Eltern- und/oder Schülervertretern bis hin zu Selbsterfahrungsgruppen in einem Kollegium (oft als "schulinterne Fortbildung" verharmlost). Hier geht es gar nicht mehr in erster Linie um die Beratung von Sachfragen, sondern um die permanente Vergesellschaftung aller mit allen, was offensichtlich durchaus lustvoll erlebt werden kann. Verantwortung kollektivieren ist das innere Geheimnis dieses "hausgemachten" Unfugs.
7. Bei der Frage, ob der Staat das Recht habe, von sich aus Erziehungsziele in den Schulen festzusetzen, zeigt sich, daß von Hentigs Begriff von "Erziehung" sehr viel umfassender ist als meiner. Insofern gibt es hier weniger Dissens zwischen uns, als auf den ersten Blick scheint; denn selbstverständlich wünsche auch ich, daß die Schüler "Respekt vor anderen Meinungen und Positionen", "Toleranz", "Achtung der Menschenwürde" usw. tatsächlich in den Schulen lernen. Wenn meine Leitvorstellungen für den Schulunterricht ("Wahrheit", "Richtigkeit", "richtiges gemeinsames Zusammenleben in der Zukunft") gültig wären, dann würden sich alle diese sogenannten "Erziehungsziele" daraus sozusagen als "Nebenprodukte" ergeben. Wer zum Beispiel nach "Wahrheit" strebt, kann dies nur gemeinsam mit anderen und insofern zum Beispiel nicht als Rassist argumentieren, und "kritisch" muß er auch sein, nicht zuletzt gegen sich selbst. Aber die Erwartungen gehen ja weiter. Der traditionelle Erziehungsbegriff gerade auch unter Politikern und in der sonstigen Öffentlichkeit meinte und meint nicht eine jeweils partikulare Lernleistung, sondern immer die Einwirkung auf die Persönlichkeit im ganzen (sonst wären zum Beispiel die erbitterten Auseinandersetzungen über Richtlinien völlig unverständlich). Nun ist aber charakteristisch für demokratische Institutionen, daß sie jeweils nur partikulare Anforderungen an die Bürger stellen dürfen, nicht solche, die die Persönlichkeit im ganzen betreffen. Für die Bildungsinstitutionen hat diese Einsicht lange keine Geltung bekommen, denken wir zum Beispiel an die Verfechter der Konfessionsschulen noch in den fünfziger Jahren, die zur Begründung anführten, daß das Kind zunächst eine auch im weltanschaulichen Sinne "geschlossene" Erziehung erhalten müsse, damit es danach in der Lage sei, sich ohne Gefährdung seiner Identität dem weltanschaulichen Pluralismus auszusetzen Mit dem Ende der Konfessionsschulen war auch das historische Ende der staatlichen Erziehungsschule gekommen. Nicht von ungefähr ist neuerdings von "Lernzielen" die Rede. Sieht man von deren technizistischer Akrobatik ab, so drücken sie genau diese partikulare Selbstbeschränkung aus: der Staat kann in seinen Schulen Lernanforderungen stellen, aber nicht irgendwelche, sondern nur solche, die durch Unterricht erreichbar, beziehungsweise an ihn gebunden sind. Das ist der demokratische Sinn der im Detail wie auch immer problematischen "Lernzielkataloge". Wie weit diese partiku-
515
laren Anforderungen auch bedeutsam sind für die Prägung der Persönlichkeit, für deren Charakter, wie weit sie also "erzieherisch" bedeutsam sind, muß offenbleiben. Wer in der Schule sich kritisch mit Unterrichtsgegenständen auseinandersetzt, muß deshalb nicht schon ein "kritischer Mensch" sein; wer in der Schule Achtung und Respekt vor anderen Völkern, Rassen und Lebensstilen demonstriert, kann draußen durchaus mit den Neo-Nazis sympathisieren; dazu braucht er gar keine Schizophrenie, sondern zum Beispiel lediglich die Vorstellung, Schule sei eben ein Job wie jeder andere auch, da müsse eben eine Arbeit in bestimmter Weise erledigt werden, aber Gesinnungen, Einstellungen und Verhaltensweisen an anderen sozialen Orten hätten davon unberührt zu bleiben. Wir sollten uns da nicht täuschen: selbst auf den Universitäten ist diese "Arbeit-Freizeit-Antinomie" weit verbreitet.
Nein, "erziehen" kann und darf die Schule nicht mehr, aber sie kann auf dreierlei Weise Lernarrangements bereitstellen und damit in dreierlei Hinsicht Erfahrungen ermöglichen, die vielleicht und hoffentlich bei den Schülern die erwünschten Wirkungen hinterlassen. Erstens kann sie durch die Wahl der Unterrichtsgegenstände wichtige Einsichten ermöglichen; zweitens kann sie durch die Art und Weise der unterrichtlichen Bearbeitung (Wahrheit; Richtigkeit; Kritik; Perspektivenwechsel usw.) Einstellungen fördern, die wir dem Leitbild des "mündigen Menschen" zurechnen. Drittens kann die Schule durch ihre sozialen Arrangements Erfahrungen ermöglichen, die uns für "demokratisches Verhalten" wünschenswert erscheinen: Kooperation, Solidarität, Respekt, Toleranz, Achtung usw., wie sie im Aufgabenkatalog der Kultusminister von 1973 zu finden sind. Allerdings dürfen die sozialen Arrangements sich nicht lösen von der dominanten Aufgabe des Unterrichts, weil sie sonst bald als "pädagogischer Schwindel" erkannt werden (Beispiel: Gruppenarbeit nicht als sozialer Selbstzweck, sondern nur dann, wenn auf diese Weise das Unterrichtsergebnis besser sein kann, als es durch "Frontalunterricht" zu erzielen wäre, oder wenn auf diese Weise ein anderes, für wichtig gehaltenes Ergebnis "in der Sache" zustandekommen kann). Zur "Menschenwürde" des Schülers gehört auch, daß die sozialen Zumutungen an ihn auf das beschränkt bleiben, was vom Unterricht her unabdingbar und auch für ihn klar erkennbar notwendig ist. Alles andere würden wir uns als Erwachsene auch verbitten. Die Schule sollte sich auf das konzentrieren, was sie im Rahmen ihrer heutigen und voraussehbaren gesellschaftlichen Bedingungen wirklich tun kann, und sie sollte dies so gut wie möglich tun.
Alles in allem: Ich halte das "Ende der Erziehung" vor allem in der Schule für eine wichtige Konsequenz der gesellschaftlichen Demokratisierung. Die "Partikularisierung" von Lern- und Verhaltensanforderungen in allen öffentlichen Erziehungs- und Bildungseinrichtungen ist ein wichtiges Stück der politischen Emanzipation der Heranwachsenden, aber nur dann, wenn diese partikularen Forderungen auch durchgesetzt werden. Die Konsequenz aber jeder Emanzipation und also auch dieser ist, daß die Emanzipierten nun auch die Verantwortung für sich übernehmen müssen, sonst "droht Verwahrlosung", weil die gesellschaftlichen Bedingungen (einschließlich der "Gleichaltrigenszene") sich nicht zurückdrehen lassen. Daran gemessen ist die "Pädagogisierung" eine anti-demokratische Ideologie, weil sie
561
davon lebt, diese Emanzipation zu verhindern. Wie es gelingen kann, möglichst viele Kinder und Heranwachsende so früh wie möglich verantwortungsfähig zu machen - das ist das Generalthema der Pädagogik von heute und morgen.
517

146. Auch Lehrer lernen dazu (1985)
(In: Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt Nr. 30, 28.7.1985)
Niemand kann wissen, was er seiner Erbmasse, seinem Herkunftsmilieu oder seiner Erziehung verdankt. Sind wir das, was wir sind, im wesentlichen durch die bewußte Lenkung von Eltern und Lehrern geworden oder eher durch selbstverständliche Teilnahme an der Kultur der Erwachsenen und der Gleichaltrigen, also durch "Sozialisation"? Oder haben wir uns letzten Endes selbst "gemacht", indem wir uns schon als Kinder aktiv mit unserer Umwelt und deren Ansprüchen auseinandergesetzt und unsere Lernchancen genutzt haben?
Es gibt Zeiten, in denen der pädagogische Optimismus blüht; es sind die Zeiten tiefer kultureller Widersprüche und Krisen. Die Menschen sind mehr oder weniger unzufrieden mit ihrer Gegenwart, die einen wollen zurück zu den "alten Werten', die anderen streben einer neuen Gesellschaft entgegen. Beide aber setzen auf "Erziehung", also darauf, andere Menschen - vor allem die jungen - planmäßig und zielbewußt zu dem von ihnen gewünschten Verhalten zu bewegen.
Die letzte pädagogische "Hoch-Zeit" haben wir in den 70er Jahren erlebt. Die pädagogischen Berufe und die pädagogischen Wissenschaften expandierten, alles schien möglich, und das, was noch nicht möglich war - zum Beispiel lernunwillige Kinder zu "motivieren" - wurde den modernen, empirisch orientierten Wissenschaften zur Aufgabe gestellt. Sie sollten herausfinden, wie man die in Familien und Schulen erkennbaren Grenzen der Erziehung aufheben oder zumindest überschreiten könne.
Inzwischen ist Ernüchterung eingetreten: Haben wir uns nicht Illusionen gemacht über das, was geplante Erziehung vermag? Dieser Frage ist Rainer Dollase in seinem Band "Grenzen der Erziehung" sehr gründlich und mit viel Humor und Ironie nachgegangen. Dieses Buch ist - was bei uns immer noch und schon gar bei Empirikern selten ist - ausgesprochen "leserfreundlich" und dabei in der Sache präzise geschrieben. Erfahrung, so Dollase, führe in der Pädagogik oftmals weiter als die Wissenschaft. Was in einer empirischen Untersuchung "signifikant'' ist, ist damit für praktisches pädagogisches Handeln noch keineswegs "relevant"; die Wirklichkeitsmodelle der Wissenschaften sind nicht die des Alltags und können es nicht sein. Etwa 90 Prozent der Resultate der empirischen Erziehungswissenschaft seien für die pädagogische Praxis belanglos. Zudem: Was statistisch von Bedeutung ist, gilt noch lange nicht für das einzelne Kind. Und welcher Pädagoge ist schon in der Lage, wissenschaftliche Ergebnisse und Handlungsstrategien in vollendete Wirklichkeit umzusetzen? Hinzu kommen Grenzen, die sich aus Anlage und Umwelt ergeben. Die Erbanlage des einzelnen Schülers kann nicht beeinflußt werden, aber sie kann auch wissenschaftlich nicht ermittelt werden.
Dollase schreibt gegen den "Machbarkeitswahn'` in der Erziehung, aber er plädiert keineswegs für Resignation und Verantwortungslosigkeit. "Grenzbewußtsein" empfiehlt er uns, realistische Ziele zu setzen, die Gegenwart des Kindes nicht seiner Zukunft zu opfern, der Lernaktivität des Kindes mehr zuzutrauen. Angesprochen sind damit nicht nur die Berufspädagogen, sondern vor allem auch die Eltern, die oft die von den Massenmedien gerade verbreiteten pädagogischen Moden für das letzte Ergebnis der Forschung halten und ihre Kinder damit traktieren oder sie zum Beispiel im Hinblick auf Schulleistungen überfordern. Dollases Buch ist keineswegs "antipädagogisch", aber es macht den Blick wieder frei für die Einsicht, daß pädagogisches Handeln eben eine menschliche Tätigkeit ist, deren Grenzen zu akzeptieren der Würde der Beteiligten und Betroffenen dient.
Rainer Dollase: Grenzen der Erziehung. Anregung zum wirklich Machbaren in der Erziehung. Verlag Schwann-Bagel, Düsseldorf. 227 Seiten, 28,- DM
URL des Dokuments: : http://www.hermann-giesecke.de/werke18.htm